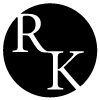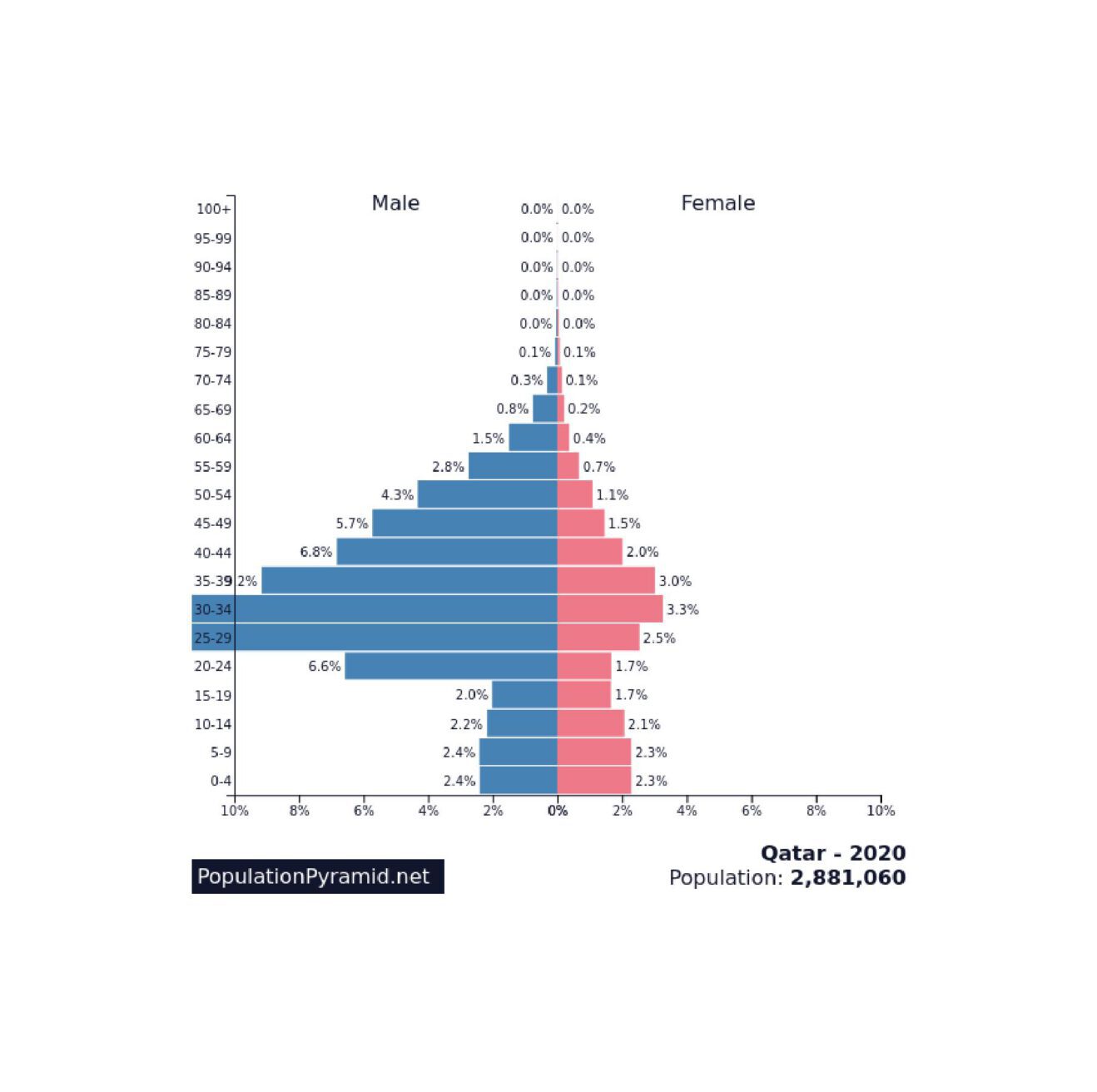Reiner Klingholz
Blog Bevölkerung und Entwicklung
11.02.2026
Sachsen-Anhalt: alt und leer gelaufen
Wie der demografische Wandel der AfD in die Hände spielt
In Sachsen-Anhalt finden am 6. September Landtagswahlen statt. Den aktuellen Umfragen zufolge liegt dabei mit nahezu 40 Prozent eine Partei vorne, die noch an keiner Landes- oder Bundesregierung beteiligt war. Je nachdem, ob kleinere Parteien wie BSW, Grüne und FDP an der Fünfprozenthürde scheitern, könnte es für die AfD sogar zu einer Alleinregierung reichen. Deren sachsen-anhaltinischen Landesverband stuft der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ ein.
Weshalb aber wollen so viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme dieser radikalen Partei geben? Was versprechen sie sich von einer Regierung, die so ziemlich alles anders und besser machen will, deren Wahlprogramm aber kaum Besserung verheißt?
Zugegeben, Sachsen-Anhalt hat eine Reihe von Problemen: Es ist, gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner, das ärmste aller Bundesländer. Und es leidet wie kein zweites unter den Folgen des demografischen Wandels. Sachsen-Anhalt hat seit 1990 mehr als ein Viertel seiner Einwohner verloren. Weil nach der Wende vor allem junge Menschen abgewandert sind und die Geburtenziffern vorübergehend auf ein historisches Tief abgesunken waren, ist die Restbevölkerung deutlich gealtert. Sachsen-Anhalt hat mit einem Durchschnittsalter von 48,3 Jahren die älteste Gesamtbevölkerung unter allen Bundesländern.
Aus dieser demografischen Verfassung resultieren wenig Nachwuchs und ein zunehmender Überschuss der Sterbefälle über die Geburten. Folglich werden dem Bundesland auch künftig die größten Bevölkerungsverluste vorhergesagt. Bis 2050, so schätzt das Statistische Bundesamt, dürften Sachsen-Anhalt noch einmal 18 Prozent der heute 2,1 Millionen Einwohner verloren gehen. Dieser Schwund kann kaum durch Zuwanderung kompensiert werden, denn für Menschen aus anderen Ländern ist Sachsen-Anhalt offenbar nicht sonderlich attraktiv: Ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern haben lediglich rund 11 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, bundesweit sind es 26 Prozent.
Warum meiden die Menschen Sachsen-Anhalt?
Die Bevölkerungsverluste nach der Wende waren noch nachvollziehbar. Das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts war zu DDR-Zeiten das Herz der Ost-Industrie. Maschinenbau, Chemieindustrie und Bergbau, vor allem die Braunkohleförderung, boten Zehntausenden Beschäftigung, bescherten dem Land aber auch eine Rekordverschmutzung von Luft, Wasser und Böden. Mit dem Ende der Planwirtschaft konnte kaum einer der maroden und umweltschädlichen volkseigenen Betriebe überleben. Fast die Hälfte aller Jobs ging zwischen 1990 und 2000 verloren und die Arbeitslosigkeit stieg auf 20 Prozent. Das war Negativrekord der Republik und er wäre noch negativer gewesen, wären nicht so viele Menschen gen Westen abgewandert. Vor allem die Jungen kehrten dem Land den Rücken, auf der Suche nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, aber auch, weil die Verdienstmöglichkeiten im Westen besser waren und weil sie ihre neue Reisefreiheit genießen konnten.
Die Arbeitslosigkeit unter Männern lag damals in den neuen Bundesländern höher als die unter Frauen. Männer waren von der Deindustrialisierung stärker betroffen, denn sie waren zu DDR-Zeiten eher in den „Malocherjobs“ beschäftigt, in der Produktion oder im Bergbau, während Frauen tendenziell im Dienstleistungsbereich, im Bildungs- und Gesundheitssektor tätig waren, wo es nicht zu Arbeitsplatzverlusten kam. Eigentlich wäre damit der Abwanderungsdruck auf Männer größer gewesen als auf Frauen.
Frauenmangel, Bildungsmangel und rechtes Wahlverhalten
Interessanterweise waren es aber dennoch überwiegend junge Frauen, die in den ersten zwei Jahrzehnten nach der Wende Sachsen-Anhalt (wie auch die anderen Ost-Bundesländer) im Saldo verlassen haben. In weiten Teilen der vom Strukturwandel gebeutelten Gebiete kamen in der Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen auf 100 Männer nur noch etwa 80 Frauen. Entsprechend gab es einen Überschuss an jungen Männern, und die waren nicht mehr wie im Sozialismus die „Helden der Arbeit“, sondern im schlimmsten Fall gering qualifiziert, arbeitslos und ohne Chance auf eine Partnerin. Eine brisante Mischung.
Womöglich war es kein Zufall, dass die Erfolge einer rechtsextremen Partei, damals der NPD als Vorläuferin der AfD, bei der Bundestagswahl 2005 in den neuen Bundesländern dort am größten waren, wo der Frauenmangel am höchsten war. Im Osten von Sachsen beispielsweise, wo der Überschuss an jungen Männern bei über 25 Prozent lag, kam die NPD bereits auf über fünf Prozent. Vor allem diese Altersklasse hat damals rechtsaußen gewählt, und die Männer doppelt so häufig wie die Frauen.
Jung, schlau, Frau – und weg
Der Hauptgrund für die selektive Frauenabwanderung nach der Wende, die eine soziale und intellektuelle Erosion zur Folge hatte, waren eklatante Bildungsunterschiede. Um die Jahrtausendwende herum stellten die Mädchen im Osten Deutschlands über 60 Prozent der Abiturjahrgänge, die Jungen hingegen 60 Prozent der Hauptschulabsolventen. Unter jenen, die sogar am Hauptschulabschluss scheiterten, waren mit fast 15 Prozent etwa doppelt so viele Jungen wie Mädchen. Die mit Abstand meisten Schulversager gab es in Sachsen-Anhalt.
Mit dem Abitur in der Tasche waren die jungen Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen mit oder ohne Hauptschulabschluss wesentlich selbstbewusster und fähiger, im Westen eine Berufskarriere aufzubauen. Die meisten der abgewanderten Frauen hatten Erfolg und schlugen dort Wurzeln, während viele der zunächst abgewanderten jungen Männer nach einiger Zeit enttäuscht in ihre alte Heimat zurückkehrten.
Auch die Suche nach einem potenziellen Partner spielte bei der Abwanderung eine Rolle. In den neuen Bundesländern orientierten sich Frauen bei der Partnerwahl tendenziell sozial „nach oben“. Es fehlte aber schlicht an ausreichend gebildeten und gut verdienenden Männern, die den Ansprüchen der jungen Frauen genügen konnten. Die fanden sie häufig erst jenseits der ehemals deutsch-deutschen Grenze. Im Osten blieben somit junge Männer zurück und viele von ihnen richteten sich in ihrer beruflichen Perspektivlosigkeit ein.
Schon die NPD richtete sich damals speziell an die Wählergruppe der enttäuschten Männer: Im Parteiprogramm ging es viel um das klassische Familienbild mit dem Mann als Ernährer und einer Partnerin als Hausfrau und Mutter. Diese „sollte nicht aus finanziellen Gründen außerhäuslich arbeiten müssen, da der Beruf in der Familie sie voll auslastet“. „Die heutige Gleichmacherei zwischen Frau und Mann lehnen wir ab“, hieß es im Programm der Republikaner, einer anderen Rechtspartei, die in den 1990er und 2000er Jahren gewisse Erfolge in West und Ost erzielen konnte.
Wenn Männer auf Familie machen
Genau mit dieser Art von „Familienpolitik“ macht auch heute die sachsen-anhaltinische AfD Wahlkampf, in deren 22-köpfiger Landtagsfraktion gerade mal zwei Frauen sitzen. Die demografische Lage des Bundeslands vor Augen, fordert sie im Entwurf für ihr „Regierungsprogramm“ allerlei Vergünstigungen für die „Familie aus Mann und Frau“, darunter eine Babyprämie von 4.000 Euro. Alles von Kindergärten über das Schulessen bis zum Deutschlandticket für Familien soll ungeachtet der prekären Finanzlage des Bundeslandes kostenfrei sein, in der Hoffnung damit „das Aussterben des deutschen Volkes“ aufhalten zu können. Gleichzeitig ist der AfD der ohnehin geringe Migrantenanteil in Sachsen-Anhalt ein Dorn im Auge. Zwar braucht das Bundesland mangels eigener Potenziale Arbeitskräfte aus anderen Ländern wie kaum ein anderes, aber „Remigration“ soll auch zwischen Stendal und dem Burgenlandkreis für ethnische Homogenität und Wohlstand sorgen.
Wahlanalysen zufolge ist die AfD heute bei jener männlichen Altersgruppe besonders beliebt, der damals die Frauen abhandengekommen sind. Wer zu Beginn der 2000er Jahre Anfang 20 war, ist heute um die 45 Jahre alt – und wählt mehrheitlich die AfD. Die Jahrgänge der gebeutelten und frustrierten Männer sind lediglich im Zeitverlauf nach oben gerutscht.. Aber auch regional passt das Bild: Wo der Mangel an jungen Frauen einst am höchsten war, feiern die Rechtsextremen ihre größten Erfolge. Das alles mag Zufall sein, denn nicht jede Korrelation bedeutet auch einen ursächlichen Zusammenhang. Aber es würde sich lohnen, nach der nächsten Wahl einmal genauer auf die Daten zu schauen.
Eigentlich ist Sachsen-Anhalt ein tolles Bundesland
Inhaltlich lässt sich der Höhenflug der AfD ohnehin nicht erklären. Das Land hat die schwersten Zeiten hinter sich. Die katastrophalen Umweltbedingungen aus DDR-Zeiten sind Vergangenheit, alte Dreckschleudern geschlossen und aus dem Weg geräumt, viele Braunkohletagebaulöcher zu Seenlandschaften geworden. Bei der Arbeitslosigkeit ist Sachsen-Anhalt nur noch fünftletztes Bundesland. Der Statistik zufolge fehlen sogar über 15.000 qualifizierte Arbeitskräfte.
Die Durchschnittsmieten sind nicht einmal halb so hoch wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Mit Halle und Magdeburg hat Sachsen-Anhalt zwei attraktive Hochschulstandorte. Wer von Niedersachsen über die Grenze fährt, trifft auf merklich bessere Straßen, der Aufbau Ost lässt sich nicht übersehen. Die meisten Kleinstädte sind aufgehübscht und kein anderes Bundesland hat so viele Unesco-Weltkulturerbestätten, darunter das Bauhaus in Dessau, der Dom zu Quedlinburg oder die Lutherstätten in Wittenberg und Eisleben. Die Tourismusindustrie könnte erblühen, gäbe es für sie nur genug zugewanderte, aber von der AfD ungewollte Arbeitskräfte. Die Windenergie könnte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor bleiben, wollte die AfD die „Mühlen der Schande“ nicht abreißen und durch Kraftwerke ersetzen, die heimische Braunkohle und russisches Gas verfeuern.
Sachsen-Anhalt könnte unter einer mutigen und stabilen Regierung eine gute Zukunft vor sich haben. Wäre da nicht die Landtagswahl im September.
23.01.2026
Mehr Sterbefälle als Geburten
Immer mehr Länder bewegen sich in die „Netto-Todeszone“
Das waren noch Zeiten. Viele Jahre galt Frankreich als das Land mit erfolgreicher Familienpolitik: Sehr gute Betreuungsbedingungen für die Kleinen, ein hoher Anteil von Müttern im Erwerbsleben und Geburtenziffern von annähernd zwei Kindern je Frau, ein Niveau, das kaum ein Land in der EU erreichte. Schon lange nicht der große Nachbar im Osten: Die Frauen zwischen Rügen und dem Bodensee bekamen rund ein Drittel weniger Kinder als die Französinnen.
Während in Deutschland aufgrund niedriger Kinderzahlen schon seit 1972 in jedem Jahr mehr Menschen versterben als Neugeborene hinzukommen, war es in Frankreich stets umgekehrt. Dort wuchs die Bevölkerung Jahr für Jahr aus zwei Gründen: wegen des Geburtenüberschusses und weil Zuwanderer ins Land kamen. In Deutschland wuchs sie auch, aber einzig wegen der Migration. Anfang der 2000er Jahre gingen die Bevölkerungsprognosen noch davon aus, dass Frankreich Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts an Einwohnern überflügeln würde.
Doch das ist demografischer Schnee von gestern. Das Familienwunder Frankreichs ist vorüber. 2025, so vermeldet das französische Statistikamt INSEE, gab es erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs mehr Verstorbene als Neugeborene. Nur noch 1,56 Kinder je Frau kamen zur Welt, ein Rekordtief für Frankreich und deutlich weniger, als es den Berechnungen nach für ein stabiles Rentenniveau sein müssten.
Auf die Sozialsysteme Frankreichs, die ohnehin unter Stress stehen, kommen damit noch schwerere Zeiten zu. Auch dort gehen die in den 1960er Jahren geborenen Babyboomer mittlerweile in den Ruhestand. Und der währt länger als in Deutschland, weil Frankreich eine rund zwei Jahre höhere Lebenserwartung aufweist. Französinnen werden im Schnitt fast 86 Jahre alt, Männer gut 80 Jahre.
Damit sinkt, wie in praktisch allen Industrie- und längst auch vielen Schwellenländern der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, während jener der Ruheständler steigt. Doch trotz der erkennbaren Probleme weigert sich die französische Wählerschaft hartnäckig zu akzeptieren, dass das gesetzliche Rentenalter, das derzeit schrittweise auf gerade mal 64 Jahre angehoben wird, weiter erhöht werden muss. Die anhaltende Regierungskrise Frankreichs beruht im Wesentlichen auf landesweiten Protesten gegen ein höheres Renteneintrittsalter.
Europaweites Phänomen
Regionen mit einem Überschuss der Sterbefälle über die Geburten, sogenannte Netto-Todeszonen, breiten sich längst über die ganze EU aus. Rund 90 Prozent der Union sind davon betroffen. Wo mehr Menschen aus dem Leben treten als neue hinzukommen, fällt die natürliche Bevölkerungsbilanz ins Negative. Für die EU als Ganze betrachtet gilt das seit 2012. Nur aufgrund von Zuwanderung ist sie nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Doch auf Dauer dürfte die Migration einen Bevölkerungsrückgang nicht mehr kompensieren. Nach den Vorausberechnungen der europäischen Statistikbehörde Eurostat wird die Einwohnerzahl der (heutigen) EU selbst bei einer angenommenen Nettozuwanderung von 1,2 Millionen Personen pro Jahr bis 2070 von heute etwa 450 Millionen auf 432 Millionen sinken.
In Deutschland verzeichnet gerade noch ein knappes Dutzend der insgesamt 401 Landkreise und kreisfreien Städte einen Geburtenüberschuss. Das sind Groß- und Universitätsstädte wie München, Frankfurt, Freiburg oder Mainz, die attraktiv genug sind, um viele junge Menschen anzuziehen, aus denen dann auch Familiengründer werden, sowie die beiden Landkreise Cloppenburg und Vechta in Westniedersachsen mit ihren traditionell relativ hohen Kinderzahlen. Der Rest der Kreise ist auf den Karten von Eurostat rot bis dunkelrot eingefärbt, was für einen zum Teil hohen Sterbeüberschuss steht. Das gilt vor allem für Ostdeutschland inklusive Berlin, wo überall mehr Menschen versterben als geboren werden. In manchen Kreisen wie Uckermark oder Spree-Neiße in Brandenburg, im sachsen-anhaltinischen Stendal oder in Thüringens Suhl beträgt der jährliche Sterbeüberschuss mehr als ein Prozent. Da dort die Bevölkerung bereits stark gealtert ist und die wirtschaftlich-politische Lage für Zuwanderer wenig attraktiv erscheint, stellt sich mancherorts bald die Frage, wer als letzter das Licht ausmacht.
Damit ist Ostdeutschland die massivste Netto-Todeszone der EU. Punktuell problematisch ist die Lage auch in Nordwestspanien, in Teilen Portugals, Italiens, in Griechenland und Bulgarien, sowie in den baltischen Ländern. Einen flächendeckenden Geburtenüberschuss gibt es einzig in Irland und im nicht zur EU gehörenden Island.
Halbiert sich Chinas Bevölkerung?
Weltweit betrachtet sieht es nicht viel anders aus. Überall in den mittel und weit entwickelten Ländern sinken die Geburtenzahlen, während die Sterbezahlen steigen. Zwei Drittel der Menschheit leben in Ländern, in denen weniger als zwei Kinder je Frau zur Welt kommen. Ostasien mit Japan, Südkorea und China verzeichnet seit Jahren einen Sterbeüberschuss, der nicht durch ausreichend Zuwanderung ausgeglichen wird, weshalb die Bevölkerungszahlen bereits sinken. China dürfte nach den Projektionen der UN-Bevölkerungsabteilung bis 2050 über 100 Millionen, bis 2100 etwa die Hälfte der heute etwa 1,4 Milliarden Einwohner verlieren. Die stärkste Verlustphase steht dem Land zwischen 2024 und 2054 bevor, wenn die geburtenstarken Jahrgänge aus der frühen Phase der Mao-Regierung auf ihre letzte Reise gehen. Damals, zwischen 1950 und 1970, brachten die Chinesinnen noch ungefähr sechs Kinder zur Welt. Heute ist es nur noch eins.
Make America small again
Selbst die USA, lange ein Garant für vergleichsweise hohe Kinderzahlen und einen Geburtenüberschuss, stehen vor einer demografischen Zeitenwende. Beide Kennzahlen haben klassischerweise von einer hohen Migration profitiert. Denn die Zugewanderten waren im Schnitt jünger als die alteingesessene Bevölkerung und bekamen mehr Kinder. Jetzt aber ist die US-Geburtenziffer auf 1,6 Kinder je Frau abgesackt und die Babyboomer aus der Nachkriegszeit erreichen langsam ihr Lebensende. Prognosen gehen davon aus, dass auch die USA im Jahr 2030 zur Netto-Todeszone werden und der Bevölkerungszuwachs bis Mitte des Jahrhunderts ein Ende findet.
Womöglich sogar noch deutlich früher. Denn Grenzschließungen und Massendeportation von Migranten unter der Trump-Regierung haben dazu geführt, dass die Netto-Zuwanderung in die USA, einst ein Musterbeispiel für ein Einwanderungsland, im Jahr 2025 erstmals auf null gefallen ist. Ein Hauptfaktor für die positive demografische und wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit ist damit außer Kraft gesetzt. Und das bedeutet: Make America small again.
13.01.2026
So wird das nichts
Warum eine wirksame Klimapolitik so schwierig ist – und noch schwieriger wird
Machen wir einmal eine nüchterne Analyse: Wo liegen die Ursachen für die multiplen und sich zum Teil gegenseitig verstärkenden Umweltkrisen unserer Zeit? Insbesondere für den Klimawandel, aber auch für Artenschwund, Verschmutzung der Weltmeere, Verlust der Regenwälder und so weiter?
Die ehrliche (und unbequeme) Antwort müsste lauten: Die Ursachen liegen in unserer gegenwärtigen Art zu konsumieren und an der dominierenden Wirtschafts- und Gesellschaftsform des Kapitalismus, der es privaten Unternehmern im Wettbewerb mit anderen ermöglicht, möglichst viele Waren herzustellen, neue Produkte zu erfinden und Profit einzufahren.
Diese Form des Wirtschaftens hat in einer stetig wachsenden Zahl von Ländern Wohlstand geschaffen. Dieser Wohlstand beruht aber bis dato auf der Extraktion natürlicher Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas. Wird die darin enthaltene Energie genutzt, fällt das Klimagas Kohlendioxid in einem Ausmaß an, das von den natürlichen Kreisläufen nicht mehr schadlos abgebaut werden kann. Es reichert sich in der Atmosphäre an, bremst die Wärmerückstrahlung der Erde ins All und verursacht den menschengemachten Klimawandel. Das sind die Kollateralschäden der Wohlstandsmehrung. Wohlstand ist, so der logische Schluss, schlecht fürs Klima.
Die Hauptverursacher der menschengemachten Klimaveränderung sitzen in den wohlhabenden Ländern. Dort wird der Löwenanteil aller globalen Güter konsumiert und dort wurden seit Beginn der Industrialisierung, kumuliert betrachtet, die meisten fossilen Brennstoffe verheizt. Dass die Reicheren umweltschädlicher sind als die Ärmeren, gilt nicht nur international, sondern auch innerhalb eines Landes: So ist der Treibhausgasausstoß der wohlhabendsten zehn Prozent in Deutschland sechsmal größer als bei der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Interessanterweise ist der Ressourcenverbrauch statistisch gesehen bei jenen sozialen Gruppen am höchsten, die am meisten Umweltbewusstsein und die beste Bildung aufweisen. Also in der gehobenen Mittelschicht mit guten Einkommen.
Einfach weniger konsumieren?
Die auf den ersten Blick naheliegende Konsequenz aus diesen Zusammenhängen wäre, den Konsum zu reduzieren, die Reichen zu enteignen und den Kapitalismus abzuschaffen. Aber das wird nicht funktionieren. Keine Gesellschaft wäre dazu bereit. Für die Politik wäre es, zumindest in halbwegs demokratischen Staaten, der Selbstmord. Denn die neue Bescheidenheit wäre Gift für die Volkswirtschaft. Weniger Konsum bedeutet Firmenpleiten, weniger Investitionen, Jobverluste, Arbeitslosigkeit und kollabierende staatliche Einnahmen. Ökonomen nennen das eine „Unterkonsumtionskrise“. Kaum anzunehmen, dass die Menschen sich dafür begeistern würden.
Ambitionierte Ziele – schlappe Umsetzung
Nun ist es nicht so, dass die meisten politisch Verantwortlichen nicht um die Gefahr der Umweltkrisen Bescheid wüssten und längst Besserung gelobt hätten. Lang ist die Liste der Absichtserklärungen, die von einem gewachsenen Umweltbewusstsein zeugen, von der UN-Biodiversitätskonvention bis zum Pariser Klima-Abkommen. Mit letzterem beschlossen vor einem Jahrzehnt 195 Unterzeichnerstaaten (und damit praktisch die gesamte Weltgemeinschaft) die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen.
Zwar haben seither viele Länder die Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut und einen internationalen Emissionshandel implementiert. Doch im Jahr 2025 ist der globale Treibhausgasausstoß abermals auf ein neues Rekordniveau gestiegen, weil viele Schwellenländer einen Entwicklungsaufholbedarf haben und auch weil sich Staaten wie die USA aus dem Paris-Abkommen verabschiedet haben und deren Präsident den menschengemachten Klimawandel als „Hoax“, als Schwindel, bezeichnet.
Deutschland auf Kurs, aber viel zu langsam
Deutschland, das sich gerne als Vorreiter im Klimaschutz präsentiert, hat seine Kohlendioxid-Emissionen gegenüber dem Referenzjahr 1990 um fast die Hälfte reduziert, unter anderem, weil Kohlekraftwerke stillgelegt und Wind- und Solarkraftwerke gebaut wurden. Aber ein guter Teil der Einsparungen während der letzten 35 Jahre erklärt sich durch den Zusammenbruch ineffizienter DDR-Industrieanlagen und aus der aktuellen Wirtschaftsschwäche. Damit hat Deutschland erst einmal die niedrig hängenden Früchte im Klimaschutz geerntet, also den einfachen Teil der Einsparungen erledigt.
Um das Ziel der Bundesregierung der Klimaneutralität, also Netto-Null-Emissionen im Jahr 2045 zu erreichen, verbleiben gerade mal 20 Jahre. In dieser Zeit müssten genauso viele Treibhausgase vermieden werden wie zwischen 1990 und 2025. Dass diese zweite Etappe deutlich schwieriger werden wird als die erste, sieht man nicht nur daran, dass sie deutlich kürzer ist als die erste, sondern auch daran, dass heute immer noch 79 Prozent der genutzten Primärenergie aus fossilen Quellen stammen. Und daran, dass die Emissionen im Jahr 2025 trotz lahmender Wirtschaft gegenüber Vorjahr praktisch nicht gesunken sind und immer noch bei geschätzten 570 Millionen Tonnen Kohlendioxid liegen.
Auch ein Land wie Finnland, das trotz der Lage im hohen Norden auf deutlich weniger Pro-Kopf-Emissionen als Deutschland kommt und das sich vorgenommen hat, schon bis 2035 klimaneutral zu werden, kommt dabei nicht wie geplant voran. In Russland steigen die Emissionen sogar, während sie in den USA kaum zurückgehen. Die aktuelle US-Regierung („Drill Baby Drill“) beteiligt sich nicht einmal mehr an den Klimaverhandlungen, hat die Emissionsminderungsziele der Vorgängerregierung gekippt, beschleunigt den Ausbau fossiler Kraftwerke und betrachtet die Klimaforschung als Geldverschwendung.
Auch deshalb hat die Weltgemeinschaft im Jahr 2024 erstmals das 1,5-Grad-Ziel gerissen. Offiziell gilt das Ziel zwar erst als verfehlt, wenn die 1,5 Grad im 20-jährigen Mittel überschritten werden. Aber das dürfte nach heutigen Stand ohnehin passieren: Selbst wenn alle Länder ihre laut Paris-Protokoll angekündigten Emissionseinsparungen umsetzen würden, stiege die globale Erwärmung bis zum Jahr 2100 auf 2,3 bis 2,5 Grad. Weil die Ankündigungen aber meist hinter der Umsetzung zurückbleiben, droht es um mindestens 2,8 Grad wärmer zu werden, mit katastrophalen Folgen für die meisten Weltregionen.
Der Planet und das Politische
Warum aber droht das Pariser Abkommen zu scheitern, das einst als großer Erfolg der internationalen Umweltdiplomatie feiert wurde? Dahinter stecke ein systemischer Denkfehler, wie es der Historiker Dipesh Chakrabarty von der Universität von Chicago in seiner Theorie der Unvereinbarkeit des Planetaren mit dem Politischen erklärt: Danach beruhen Klimawandel und all die anderen Umweltveränderungen auf menschlichem Aktivitäten. Indem der Mensch den Planeten nach seinen Vorstellungen gestaltet, beeinflusst er das Erdsystem mit seinen globalen Kohlenstoff-, Stickstoff- und Wasserströmen. Das ist dem Planeten zwar völlig egal, aber es verändert die irdischen Lebensbedingungen in einer Art und Weise, die den Menschen nicht egal sein können.
Das Problem ist, dass das Erdsystem eine untrennbare Einheit darstellt. Von den Treibhausgasemissionen ist der gesamte Planet betroffen, er reagiert als Gesamtheit, ganz egal aus welchen Quellen oder Ländern die Kohlendioxidmoleküle stammen. Die Menschheit aber, die sich im eigenen Interesse um ein möglichst stabiles und lebensfreundliches Erdsystem kümmern sollte, so Chakrabarty, tritt nicht als Einheit in Erscheinung. Sie hat höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie die verfügbaren Ressourcen ausbeutet und wie sie auf die erkennbaren Umweltveränderungen reagieren soll.
So haben ölfördernde Länder oder die Kohlelobby andere Prioritäten als die Menschen in Kiribati oder Bangladesch, denen das Wasser in einer wärmeren Welt bald schon bis zum Hals steht. Auf der letzten UN-Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém konnten Saudi-Arabien sowie andere arabische Länder und Russland gegen die Mehrheit der teilnehmenden Staaten einen verbindlichen Ausstiegsfahrplan für fossile Energie verhindern, mit dem Argument die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft seien zentral für ihre Staatshaushalte. Sie lassen sich ihr klimaschädliches Geschäftsmodell nicht verbieten. Die Menschheit ist sich also alles andere als einig, wie sie dem menschengemachten Klimawandel begegnen soll.
Klimaschutz, der nur international zu bewerkstelligen ist, wird also nicht einfacher, zumal er angesichts anderer Krisenherde, nicht mehr weit vorne auf der Sorgenliste der Menschen steht.
Koalition der Willigen
Das darf aber kein Grund sein, in Fatalismus zu verfallen oder aus lauter Verzweiflung die Vorhersagen der Klimaforschung zu ignorieren. Solange es nicht gelingt, international an einem Strang zu ziehen, ist es umso wichtiger, dass sich jene Länder, die den Klimaschutz ernst nehmen, in einer Koalition der Willigen zusammenschließen und Erfahrungen austauschen, wie sich die Emissionen am schnellsten reduzieren lassen.
Dabei sollten Bevölkerung und Politik besser als bisher zusammenarbeiten, denn beiden Parteien kommt eine große Verantwortung zu: Eine wirksame Klimapolitik erfordert technische, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen. Die meisten Menschen aber scheuen Veränderungen. Und Politiker scheuen sich, den Bürgerinnen und Bürgern allzu viele Veränderungen zuzumuten, weil sie wiedergewählt werden wollen. So aber versagen beide, Bevölkerung und Politik.
Persönliche Klimabilanz ziehen
Was aber wären die wichtigsten Aufgaben? Für jede und jeden Einzelnen wäre der erste Schritt, sich einen Überblick über den persönlichen Kohlendioxid-Ausstoß zu verschaffen. Das geht am besten und ganz einfach über den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ oder des WWF https://www.wwf.de/themen-projekte/klimaschutz/wwf-klimarechner. Das Ergebnis ist in der Regel ernüchternd. Ich selbst habe gerade Bilanz gezogen und liege mit knapp acht Tonnen CO2-Äquivalenten (bei den CO2-Äquivalenten werden auch die übrigen Treibhausgasemissionen mitberücksichtigt) im Jahr zwar unter dem deutschen Schnitt von gut zehn Tonnen, aber immer noch deutlich über dem, was klimaneutral wäre. Der Klimarechner zeigt aber auch, wo sich etwas einsparen lässt. Tipps dazu gibt es auf den gleichen Webseiten.
Dabei gilt generell, dass sich der eigene CO2-Fußabdruck zu etwa einem Drittel durch persönliche Verhaltensänderungen reduzieren lässt. Eine solche CO2-Diät bedeutet: Weniger ins Flugzeug steigen, ÖPNV oder Fahrrad statt PKW benutzen, keine überdimensionierten oder fossil betriebenen Autos fahren, keine Kreuzfahrtschiffe betreten, Plastik vermeiden, nur Dinge kaufen, die man wirklich braucht, regional und saisonal einkaufen, weniger Fleisch essen, den Zierrasen im Garten zu einem Gemüsebeet umrüsten und so weiter. Diese Tipps sind hinlänglich bekannt.
Auch wenn es sich bei den meisten einzelnen Einsparungen um geringe Prozentbeiträge handelt, in der Summe läppert es sich. Der Klimawandel wird nicht durch einen Geniestreich oder eine Patentlösung gestoppt, sondern durch tausende von Einzelleistungen von Milliarden von Menschen.
Klimaschutz braucht Ordnungsrecht
Individuelle Verhaltensänderungen sind allerdings kein Ersatz für die richtige Rahmensetzung durch die Politik. Sie hat die Aufgabe, ordnungsrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz zu machen und sie überzeugend an die Bevölkerung zu vermitteln. Sie ist für die restlichen zwei Drittel der CO2-Diät verantwortlich, denn viele Emissionen lassen sich auf persönlicher Ebene gar nicht vermeiden: Wo Busse und Bahnen nicht fahren, ist es schwierig ohne Auto zur Arbeit zu kommen. Die Ölheizung in der Mietwohnung kann ein Mieter nicht durch eine Wärmepumpe ersetzen. Und im Supermarkt oder bei Online-Händlern ist es nahezu unmöglich klimaneutral einzukaufen.
Wenn die Politik die für den Klimaschutz notwendigen verbindlichen Regeln, Gebote und Verbote erlässt, macht sie sich allerdings nicht nur Freunde. Viele Menschen betrachten solche Vorgaben als unzulässige Einschränkungen ihrer Freiheit. Politiker auch. CSU-Chef Söder etwa wettert regelmäßig gegen eine vermeintliche „grüne Gängelei“.
Derart Freiheitsbewusste vergessen dabei, dass eine Gesellschaft ohne Ordnungsrecht nicht funktionieren kann. Unser Alltag ist durch und durch gesetzlich geregelt, was wir kaum noch bemerken, weil Regeln in der Regel von Vorteil sind. Früher war es gang und gäbe, nicht angeschnallt Auto zu fahren, verbleites Benzin zu tanken oder zu rauchen, wo immer man es wollte. Als all dies irgendwann verboten wurde, gab es zwar bundesweites Gezeter, aber mittlerweile dürfte die Gesellschaft vom Segen der neuen Regeln überzeugt sein. Grenzen schränken zwar ein, aber sie ermöglichen auch neue Freiheiten. Wer einen Unfall überlebt, weil er angeschnallt war, kann sich über die Freiheit des Weiterlebens freuen. Und wer heute gezwungen wird, weniger Treibhausgase zu verursachen, kann sich darüber freuen, dass er oder sie die Lebensgrundlagen künftiger Generationen weniger gefährdet.
Deshalb braucht die Politik deutlich mehr Mut in Sachen Ordnungsrecht. Ideen dafür gibt es genug: Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen, über das sich außerhalb Deutschlands kaum jemand aufregt, würde Angaben des Umweltbundesamtes zufolge 2,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, das entspricht 6,6 Prozent der Emissionen auf Autobahnen. Ein Verbrenner-Aus bei PKW (wie ursprünglich geplant) würde die Treibhausgase im Verkehrssektor deutlich reduzieren. Ein gesetzlich festgelegter Termin für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas bringt die entsprechenden Emissionen auf null und macht den Alternativen zu den fossilen Quellen das Leben leichter. Das Verbot neuer Öl- und Gasheizungen in Gebäuden macht das Wohnen umweltfreundlicher.
Derartige Maßnahmen sind weithin bekannt. Sie politisch umzusetzen aber ist ein Riesenproblem, wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt. Damit dies trotzdem geschieht, muss die Gesellschaft der Politik zeigen, dass sie zu Veränderungen bereit ist. Sie muss klarmachen, dass sie sich von einer klugen Umweltpolitik lenken und einschränken lässt, dass sie akzeptiert, bestimmte Dinge nicht zu tun, obwohl diese möglich und verlockend sind. Zum Wohle der Umwelt und künftiger Generationen.
Das Ganze muss zügig geschehen, denn das Erdsystem wartet nicht, bis es die oder der Letzte kapiert hat. Die größte Aufgabe des 21. Jahrhunderts ist es vom Wissen zum Handeln zu kommen. Und zwar schnell. Politische Gemächlichkeit ist Gift fürs Klima.
22.12.2025
„Ihr Kinderlein kommet“ funktioniert nicht mehr
Weltweit sinken die Geburtenziffern - warum nur?
Früher war nicht nur mehr Lametta. Früher haben die Menschen auch mehr Nachwuchs in die Welt gesetzt. In den 1950er und 1960er Jahren bekamen die Frauen im weltweiten Schnitt fünf Kinder. Heute sind es nur noch 2,2.
2,1 Kinder pro Frau wären notwendig, um eine Bevölkerung mittelfristig nicht schrumpfen zu lassen. Heute leben zwei Drittel der Menschheit in Ländern, wo das nicht mehr der Fall ist. „Peak Global Population“, das Bevölkerungsmaximum der Menschheit, dürfte früher und auf niedrigerem Niveau erreicht werden als lange angenommen, vermutlich schon bald nach der Mitte des laufenden Jahrhunderts. Die Vereinten Nationen gingen in ihrer letzten Vorausschätzung noch davon aus, dass dies erst im Jahr 2084 bei 10,3 Milliarden Menschen der Fall sein würde.
Überall sinkt die Kinderfreudigkeit: In den armen, wenig entwickelten Ländern Afrikas und Westasiens genauso wie dort, wo lange Zeit noch etwa zwei Kinder je Frau die Normalität waren, in den USA, Frankreich, Irland oder Norwegen. Und wo die Fertilitätsrate bereits auf niedrigem Niveau liegt, in Südkorea, Japan, Italien oder in Deutschland, sinkt sie noch tiefer.
Der schleichende und allem Anschein nach unumkehrbare Schwund sorgt international für Besorgnis bis Panik. Der demografische Wandel bedeutet mehr Ältere und weniger Jüngere, weniger Menschen im Erwerbsleben, weniger Innovation, weniger Wirtschaftswachstum. Ob Europa, angesichts niedriger Kinderzahlen (und anhaltender Zuwanderung) damit die „zivilisatorische Auslöschung“ droht, wie die neue US-amerikanische Sicherheitsstrategie mutmaßt, darf allerdings bezweifelt werden.
Bei der notwendigen Anpassung an die demografische Zeitenwende sind die betroffenen Gesellschaften bisher allerdings wenig einfallsreich – siehe die aktuelle Rentendebatte in Deutschland. Den Wandel umzukehren funktioniert jedoch auch nicht: Die Bemühungen in Russland, der Türkei, China oder Japan, die jungen Menschen mit Geldgeschenken und nationalistischer Propaganda zu mehr Nachwuchs zu bewegen, zeigen bestenfalls kurzfristige Erfolge und verpuffen schnell. Erfahrungsgemäß nehmen die Paare die Prämien mit und ziehen einen ohnehin bestehenden Kinderwunsch lediglich vor.
Warum gehen die Kinderzahlen eigentlich zurück?
Wichtiger als all die aktionistischen pronatalistischen Bemühungen wäre zunächst einmal eine nüchterne Analyse, warum die Menschen in praktisch allen Weltregionen, Religionen und Gesellschaftsformen ihre Vermehrung einschränken.
Tatsächlich wünschen sich die meisten Menschen nach wie vor Kinder. Nur scheitern Wünsche bekanntlich hin und wieder an der Alltagsrealität. In Deutschland etwa geben Frauen an, sie hätten im Schnitt gerne 1,76 Kinder, bei Männern sind es 1,74. Daraus werden aktuell aber lediglich 1,35 Mädchen oder Jungen. Zunehmende Urbanisierung, bessere Bildung, mehr Geschlechtergerechtigkeit und wachsender Wohlstand gelten als Standarderklärungen für die Kindermüdigkeit. Manchmal fehlt der entsprechende Partner für eine Familiengründung. Lange Ausbildungszeiten, wirtschaftliche Unsicherheit und die Schwierigkeit, eine passende Wohnung zu finden, zögern sie hinaus. Oder die Karriere hat Vorrang vor dem Nachwuchs.
Es gibt also eine Vielzahl von Gründen, warum heutige Menschen weniger Kinder bekommen als ihre Vorfahren und deshalb ist es so schwierig politisch gegenzusteuern. Eine gute Familienpolitik könnte bestenfalls die Lücke zwischen der Zahl der gewünschten und der tatsächlichen Kinder schließen, aber das würde zum Beispiel in Deutschland auch nicht genügen, das Schrumpfen zu verhindern. Bislang hat es kein Land geschafft, die Kinderzahl wieder dauerhaft über 2,1 zu hieven und damit für einen Bevölkerungszuwachs zu sorgen.
Andere Versuche, neues Bevölkerungswachstum zu generieren, dürften ebenfalls scheitern. Etwa Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten oder Mittel zur Familienplanung aus dem Verkehr zu ziehen. Rumänien hat ersteres unter dem Diktator Ceausescu einst versucht. Daraufhin haben sich die Neugeborenenzahlen zwar kurzfristig verdoppelt, sanken dann aber wieder. Zusätzlich verstarben viele Frau an heimlichen und unsicheren Abtreibungen. Keine gute Demografiepolitik.
Auch die Appelle aus konservativen Kreisen, alte Familienwerte neu zu beleben, also Frauen raus aus dem Bildungs- und Berufsleben zurück an den Herd zu holen, auf dass sie sich besser um den Nachwuchs kümmern können, dürften keinen Erfolg haben. In der Realität führt die Abkehr von der traditionellen Rollenverteilung in armen, wenig entwickelten Ländern zu niedrigeren Geburtenziffern. In wohlhabenden Ländern ist es aber mittlerweile genau umgekehrt: Dort, wo mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern herrscht (etwa in skandinavischen Ländern oder in Frankreich) liegen die Geburtenziffern höher als dort, wo dies weniger der Fall ist (in Japan, Südkorea oder China). Dieser Befund zeigt, dass in weit entwickelten Ländern dort mehr Kinder zur Welt kommen, wo sich Frau und Mann eher auf Augenhöhe begegnen können.
Fehlt der Glaube an eine bessere Zukunft?
Letztlich stellt sich beim Thema Geburtenrückgang eine grundsätzliche Frage: Warum hatten die Menschen zu früheren Zeiten mehr Kinder, obwohl es ihnen schlechter ging? Warum bekommen die Menschen ausgerechnet heute so wenige Kinder, obwohl es ihnen besser geht als ihren Vorfahren? Immerhin erleben sie einen Wohlstand, eine Lebenserwartung und Bildungsmöglichkeiten wie keine Generation vor ihnen. Kinder würden also historisch gesehen in die beste aller Welten hineingeboren.
Dieses Geburtenparadox zu erklären ist schwierig. Dennoch hier ein Versuch: Zu früheren Zeiten waren die Lebensbedingungen zweifellos schwieriger als heute. Aber weil es den meisten Menschen vergleichsweise schlecht ging, hatten sie die Hoffnung, dass es vorwärts geht, dass es ihre Kinder einmal besser haben würden. Von vielen Problemen der Zukunft wussten sie noch gar nichts. Der Blick auf das Morgen versprach Besseres als der in die Gegenwart oder die Vergangenheit. Kinder haben von dieser Vorstellung profitiert, weil sie eine Investition in die Zukunft sind.
Heute jedoch sind die Menschen mit einer Vielzahl von diffusen Zukunftsszenarien konfrontiert, bei einer gleichzeitig viel höheren Informationsdichte: Politische Krisen häufen sich im In- und Ausland. Der Klimawandel ist bereits spürbar, die weiteren Aussichten sind deprimierend. Das Wirtschaftswachstum schwindet, während sich die Staatsschulden ausweiten. Nationalismen sind auf dem Vormarsch, während der internationale Zusammenhalt zerbröselt. Alles keine guten Aussichten für kommende Generationen. Der Glaube an die Zukunft ist nicht mehr das, was er einmal war.
Für die Politik bedeutet das gewaltige Aufgaben, die weit über eine moderne Familienpolitik oder Babyprämien hinausgehen. Wenn sie der Bevölkerung wieder Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft (und für mehr Nachwuchs) vermitteln will, muss sie die großen internationalen Krisen lösen. Zumindest müsste sie den Anspruch anmelden, sie lösen zu wollen, und sich erkennbar auf den Weg dazu machen. Sie müsste die Zukunft gestalten und nicht nur verwalten.
Das geht zwar nicht von heute auf morgen. Wäre aber einen Versuch wert.
15.12.2025
Weniger, älter und ärmer?
Die Politik sollte die Bevölkerungsentwicklung ernster nehmen
Bevölkerungsprojektionen haben einen Nachteil: Sie liegen oft falsch. Aber deshalb haben sie auch einen Vorteil: Weil die Statistiker stets verschiedene Varianten einer möglichen Entwicklung von Bevölkerungszahl und -zusammensetzung präsentieren, ist in der Regel auch eine richtige Version dabei.
Derartige Vorausschätzungen sind „Wenn-dann-Annahmen“. Sie sagen nicht, wie es kommen wird, sondern berechnen lediglich, wie sich eine Bevölkerung entwickelt, wenn sich unterschiedliche Annahmen zur Geburtenziffern, Lebenserwartung und Wanderungen bewahrheiten. Vereinfacht gesagt: Mehr als Daten dazu, ob die Menschen leben, sterben und umziehen, brauchen die Demografen nicht, um die Zukunft an die Wand malen zu können. Die dann eintritt oder nicht.
So beliebig solche Projektionsergebnisse klingen mögen, sie sind trotzdem sinnvoll: Sie weisen die Politik auf mögliche problematische Entwicklungen hin. Im Idealfall ergreift die Verwaltung dann Maßnahmen, um diese zumindest abzumildern: Sie kann mit einer wirksamen Familienpolitik dafür sorgen, dass die Menschen vielleicht wieder etwas mehr Kinder in die Welt setzen und damit dem Schrumpfen und der Alterung entgegenwirken. Sie kann die Zuwanderung gut organisieren, um den Verlust von Arbeitskräften zu kompensieren. Und sie kann die Bürgerinnen und Bürger ermutigen sich besser und präventiv um ihre eigene Gesundheit zu kümmern, um die Lebenserwartung zu erhöhen.
Große Spannbreite der Vorausschätzungen
Letzte Woche war es wieder einmal soweit: Das Statistische Bundesamt präsentierte seine 16. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung in einer Spannbreite von 27 Varianten. Demnach könnte die Gesamtbevölkerung Deutschlands von 83,6 Millionen im Jahr 2024 bis 2070 auf 86,5 Millionen wachsen – oder aber auf 63,9 Millionen schrumpfen. Die restlichen Ergebnisse liegen irgendwo dazwischen. Sollte die negative Extremvariante eintreten (Voraussetzung: niedrige Geburtenziffer, geringe Zuwanderung und kaum steigende Lebenserwartung), hätte das Land so wenige Bewohner wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das Bundesamt legt sich ausdrücklich nicht auf eine bestimmte Varianten als die wahrscheinlichste fest, denn die Experten können beim besten Willen nicht wissen, wie viele Kinder künftig geboren werden, wie lange die Menschen leben und wer so alles nach Deutschland ein- oder von dort auswandern wird. Doch in die Öffentlichkeit schafft es meist nur eine mittlere Variante, die von einer „moderaten“ Entwicklung von Geburten, Lebenserwartung und Zuwanderung ausgeht. Unter diesen Bedingungen würden im Jahr 2070 knapp 75 Millionen Menschen zwischen Rügen und Bodensee leben, rund neun Millionen weniger als heute.
Das wäre sie aber nur, wenn die Kinderzahl je Frau leicht ansteigen würde – wobei in den letzten Jahren genau das Gegenteil geschehen ist. Wenn die Lebenserwartung bis 2070 um etwa sechs Jahre anstiege – was nur zu erwarten ist, wenn die Gesundheitssysteme leistungsfähig bleiben und keine weitere Pandemie zuschlägt. Und wenn bis 2070 im Saldo 11,4 Millionen Menschen zuwandern würden. Sicher ist das alles nicht. Weitere Unsicherheitsfaktoren für die Bevölkerungsentwicklung sind unvorhersehbare Ereignisse, wie sie in der Vergangenheit recht häufig aufgetreten sind: die Covid-19-Pandemie oder die beiden Flüchtlingswellen infolge der Kriege in Syrien und der Ukraine.
Einiges wird ziemlich sicher geschehen
Mit höherer Wahrscheinlichkeit lassen sich indes politisch relevante Entwicklungen für die nähere Zukunft vorhersagen. Zum Beispiel, dass die Bevölkerung Deutschlands immer älter wird, was daran liegt, dass die kopfstarke Gruppe der Babyboomer langsam, aber sicher auf das Rentenalter zumarschiert, während ihr deutlich dünner besetzte jüngere Jahrgänge folgen. Als die meisten Boomer auf die Welt kamen, zählte das Land pro Jahr etwa doppelt so viele Neugeborene wie heute.
Dass damit eine gewaltige Verrentungswelle bevorsteht, ist schon seit Jahren bekannt, weshalb es verwundert, dass die Bundesregierung erst jetzt auf die Idee kommt, eine Kommission einzusetzen, deren Aufgabe es ist, zu erklären, wie ein reformiertes Rentensystem diese Alterung finanzieren soll. Genauso rätselhaft ist, dass bei der Gelegenheit nicht auch noch untersucht wird, wie Gesundheits- und Pflegesysteme anzupassen wären, denn auch dort wird die Alterung ihre Spuren hinterlassen: Immerhin lässt die demografische Entwicklung erwarten, dass es um das Jahr 2050 herum doppelt so viele 85-jährige Frauen geben wird wie zehnjährige Mädchen. Also viele Ältere, von denen einige auf Hilfe angewiesen sein werden, aber wenig Nachwuchs, der sich um die Hilfebedürftigen kümmern kann.
Schlussendlich bleibt auch unverständlich, weshalb keine Kommission darüber nachdenkt, wie sich die notwendigen Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren lassen, wenn die Babyboomer in hellen Scharen auf das Altenteil wechseln. Von alleine jedenfalls scheinen sie nicht kommen zu wollen. Schließlich hat Deutschland in den letzten Jahren an Attraktivität für Erwerbsmigranten verloren. Die klassischen Gastarbeiterländer wie Griechenland, Spanien oder Italien haben kaum noch Arbeitskräfte zu bieten. Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Bulgarien oder Polen zieht es mittlerweile zurück in ihre alte Heimat. Und potenzielle Zuwanderer aus Drittstaaten in Asien oder Afrika stoßen entweder auf gesellschaftliche Ablehnung oder auf bürokratische Hürden.
Wenn aber zusätzlich zu der absehbaren Alterung der Gesellschaft und einem Rückgang bei den Erwerbstätigenzahlen nur noch wenige helfende Hände und Köpfe aus dem Ausland zu uns kommen, dann wird sich der vertraute Wohlstand kaum erhalten lassen. Dann wird das Land ärmer.
So gibt es bei aller Unsicherheit über die künftige demografische Entwicklung klare Aufgaben für die Politik: Sie muss eine Familienpolitik organisieren, die dem Nachwuchs beste Bildungschancen garantiert und den potenziellen Familiengründern ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Letzteres ist angesichts der multiplen Krisen der Gegenwart keine leichte Aufgabe. Die Politik darf die finanziellen Lasten, die durch die Alterung der Gesellschaft entstehen, nicht überproportional den Jüngeren aufbürden. Und sie muss die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass Zuwanderung eine ökonomische Notwendigkeit ist und dass Mitbürgerinnen und Mitbürger aus anderen Ländern eine Bereicherung sein können, auch wenn sie künftig überwiegend aus Weltregionen stammen, aus denen heute eher Schutzsuchende kommen. Dummerweise tut die Politik all dies nicht.
26.11.2025
Die globalen Umweltprobleme werden größer
Wären da weniger Verursacher der Probleme hilfreich, also weniger Menschen?
Sie kennen sicher den Uraltwitz. Treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine: „Na Kollege, lange nicht gesehen, wie geht’s denn so“. Der andere (die Erde): „Och, nicht so gut. Ich hab‘ Homo sapiens“. Antwortet der Erste: „Mach dir keine Sorgen, das geht vorbei“.
Der Witz mag einen langen Bart haben, aber wie so oft bei Witzen hat er einen wahren Kern. Tatsächlich mutet die Spezies, die sich den Zunamen „der Weise“ gegeben hat, ihrem Heimatplaneten einiges zu: Treibhausgase in der Atmosphäre, geplünderte Süßwasserreserven, abgeholzte Tropenwälder, Gigatonnen von Plastik in den Weltmeeren und so weiter.
Dem irdischen Planeten dürfte das freilich ziemlich egal sein. Er hat ganz andere Katastrophen überstanden: Eiszeiten, in denen die Weltmeere bis fast in die Tropen zufroren, Heißzeiten, in denen die Kohlendioxidkonzentration in der Lufthülle zehnmal so hoch war wie heute, oder den Einschlag eines gewaltigen Asteroiden, der über der Hälfte aller damaligen Arten den Garaus machte, Saurier inklusive.
Was der Homo sapiens auf Erden anrichtet, ist ein Klacks dagegen. Er zerstört die Umwelt nicht, er verändert sie lediglich. Doch genau darin liegt das Problem. Die menschliche Zivilisation (mit all ihren positiven wie negativen Begleiterscheinungen) wurde überhaupt erst möglich, weil seit etwa 10.000 Jahren ökologisch weitgehend stabile Verhältnisse herrschen. Nur unter diesen ganz spezifischen Umweltbedingungen im Zeitalter des Holozäns konnte der Homo sapiens alles Mögliche erfinden, von Schriftzeichen über Laubbläser bis zu Flugtaxis, und sich auf über 8,3 Milliarden Exemplare vermehren. Jetzt allerdings treibt er aufgrund der Kollateralschäden seines Erfindergeistes in ein neues Zeitalter (das Anthropozän), das von hoher Instabilität gezeichnet ist und in dem menschliche Existenz nicht mehr wie gewohnt möglich sein wird.
Wissen heißt nicht Handeln
Interessanterweise kennt der Mensch die Ursachen wie auch die Folgen der selbst gemachten Umweltprobleme. Sie sind überall nachzulesen oder lassen sich von der KI erklären. Wer Öl und Kohle verbrennt, die Artenvielfalt dezimiert oder überall Kunststoffe hinterlässt, braucht sich nicht über Klimawandel, neue Krankheitserreger oder Mikroplastik im eigenen Körper zu wundern.
Ebenso bekannt sind die Möglichkeiten diese Probleme zu minimieren oder gar zu verhindern: Regenerative Energien nutzen, mindestens ein Drittel der irdischen Landmasse und der Ozeane unter Schutz stellen, Kunststoffe, wo möglich, vermeiden und dort, wo dies nicht gelingt, in Kreislaufsystemen wiederverwerten.
Der Haken an der Sache ist: Wir kriegen es nicht hin. Wir kommen nicht vom Wissen zum Handeln, bestenfalls hier und da auf individueller Ebene, aber nicht als Weltgemeinschaft. Siehe Ausgang der jüngsten Klimakonferenz in Brasilien. Derweil verschärfen sich die Probleme und sind immer schwieriger zu lösen. Vorerst ist der Homo sapiens ein Problem für sich selbst.
Hier kommt der zweite Teil des Planetenwitzes ins Spiel: Geht die Sache mit dem Homo sapiens womöglich von ganz alleine vorbei?
Blickt man auf die Vorausschätzungen der Demografen für die Weltbevölkerung, dann stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht. Allerdings dauert es noch eine Weile, bis sich der Mensch langsam zurückzieht, und ob er sich dann komplett von allem Irdischen verabschiedet, ist alles andere als ausgemacht.
Gipfel bald erreicht?
Nach wie vor wächst die Zahl der Menschen um etwa 80 Millionen im Jahr- und das unverändert seit über einem halben Jahrhundert. Dennoch scheint sich ein Ende des Wachstums anzukündigen: Irgendwann in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrhunderts, so schätzen Demografen, dürfte Schluss sein mit dem Aufstieg der Menschheit. Dann geht allem Anschein das Schrumpfen los – das erste Mal seit den Pestepidemien im 14. Jahrhundert.
Der Grund für die Annahme der Wissenschaft liegt in den weltweit rückläufigen Geburtenziffern. 2,1 Kinder müssten Frauen für eine mittelfristig stabile Weltbevölkerung bekommen. In den 1950er Jahren waren es noch knapp fünf, heute sind es nur noch 2,2. Über 130 Länder verzeichnen Geburtenziffern von unter 2,1. Im Jahr 2100, so die Erwartung, können nur noch sechs Länder Geburtenziffern von über 2,1 erwarten.
Zu den Ländern, in denen die Frauen weniger als 2,1 Kinder bekommen, zählen sämtliche Industrienationen mit der Ausnahme von Israel, aber auch viele Schwellenländer wie China, Indien, Indonesien, Türkei oder Brasilien. 25 Länder, darunter Griechenland und Polen, China und Japan, schrumpfen bereits. China dürfte den Prognosen zufolge bis 2100 rund 630 Millionen Einwohner verlieren, deutlich mehr, als heute in der EU leben. Nur in den wenig entwickelten Ländern, in Westasien, dem Nahen Osten und in Afrika südlich der Sahara, sind die Geburtenziffern immer noch hoch – aber ebenfalls auf dem Rückzug.
Die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen rechnet in ihrer mittleren Vorausschätzung mit einem Bevölkerungsmaximum von 10,3 Milliarden im Jahr 2084. Dabei gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die niedrigen Geburtenziffern vielerorts wieder Richtung 2,1 ansteigen, etwa in Südkorea, wo Frauen heute im Schnitt nur noch 0,75 Kinder bekommen, oder dass sie in den USA (1,6) nicht weiter fallen.
Für einen Trend zurück zu größeren Familien gibt es allerdings keinerlei Anzeichen. Im Gegenteil, auch Länder in Europa, die lange vergleichsweise hohe Kinderzahlen hatten, haben in den vergangenen Jahren einen Rückgang erlebt, etwa Frankreich (1,6), Dänemark (1,5) oder Schweden und Norwegen (1,4). Noch schneller sind die Geburtenziffern in Indien, der Türkei oder Nepal gefallen. Sollte es bei den niedrigen Werten bleiben, dürfte die Weltbevölkerung nur auf etwa neun Milliarden anwachsen und schon um das Jahr 2060 herum ihr Maximum erreichen.
Große Angst vor einem Bevölkerungskollaps
Aber ob weniger Menschen wirklich erstrebenswert sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Manch einer sieht unsere Spezies schon vor dem Kollaps und darin die eigentliche Katastrophe. Eine schrumpfende (und alternde) Bevölkerung bei wachsender Verschuldung, ein künftiges Szenario für viele Länder, gilt als Alptraum für Ökonomen und Politiker.
Ganz vorne dabei bei den Untergangspropheten: Der exzentrische Unternehmer Elon Musk, der die niedrige Geburtenrate für „das größte Risiko für die Zivilisation“ hält, größer jedenfalls als die globale Erwärmung durch den menschengemachten Treibhauseffekt. Die Erde sei nicht über-, sondern unterbevölkert, meint der Multimilliardär.
Er hat gut reden und wähnt sich auf der guten Seite. Er nennt 14 Kinder aus vier Beziehungen sein eigen (Gerüchte zufolge könnten es auch mehr sein), die zum Teil auf eigenwillige Namen wie X AE A-Xii, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus oder Seldon Lycurgus hören.
Versuche, die Menschen zu mehr Nachwuchs zu bewegen, sind mittlerweile weit verbreitet. Sie beruhen zum Teil auf schrägen Vorschlägen von Tech-Milliardären und empfehlen technische Lösungen wie das Einfrieren von Eizellen, um eine spätere Mutterschaft oder eine von Leihmüttern zu ermöglichen, oder die Entwicklung künstlicher Gebärmütter, die eine Geburt von Erdlingen (fast) ohne den körperlichen Einsatz von Menschen erlauben sollen.
Auch viele Regierungen ermutigen ihre Bürgerinnen und Bürger zum Kinderkriegen. Manche tun dies durch eine gute Kinderbetreuung, durch bezahlte Elternzeit oder Steuererleichterungen für Familien. Die Leistungen decken zwar nicht die Kosten für den Nachwuchs, aber es sind gute Investitionen, denn aus Kindern werden irgendwann Steuerzahler und Unterstützer der Sozialkassen.
Geld macht nicht mehr Kinder
Andere Länder versuchen es mit der Brechstange, beziehungsweise mit Geld: China, das vor nicht allzu langer Zeit drakonische Strafen für Paare, die mehr als ein Kind hatten, verhängt hat, zahlt mittlerweile für jedes Kind drei Jahre lang umgerechnet 440 Euro pro Jahr, in manchen Regionen auch Prämien für Neugeborene. Japan legt für eine Geburt etwa 3.000 Euro auf den Tisch der Eltern. Russland, das sich mit den Kriegstoten im Ukraine-Konflikt ein zusätzliches demografisches Problem eingehandelt hat, stellt ein „Mütterkapital“ bereit, eine Geldleistung, die für Wohnung, Ausbildung oder Altersversorgung verwendet werden kann. In manchen Gebieten Russlands zahlen die Behörden umgerechnet rund 1.000 Euro an Schulmädchen, wenn sie ein Kind bekommen. Ungarn wendet sage und schreibe sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf, um die Nachwuchszahlen zu erhöhen, mit Prämien aller Art (nur für heterosexuelle Paare mit hohen Einkommen), darunter eine lebenslange Einkommenssteuerbefreiung für Mütter mit mehr als drei Kindern.
All diese Anstrengungen mit Geldscheinen die Demografie aufzufrischen haben eins gemein: Sie funktionieren in der Regel nicht. Zwar gibt es nach Einführung der Zahlungen oft mehr Nachwuchs, der Effekt verpufft aber rasch. Menschen, die ohnehin Kinder bekommen wollten, ziehen ihren Entscheid lediglich vor, weil sie von den Leistungen profitieren wollen, solange diese verfügbar sind. Eine „pronatalistische“ Politik ändert erfahrungsgemäß nichts an den allgemeinen Wünschen eine Familie gründen zu wollen. Selbst in Ungarn, dem Land mit den weltweit höchsten Zahlungen, ist die Kinderzahl je Frau von 1,2 (im Jahr 2011) nach einem vorübergehenden Anstieg auf 1,6 mittlerweile schon wieder auf 1,4 gesunken.
Nach heutigem Stand der Wissenschaft ist der Rückgang der Geburtenziffern unter den Wert, der eine stabile Bevölkerung garantiert, irreversibel. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber in allen Ländern ähnlich: Mit steigendem Wohlstand, mit höherer Bildung und Erwerbstätigkeit von Frauen, mit einer wachsenden Urbanisierung, mit neuen Lebenszielen jenseits einer Familiengründung und der Verfügbarkeit von sicheren Verhütungsmitteln ist überall der Wunsch nach (vielen) Kindern zurückgegangen. Kurz gesagt bekommen die Menschen weniger Nachwuchs, weil es ihnen besser geht als zu früheren Zeiten.
Und das tun sie aus freien Stücken. Vielleicht spiegelt sich in dem Rückgang der Kinderzahlen und dem baldigen Ende des Bevölkerungswachstums ja eine unbewusste Gegenreaktion auf die für den Menschen bedrohlichen Umweltveränderungen. Dann müsste man dem Homo sapiens doch eine gewisse Weisheit zuschreiben.
19.11.2025
Lebenszeichen in Südamerika
Ecuadors Trump freundlicher Regierungschef wird von seiner eigenen Bevölkerung eingebremst
Ecuador gehört nicht gerade zu jenen Ländern, die sich in hiesigen Nachrichten weit nach vorne drängen. Doch das Ergebnis eines Referendums vom letzten Wochenende ist aller Aufmerksamkeit wert.
Der rechtskonservative, im April 2025 wiedergewählte Präsident Daniel Noboa hatte sein Volk am 16. November über vier Politikvorschläge abstimmen lassen, die seine Macht hätten festigen sollen. Die Ecuadorianer lehnten sie allesamt ab.
Einerseits ging es bei dem Referendum um die Wiedereinrichtung ausländischer Militärstützpunkte. Noboa wollte sein Land für US-Einheiten öffnen, offiziell zur Bekämpfung des Drogenhandels und zur Stärkung der inneren Sicherheit. Die ecuadorianische Verfassung verbietet es allerdings, ausländische Militärbasen einzurichten oder nationale Militärbasen ausländischen Kräften zu überlassen. Dabei bleibt es nun.
Weitere Fragen des Referendums waren die Abschaffung der öffentlichen Parteienfinanzierung und die Verringerung der Sitze im Parlament von 151 auf 73. Vorgeblich wollte der Präsident damit die Kosten der Regierungsarbeit senken. Kritiker vermuten allerdings, das Ganze sei nur ein Vorwand, um sich unliebsame Opposition vom Leib zu halten. Beide Vorschläge fielen durch.
Der vierte Punkt des Referendums war die Frage, ob die Regierung eine verfassunggebende Versammlung einberufen kann. Diese hätte die Rechte der indigenen Bevölkerung und der Natur über eine neue Verfassung einschränken können. Ecuador war das erste Land der Welt, das 2008 unter dem vorherigen Präsidenten Rafael Correa der Natur verfassungsmäßige Rechte eingeräumt hatte. Auch hier gab es klares Votum gegen Noboas Politik und für Grundrechte und Naturschutz.
Zum zweiten Mal gewählt wurde Noboa in Frühjahr 2025, weil sich die Bevölkerung von ihm eine Verbesserung der Verhältnisse versprochen hatte. Das Land zwischen Pazifikküste und Amazonasbecken, einst das sicherste und friedlichste der Region, steckt seit Jahren in einer schweren Krise. Die Bevölkerung zählt zu den ärmsten in Lateinamerika. Die Wirtschaftslage ist desolat, kriminelle Banden und Drogenkartelle terrorisieren das Land. Ecuador ist mittlerweile zu einem der weltweit wichtigsten Kokainumschlagplätze geworden. Die Mordrate ist rekordverdächtig hoch, Polizei, Militär und das Gerichtswesen sind von Korruption unterwandert.
Doch Präsident Naboa, der einer der reichsten Familien des Landes entstammt, nach US-Vorbild gerne mit Dekreten regiert und politische Opponenten schon mal als „Terroristen“ einstuft, nutzte seinen Wahlerfolg vor allem dazu, hart durchzugreifen. So hat er das Umweltministerium abgeschafft, dessen Aufgaben dem Ministerium für Energie und Bergbau unterstellt und in ein Ministerium für Umwelt und Energie umbenannt. Kontrolle der Umwelt und deren Ausbeutung liegen in dem rohstoffreichen Land fortan in einer Hand. Die Sorge ist groß, dass damit die Tür für die Erdöl- und Erzförderung in indigenen Gebieten, die eigentlich unter Schutz stehen, geöffnet wird, zumal auch das Ministerium für Menschenrechte aufgelöst wurde.
Das kleine Ecuador ist auf verschiedensten Lebensräumen mit einzigartiger Natur gesegnet, in der zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten leben, die nur dort vorkommen. An der Pazifikküste bieten dichte Mangrovenwälder Brutgebiete für Meeresschildkröten. Weiter östlich ragen die Anden über 3000 Meter empor, dort liegen verschiedene Nationalparks, in denen sich Bergnebelwälder ausbreiten, die wichtigsten Wasserspeicher des Landes und Heimat von Brillenbär und Andenkondor. Jenseits der Anden geht es hinab ins Amazonasgebiet, mit dem Yasuni Nationalpark, in dem auf einem einzigen Hektar mehr Baumarten wachsen als in ganz Nordamerika. Vielerorts in den Naturräumen siedeln indigene Völker, ihnen stehen besondere Rechte zu.
Doch tief vergraben im Erdreich unter Fauna und Flora finden sich große Vorkommen von Erdöl und Kupfererz sowie Gold-, Silber- und Molybdänvorräte, die längst ins Visier internationaler Bergbaukonzerne geraten sind. Konflikte zwischen Rohstoffausbeutung und Naturschutz sind programmiert. Dies war ursprünglich der Grund dafür, dass die Regierung der Natur 2008 verfassungsmäßige Rechte eingeräumt hat, dass indigene Gemeinden beim Abbau von Rohstoffen zu konsultieren sind und gerichtlich gegen Bergbauprojekte klagen können.
Vor allem im Amazonasgebiet wird bereits Erdöl gefördert, unter Belastung von Umwelt und indigenen Territorien. Die Öleinnahmen machen den wichtigsten Posten im ecuadorianischen Haushalt aus. Kupfererz soll die nächste große Einnahmequelle werden. Im ökologisch sensiblen Intag-Tal, im Nordwesten Ecuadors, konnten die Umweltschützer und lokale Initiativen bisher weitgehend verhindern, dass die Rohstofffirmen in den Regenwald vordringen, um Tagebau zu betreiben. Probebohrungen zufolge lagern dort mehrere Millionen Tonnen Kupfererz.
Doch dieser Erfolg für die Umwelt ist der aktuellen Regierung Ecuadors ein Dorn im Auge. Präsident Noboa hat der Zivilgesellschaft, die sich unter anderem für den Naturschutz und die Indigenen-Rechte einsetzt, den Kampf angesagt: Ein neues Geheimdienstgesetz verpflichtet öffentliche und private Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen auf Anfrage alle gewünschten Dokumente, etwa Telekommunikations- und Internetdaten oder Standortinformationen, zur Verfügung zu stellen, ohne dass dafür ein Gerichtsbeschluss nötig wäre. Der Geheimdienst muss nur die vage Vermutung äußern, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist, und kann damit jede Kommunikation abhören oder mitlesen. Kritiker sehen darin eine „totale Überwachungsmöglichkeit“ der Bevölkerung. Zusätzlich müssen sich sämtliche über 71.000 zivilgesellschaftlichen und Nichtregierungs-Organisationen (NGOs) oder Stiftungen innerhalb eines halben Jahres neu registrieren und dem Innenministerium ihre Finanzierungsquellen offenlegen, anderenfalls droht ihnen die Schließung.
Das bedeutet im besten Fall eine Einschüchterung und zusätzliche Bürokratiebelastung für die NGOs. Im schlimmsten Fall kann NGOs, deren Aktivitäten als „nicht im nationalen Interesse“ eingestuft werden oder die als Risiko für die „Staatssicherheit“ gelten, die Zulassung entzogen oder sie können mit Sanktionen belegt werden. Über 60 Leiter der wichtigsten NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden in einem einzigen Gerichtsverfahren der „ungerechtfertigten privaten Bereicherung“ beschuldigt und angeklagt. Die Mehrzahl der Angeklagten waren Vertreter indigener Gruppen, die sich gegen den Bergbau oder für den Schutz des Regenwaldes in ihren Lebensräumen eingesetzt hatten.
Noboas Politik erfuhr allerdings schon vor dem Referendum Gegenwehr. So hat das Verfassungsgericht Teile des Geheimdienstgesetzes vorläufig ausgesetzt und unterbunden, dass die Gelder von NGOs eingefroren wurden. Im September organisierte der Indigenenverband Conaie vor allem in den ländlichen Regionen Proteste und Blockaden gegen die Einrichtung einer verfassunggebenden Versammlung, aber auch gegen das Ende der Subventionen für Diesel, was den Preis für den Kraftstoff fast verdoppelt hatte. Polizeikräfte schlugen die Demonstrationen gewaltsam nieder, es gab drei Tote, zahlreiche Verletzte und Festnahmen. Amnesty International berichtete vom Verschwinden von 43 Personen, darunter mehrere Kinder, unter der Präsidentschaft von Noboa seit Oktober 2023.
Die Konflikte um eine großflächige Tagebau-Ausbeutung der Kupfervorkommen im Intag-Tal reichen bis in die frühen 1990er Jahren zurück. Damals begann Bishmetals, eine Tochterfirma des japanischen Mitsubishi-Konzerns mit ersten Explorationsbohrungen. Nach Protesten, organisiert von der NGO Decoin, zog sich der Konzern zurück. Später ersteigerten verschiedene Firmen Bergbaukonzessionen in dem Gebiet, mit der Folge, dass sich der Widerstand verstärkte. 2007 untersagte das Ministerium für Bergbau und Öl dem kanadischen Unternehmen Ascendant Copper alle Bergbautätigkeiten im Intag. Sieben Jahren später erteilte das Umweltministerium dem chilenischen Staatsunternehmen Codelco und dem ecuadorianischen Staatsunternehmen Enami erneut eine Abbaulizenz. Anhaltender lokaler Widerstand und Klagen sorgten dafür, dass das Provinzgericht von Imbabura 2023 die Lizenz wieder aufhob.
Zumindest vorübergehend ist der Kupferbergbau damit gestoppt. Das Ziel von Präsident Noboa war, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, NGOs zu schwächen und Bergbau- vor Umweltinteressen zu stellen. Die Bevölkerung Ecuadors hat sich jetzt in dem Referendum klar dagegen ausgesprochen.
27.10.2025
Nicht nachmachen!
Was Deutschland von dem Umgang der japanischen Regierung mit der demografischen Krise lernen kann
Erstmals in seiner Geschichte hat Japan mit Sanae Takaichi eine Ministerpräsidentin. Das klingt nach gesellschaftlichem Fortschritt, waren Politik und Wirtschaftsleben des Landes doch stets männerdominiert und eine Gleichstellung der Geschlechter eher ein Fremdwort. In dem „Gläserne-Decke-Index“ des britischen Magazins Economist, der anhand von zehn Kriterien vergleicht, wie gut sich Frauen gegenüber Männern im Berufsleben behaupten können, findet sich Japan auf Platz 27 der 29 OECD-Mitglieder.
Doch der erste Eindruck täuscht. Takaichi gilt als ultrakonservativ. Zwar möchte sie mehr Frauen in Regierungsfunktionen sehen, hält aber wenig davon Frauen im Berufsleben zu fördern, weil es der traditionellen Familie schade. Zudem macht sie sich für eine restriktive Zuwanderungspolitik stark.
Angesichts den demografischen Wandels ist beides keine gute Idee. Kaum ein Land der Welt altert und schrumpft so stark wie Japan. Japanerinnen bekommen im Schnitt nur noch 1,2 Kinder. 2,1 wären für eine mittelfristig stabile Bevölkerung notwendig. 2023 meldeten die Statistikbehörden weniger als 800.000 Geburten, 1974 waren es noch über zwei Millionen. Gleichzeitig liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei fast 85 Jahren. Etwa 100.000 Personen sind 100 Jahre und älter. Im Jahr 2050 dürften es über eine Million sein. Dann gibt es rund doppelt so viele über Hundertjährige wie Einjährige. Zu Mitte des Jahrhunderts werden den Prognosen zufolge jährlich dreimal mehr Menschen versterben, als Neugeborene hinzukommen.
Drei Millionen Einwohner hat Japan in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits verloren. Doch das ist erst der Anfang. Stand heute leben in Japan 123 Millionen Menschen. Das Nationale Institut für Bevölkerung und soziale Sicherheitsforschung geht in der mittleren Variante seiner Vorausberechnungen davon aus, dass es 2070 etwa 36 Millionen weniger sein werden. Dafür aber müssten die Geburtenziffern wieder steigen. Bleiben die Kinderzahlen je Frau auf dem derzeit niedrigen Niveau, könnte der Verlust sogar über 40 Millionen betragen.
Japan und Deutschland sind Pioniere des demografischen Wandels
Die Folgen dieses Wandels ähneln jenen in Deutschland, nur sind sie in Fernost dramatischer: Periphere ländliche Gebiete entleeren sich. Aufgrund der Alterung kommt es zu einem Mangel an Arbeitskräften, während die Kosten für Rente, Pflege und Krankenversorgung steigen. Weil es an Nachwuchs mangelt, sinkt die Innovationskraft des Landes, für die Japan lange berühmt war. Viele Unternehmen haben vor allem gegenüber der Konkurrenz aus China massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Warum aber ist die Geburtenziffer Japans noch niedriger als in Deutschland, obwohl die Regierung seit 1994 verschiedene staatliche Programme auf den Weg gebracht hat, um eine Familiengründung zu erleichtern? Zum einen sind Kinder teuer. Die Kosten für Wohnen, Kinderbetreuung und Bildung sind vor allem in den großen Städten, wo die meisten Menschen leben, extrem hoch. Die japanische Arbeitswelt bedeutet lange Arbeitszeiten. Vor allem von Männern wird oft erwartet, dass sie auch den Feierabend mit Kollegen in Kneipen verbringen. Männer beteiligen sich vergleichsweise wenig an der Haus- und Familienarbeit.
Die Vorstellung der japanischen Gesellschaft vom Familienleben ist nach wie vor traditionell und passt immer weniger zu dem Lebensbild junger Frauen, die häufig gut qualifiziert sind. Das führt dazu, dass sie immer seltener bereit sind, ihre Karriere für eine Familie zu opfern. Die Zahl der Eheschließungen sinkt. Und weil die Kombination „unverheiratet“ und „Kinder bekommen“ in Japan nach wie vor tabuisiert ist, bekommen ledige Frauen so gut wie keine Kinder. Nicht einmal drei Prozent aller Kinder in Japan kommen unehelich zur Welt. In Ländern mit vergleichsweise hoher Fertilität, wie Schweden oder Frankreich, sind es über 50 Prozent.
Japans neue Regierung will dem Nachwuchsmangel vor allem mit finanzieller Unterstützung für Familien entgegentreten, unter anderen mit Steuervergünstigungen. Unternehmen sollen gefördert werden, wenn sie eine Kinderbetreuung für ihre Beschäftigten organisieren. Schon unter der alten Regierung gab es eine Geburtenprämie in Höhe von umgerechnet rund 3.000 Euro. Daneben können die bis zu zweijährige Elternzeit auch Väter in Anspruch nehmen. Das tun allerdings nur 17 Prozent der Männer, meist für einen begrenzten Zeitraum, weil sie ansonsten Karrierenachteile befürchten.
Die Frage ist, ob diese familienpolitischen Anstrengungen Erfolg haben, solange sich die hohe Arbeitsbelastung im Job nicht reduziert und sich die Vorstellungen von Geschlechter- und Partnerschaftsrollen nicht grundlegend verändern. Doch danach sieht es nicht aus. Gesellschaftliche Normen ändern sich nur langsam, auch die neue Premierministerin Sanae Takaichi verspricht hier keinen Wandel. So weigert sie sich, ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert abzuschaffen, das verheiratete Paare verpflichtet, den gleichen Nachnamen (in der Regel den des Mannes) zu tragen. Auch ihr Versuch, nach skandinavischem Vorbild mehr Frauen in die Regierung zu holen, blieb in der Ankündigung stecken: In ihr 19-köpfiges Kabinett hat sie gerade mal zwei Frauen berufen.
Zuwanderung – lieber nicht
Alle weit entwickelten Industrienationen verzeichnen mehr oder weniger niedrige Geburtenziffern und eine alternde Erwerbsbevölkerung. Die allermeisten versuchen die damit verbundenen Probleme für den Arbeitsmarkt durch Zuwanderung abzufedern. Japan ist auch hier sehr restriktiv, was sich unter Takaichi nur wenig ändern dürfte. Alle Parteien und insbesondere die Gewerkschaften lehnen Zuwanderung ganz oder weitgehend ab. Typisch für diese Überzeugung sind die Worte des früheren Premierministers Jun’ichirō Koizumi: „Nur weil es einen Mangel an Arbeitskräften gibt, bedeutet das nicht automatisch, dass wir ausländischen Arbeitern erlauben sollten, ins Land zu kommen.“
In dem Land, in dem mehr als 30 Prozent der Einwohner über 65 Jahre alt sind, fehlt es vor allem an medizinischem Personal und Pflegekräften. Auch im Baugewerbe, in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Tourismussektor und der Gastronomie sowie der Forschung bleiben viele Stellen unbesetzt.
Insgesamt leben in Japan lediglich drei Millionen Ausländer, das sind gerade mal 2,3 Prozent der Bevölkerung. Da nur sehr wenige Ausländer einen japanischen Pass beantragen können (2023 gab es gerade mal 8.800 Einbürgerungen), liegt der Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund kaum höher. Zum Vergleich: In Deutschland haben etwa 30 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger einen Migrationshintergrund, sie sind also Ausländer oder mindestens ein Elternteil wurde mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit geboren.
Die neue Regierung hat eine klare Vorstellung von der künftigen Zuwanderungs- und Ausländerpolitik. Sanae Takaichi streitet zwar nicht ab, dass Japan aufgrund des Fachkräftemangels auf Zuwanderung angewiesen ist. Diese habe aber in einer „gesellschaftlich geordneten Koexistenz“ mit der einheimischen Bevölkerung zu erfolgen. Mit anderen Worten: Die Regierung will die absolute Kontrolle behalten, wer ins Land kommt und wie lange sie oder er dort bleibt. Integration bedeutet eine komplette Anpassung an die japanische Lebensweise. Aber gute Integration macht Zugewanderte noch lange nicht zu Japanern.
Die dringend notwendigen Arbeitskräfte holt Japan im Wesentlichen über ein Trainee- und ein Arbeitsvisa-Programm ins Land. Trainees oder Praktikanten stammen in der Regel aus ärmeren asiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien, China, Nepal oder Bangladesch. Nach offizieller Lesart sollen sie in Japan praktische Fähigkeiten erlangen, um dann in den Ländern ihrer Herkunft zur wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Tatsächlich aber landen sie meist als billige Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, der Fischerei, der Altenbetreuung oder in der Textilindustrie. Nach spätestens fünf Jahren müssen diese „Praktikanten“ Japan wieder verlassen. Organisationen wie Human Rights Watch haben dieses System immer wieder als Ausbeutung kritisiert.
Die neue Regierung möchte dieses System ab 2027 durch das Employment for Skill Development Programme ersetzen. Es soll den ausländischen Arbeitskräften bessere Karrierechancen bieten, aber wie schon das Trainee-Programm vor allem den Arbeitskräftemangel in ausgesuchten Branchen beheben und Japans Image im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte verbessern. Auch dieses Personal darf erst einmal nur für drei Jahre im Land bleiben.
Bei guter Ausbildung und ausreichenden japanischen Sprachkenntnissen können die Kräfte fünf Jahre bleiben, für die ganze Zeit bleibt jedoch der Familiennachzug untersagt. Dieser wird erst möglich, wenn die Ausländer in ausgewählten Branchen wie dem Schiffbau tätig sind, sich weiter qualifizieren und es schaffen, in den Status der „Specific Skilled Worker (Type 2)“ aufzusteigen und damit auch dauerhaft in Japan bleiben dürfen. Etwas leichter haben es Akademiker und IT-Fachkräfte, die über „Highly Skilled Professional Visa“ ins Land kommen können.
All diese Hürden haben einen Zweck: Es soll nicht der Eindruck entstehen, die Programme eröffneten einen Weg zur Einwanderung. Temporäre Migranten sollen gar nicht erst auf die Idee kommen, in Japan eine neue Heimat zu finden und Japaner zu werden. Es gilt nach wie vor das Diktum aller bisherigen japanischen Regierungen: Japan ist kein Einwanderungsland und hat dementsprechend auch keine Einwanderungspolitik. Das Land legt großen Wert auf eine ethnische Homogenität und betrachtet Einwanderung als Bedrohung der Einheit und der öffentlichen Ordnung.
Man könnte diese Politik als xenophob bezeichnen. Problematisch ist sie, weil sie der Öffentlichkeit suggeriert, Einwanderung sei nicht nötig. Tatsächlich aber lassen die Reformen der letzten Jahre in geringem Maße Einwanderung durch die Hintertür zu, auch wenn sie nicht so heißen darf. Die gegenüber Ausländern tendenziell skeptische Bevölkerung wird also überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass die Zahlen der ausländischen Arbeitskräfte wegen des demografischen Wandels notgedrungen steigen werden. Die Lücke zwischen politischem Anspruch und Realität wächst weiter.
Ein weiteres Problem ist, dass bei den Programmen Integration nicht auf dem Plan steht. Das dürfte ähnliche Folgen haben wie bei der deutschen Gastarbeitermigration von 1955 bis 1973. Auch dabei war ursprünglich geplant, dass die „Gäste“ nach getaner Arbeit Deutschland wieder verlassen. Viele haben das aber nicht getan. Sie und ihre Nachfahren wie auch das ganze Land leiden bis heute darunter, dass Integration lange kein Thema war.
Der demografische Wandel ist ein internationales Phänomen, dem sich letztlich kein Land entziehen kann. Er bedeutet große Herausforderungen, die zu Problemen werden, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und angepackt werden. Deutschland hat das bislang bestenfalls mittelmäßig gemacht. Aber deutlich besser als Japan. Von Japan lernen heißt: nicht die gleichen Fehler machen.
06.06.2025
Wer macht eigentlich in Zukunft die Arbeit?
Ohne Zuwanderung droht der Wirtschaft Ungemach
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt unternimmt derzeit große Anstrengungen ein Wahlkampfversprechen einzulösen und die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Die AfD im Nacken und die Probleme der irregulären Zuwanderung vor Augen, mag es für den CSU-Politiker dafür gute Gründe geben.
Dummerweise gerät dabei eine vermutlich wichtigere Frage in den Hintergrund: Wie lässt sich die Zuwanderung nach Deutschland gezielt erhöhen? Denn ohne eine verstärkte Migration von Menschen aus anderen Ländern ist die hiesige Volkswirtschaft angesichts des demografischen Wandels kaum am Laufen zu halten. Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier beispielsweise sieht in dem anschwellenden Fachkräftemangel „das Haupthemmnis für Wirtschaftswachstum in Deutschland“.
Steigende Lebenserwartung und sinkende Geburtenziffern lassen die Bevölkerungen in praktisch allen Ländern der Welt altern. In über 100 Staaten sind die Kinderzahlen je Frau bereits unter den Wert von 2,1 gefallen, bei dem eine Bevölkerung mittelfristig aufhört zu wachsen, solange es keine Zuwanderung gibt. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen, in den USA und Kanada, in China, Japan, Südkorea sowie in Europa wird die Zahl der Menschen im typischen Erwerbsalter bis 2050 um 360 Millionen schrumpfen. Schwellenländer wie Brasilien, Vietnam, Bangladesch oder die Türkei werden diesem Trend demnächst folgen. Überall werden dann Arbeitskräfte fehlen. Um Zuwanderer wird ein internationaler Wettbewerb entbrennen. Wer heute eine migrationsfeindliche und wenig integrative Politik betreibt, dürfte bald schon zu den Verlierern gehören.
Pionier im demografischen Wandel
Deutschland ist nicht nur Vorreiter im demografischen Wandel, es hat auch eine lange Erfahrung mit Zuwanderung. Seit 1972 versterben hierzulande (Ost und West zusammengerechnet) in jedem Jahr mehr Menschen, als Kinder zur Welt kommen. Ohne Zuwanderung hätte die Einwohnerzahl längst schrumpfen müssen – von 72 Millionen Einwohnern im Jahr 1972 auf mittlerweile ungefähr 55 Millionen. Tatsächlich aber leben heute zwischen Rügen und dem Bodensee gut 84 Millionen Menschen, darunter 21 Millionen mit Migrationsgeschichte, also Personen, die entweder direkt zugewandert sind oder deren beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland in seinen heutigen Grenzen eingewandert sind. Sie machen rund ein Viertel der Gesellschaft aus.
Ein Deutschland ohne Zuwanderung, von dem manch ein Bürger oder eine Bürgerin träumen mag, wäre ein völlig anderes Land, eine Art Altersheim mit völkischer Identität. Es gäbe mehr Parkplätze, weniger Staus, aber auch weniger Arbeitskräfte und einen deutlich höheren Anteil von Ruheständlern. Die Wirtschaft wäre weniger innovativ und weniger produktiv, der Wohlstand geringer.
Der seit 1972 anhaltende Überschuss der Sterbefälle über die Geburten weitet sich seit Jahren aus. Lag er 2000 noch bei 72.000, waren es 2024 bereits 330.000. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass es 2055 etwa 540.000 mehr Todesfälle als Geburten geben wird, denn bis dahin werden die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer auf ihre letzte Reise gehen, während die Geburtenziffer kaum wesentlich steigen dürfte. Sie liegt seit einem halben Jahrhundert mehr oder weniger zementiert bei etwa 1,4 Kindern je Frau.
Allein um die Bevölkerung Deutschlands stabil zu halten, wäre also eine verstärkte Zuwanderung nötig. Eine stabile Einwohnerzahl ist allerdings kein Wert an sich. Viel wichtiger ist die Zuwanderung für den Arbeitsmarkt, denn im Jahr 2030, in gerade einmal fünf Jahren, steht der Höhepunkt der Babyboomer-Verrentungswelle an: Dann wird (bei gleichbleibendem Renteneintrittsalter) der Jahrgang, der sich aus dem Berufsleben verabschiedet, doppelt so groß sein, wie jener Jahrgang, der von unten her in den Arbeitsmarkt hineinwächst.
Was das für den Fachkräftemangel, der schon heute Branchen wie Pflege, Medizin oder Bauwirtschaft zusetzt, bedeutet, lässt sich an fünf Fingern abzählen. Insgesamt geht das Statistische Bundesamt in seiner mittleren Variante davon aus, dass trotz einer jährlichen Nettozuwanderung von 290.000 Personen die Zahl der Menschen im Erwerbsalter von 20 bis 66 Jahren um 3,4 Millionen sinken wird – bei einem gleichzeitigen Zuwachs an Ruheständlern, die eine Versorgung über die Sozialversicherung erwarten.
Arbeitskräftemangel – nicht nur auf dem Bau und in der Seelsorge
Damit stellt sich die zentrale Frage: Wer macht eigentlich in Zukunft die Arbeit? Wer biegt die Armierungseisen und schüttet die Betonfundamente, wer installiert Heizungen und Klimaanlagen, wer pflegt Oma, woher kommt der Nachwuchs in der Technik- und IT-Branche und wer kümmert sich um die Seelsorge in der katholischen Kirche? Denn auch dort herrscht längst Priestermangel. In den Bistümern Osnabrück und Hildesheim etwa stammt bereits ein Drittel der Geistlichen aus dem Ausland, hauptsächlich aus Indien und Polen.
Einer Studie zur Bauwirtschaft aus dem Jahr 2024 zufolge stuften 53 Prozent der befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als „sehr großes Problem“ ein. Oftmals harte und körperlich fordernde Arbeitsbedingungen bei mäßiger Bezahlung machen den Job auf der Baustelle für junge Berufseinsteiger nur begrenzt attraktiv. Schon lange ist die Branche deshalb auf ausländische Kräfte angewiesen. Die kamen zunächst aus Gastarbeiterländern wie Italien und Griechenland (die inzwischen selbst mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben) oder aus der Türkei. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs standen polnische Kräfte in großen Zahlen zur Verfügung, aber unser Nachbarland hat mittlerweile eine ähnliche demografische Entwicklung wie wir und kann kaum noch Bauarbeiter entbehren. Auch Bulgarien oder Rumänien fallen als Reservoir langsam aus, denn Abwanderung und sehr niedrige Geburtenziffern haben ganz Osteuropa in die demografische Krise getrieben.
Die klassischen Herkunftsländer für Zuwanderung haben kaum noch was zu bieten
Zuwanderung aus Nicht-EU-, also sogenannten Drittstaaten wäre die nächstbeste Lösung. Aber die ist nach wie vor durch bürokratische Hemmnisse erschwert – und inzwischen auch durch die Migrationspolitik der neuen Bundesregierung. Ohnehin garantieren auch Drittstaaten längst nicht mehr einen unerschöpflichen Nachschub an potenziellen Arbeitskräften: In China schrumpft die Bevölkerung seit einigen Jahren. Bis 2050 dürften dem Land rund 160 Millionen Einwohner verloren gehen, was etwa der kompletten Einwohnerschaft von Frankreich und Deutschland entspricht. Selbst Indien, heute das bevölkerungsreichste Land der Welt, vermeldet inzwischen eine Geburtenziffer von unter zwei Kindern je Frau und liegt damit mittelfristig auf Schrumpfkurs. Zwar ist die indische Bevölkerung noch relativ jung und es herrscht nach wie vor ein Überangebot an qualifizierten Arbeitskräften. Die zieht es bislang aber eher in englischsprachige Länder wie Kanada oder Australien, die den Arbeitsmigranten zudem weniger Hürden in den Weg stellen als Deutschland.
So bleiben auf längere Sicht nur Länder wie Afghanistan, Pakistan oder der Nahe Osten mit Iran, Irak oder Syrien als sichere Quelle für Zuwanderung. Dort ist die Zahl der jungen Menschen noch hoch und viele von ihnen suchen händeringend nach Jobs. Aber genau gegen diese potenziellen Zuwanderer schottet sich die Bundesregierung zusehends ab.
Das gilt erst Recht für die afrikanischen Länder Afrika südlich der Sahara. Zuwanderer von dort rangieren meist unter Flüchtlingen, Asylsuchenden oder irregulären Migranten, gehören also nicht zu der Gruppe derjenigen, von denen sich der Arbeitsmarkt bis heute eine wirkliche Bereicherung verspricht. Aber Subsahara-Afrika ist die einzige Weltregion, in der die Bevölkerung im Erwerbsalter noch stark wächst. Sie wird sich bis 2050 fast verdoppeln, auf dann 700 Millionen. 2030 wird die Hälfte der Menschen, die in den globalen Arbeitsmarkt hineinwächst, aus Subsahara-Afrika stammen.
Europa braucht Arbeitskräfte – Afrika braucht Jobs
Von den dortigen Berufseinsteigern kann allerdings nur ein Fünftel hoffen, im eigenen Land einen formellen Arbeitsplatz zu ergattern. Für den Rest bleiben bestenfalls schlecht bezahlte, informelle Jobs ohne jede soziale Absicherung. Da ist es kein Wunder, dass Umfragen zufolge fast die Hälfte der Afrikanerinnen und Afrikaner im arbeitsfähigen Alter zumindest erwägt, auf der Suche nach einer besseren Existenz auszuwandern. Viele von ihnen haben berufliche Fähigkeiten, die in Europa oder den USA nachgefragt sind. Aber gerade gegen diese potenziellen Migranten gibt es international wachsende Vorbehalte: So hat US-Präsident Trump das „Diversity-Visa-Programm“ gestoppt, mit dem zuvor unter anderem junge Menschen aus Afrika in die Vereinigten Staaten einreisen konnten. Die EU investiert Milliarden Euro, um Migranten aus Afrika zu stoppen und zurückzuschicken. Großbritannien plant nach wie vor unerwünschte Migranten nach Ruanda zu deportieren, könnte aber die Gesundheitsversorgung im eigenen Land ohne medizinisches und Pflegepersonal aus Afrika gar nicht mehr aufrechterhalten.
Wie aber ließe sich der wachsende Bedarf an Arbeitskräften in den reichen Ländern, also auch in Deutschland, mit dem enormen Angebot an Arbeitssuchenden im armen Teil Afrikas zum Nutzen beider Seiten ausgleichen?
Zum einen müssen für Migrantinnen und Migranten aus Afrika mit Ziel EU legale und gesteuerte Wege gefunden werden, um die gefährlichen und irregulären Migrationsrouten auszutrocknen. Dazu sind reguläre Arbeitsvisa für die Branchen auszugeben, in denen Arbeitskräftemangel besteht. Qualifikationsnachweise sind an die Bedingungen in den Herkunftsländern anzupassen, denn nicht überall erfolgt eine Ausbildung nach dem Standard deutscher Handwerkskammern. Eine Nachqualifikation erfolgt ohnehin besser dort, wo die Fachkräfte zum Einsatz kommen sollen.
Zweitens lassen sich potenzielle Migranten schon in ihrer Heimat fit machen für den Arbeitsmarkt in der Ferne. Ausbildungspartnerschaften mit Unternehmen aus der EU können junge Menschen in Kenia oder Senegal auf einen Job in Europa vorbereiten, begleitet von Sprachkursen für das Land, in das sie einmal auswandern wollen. Kooperationsprojekte mit afrikanischen Universitäten können jungen Akademikern Chancen auf eine Beschäftigung im Ausland bieten. Die Furcht vor einem Brain Drain ist dabei meist unbegründet, denn in der Regel kehrt ein Teil der qualifizierten, abgewanderten Arbeitskräfte nach ein paar Jahren wieder in die Heimat zurück, mit wichtigen Erfahrungen und Kapital für eine mögliche Unternehmensgründung. Das Ergebnis wäre eine zirkuläre Migration, von der beide Seiten profitieren.
Schlussendlich wäre es notwendig, die gesellschaftliche und politische Akzeptanz für Migration auch aus Afrika zu erhöhen. Nicht nur, weil das demografische Ungleichgewicht zwischen dem alten Europa und dem jungen Afrika zwangsläufig dazu führen wird, dass Europa „afrikanischer“ wird. Sondern vor allem, weil die Zuwanderung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Europas sichern kann. Beispiele für den beruflichen Erfolg von Menschen aus afrikanischen Ländern gibt es zuhauf – und zwar längst nicht nur in den Mannschaften der Fußball-Bundesliga. Diese positiven Beispiele zu verbreiten dürfte auf lange Sicht mehr Erfolg versprechen, als mit Zurückweisungen an der Grenze am rechten Rand Punkte zu sammeln.
21.02.2025
Demokratien vor dem Ende?
Wie Wirtschaftskrisen den Populismus befördern – und umgekehrt
Eines der wichtigeren Themen im gerade auslaufenden Bundestags-Wahlkampf war der Zustand der deutschen Wirtschaft. Beziehungsweise die Frage, was sich gegen die anhaltende Wachstumsschwäche unternehmen ließe. Die Frage ist keineswegs trivial, denn ohne das Wachstum einer Volkswirtschaft gehen Jobs verloren, Unternehmen können weniger investieren und es fehlt dem Staat an Steuereinnahmen. Und das zu einer Zeit, in der die Verteidigungsausgaben in die Höhe schießen, die Alterung der Gesellschaft enorme Kosten für Renten- und Gesundheitssysteme verursacht, Brücken, Straßen und Bahnlinien auf eine Sanierung warten, die Energiewende finanziert werden will, der Klimawandel gebremst und deutlich mehr in die Bildung investiert werden müsste und so weiter und so fort.
Nicht alle dieser Herausforderungen haben es in den Wahlkampf geschafft, ein Zeichen dafür, dass die Parteien kaum überzeugende Lösungen für die anstehenden Aufgaben parat hatten, zumindest keine, die sie den Wählerinnen und Wählern zumuten wollten. Und schon gar nicht ging es um eine zentrale Frage unserer Zeit, mit der die ermüdenden TV-Diskussionsrunden sicher an Gehalt gewonnen hätten: Können Demokratien mit wenig oder ohne Wirtschaftswachstum stabil bleiben? Bedeutet ein Ausklingen des Wirtschaftswachstums, das sich in einigen weit entwickelten Staaten andeutet, auch ein Ende der Demokratie?
Wohlstand und Demokratie sind häufig Geschwister
Historisch betrachtet gingen wirtschaftlicher Aufschwung und das Entstehen von Demokratien lange Hand in Hand. Zwar führt wachsender Wohlstand nicht automatisch zu einer demokratischen Entwicklung, insbesondere, wenn autoritäre Regime die Kontrolle behalten und politische Gegner unterdrücken. Jedoch sind fast alle wohlhabenden Länder demokratisch verfasst, während ärmere häufig autoritär regiert werden. Doch was ist hierbei Ursache und was die Wirkung? Bilden demokratische Strukturen die Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung eines Landes? Oder muss es den Menschen erst einmal wirtschaftlich besser gehen, bis sich eine demokratische Gesellschaft entwickeln kann?
Der 2006 verstorbene US-amerikanische Soziologe Seymour Martin Lipset kam in seinen Studien Ende der 1950 Jahre zu dem Schluss, dass sich in armen Gesellschaften, in denen nur wenige zu Reichtum kommen, keine Mehrheiten herausbilden können, die sich am politischen Leben beteiligen. Erst mit höheren Einkommen für breitere Bevölkerungskreise, mit Industrialisierung, besserer Bildung und Urbanisierung konnten sich Demokratien den Weg bahnen. Eine besser gebildete und finanziell abgesicherte Bevölkerung ist eher in der Lage, informierte Entscheidungen zu treffen, zu wählen, sich für die Gemeinschaft zu engagieren und sich an politischen Prozessen zu beteiligen.
Sobald der Wohlstand in die Breite getragen wurde, konnten sich mehr Menschen erst einfache, dann teurere Konsumgüter leisten, Kühlschränke, Waschmaschinen oder Autos. Der Konsum wiederum kurbelte die Wirtschaft an, mehr Menschen kamen zu noch mehr Wohlstand, das wachsende Bruttoinlandsprodukt bescherte dem Staat höhere Einnahmen, die er als Leistungen an die Bevölkerung zurückgeben konnte. In demokratischen Staaten konnten sich die Menschen wirtschaftlich frei entfalten und die Früchte ihrer Arbeit ernten. In Demokratien hatten viele Menschen ein Mitspracherecht. Die Staaten sorgten ihrerseits für einen funktionierenden Rechtsstaat, gesicherte Eigentumsrechte und Planungssicherheit. Dank steigender Einnahmen konnten sie leistungsfähige Sozialsysteme aufbauen, die Jung und Alt gegen verschiedene Lebensrisiken absicherten. Die überwiegende Mehrheit war zufrieden, die wachsende Wirtschaft stabilisierte die Demokratie – und umgekehrt.
Erwartungen, die nicht mehr erfüllt werden können
Dieses seit Jahrzehnten funktionierende System schuf allerdings die Erwartung, dass es auf immer und ewig so weitergeht mit Wachstum, Wohlstand und demokratischen Verhältnissen. Doch was passiert, wenn sich das Wirtschaftswachstum weder mehren noch halten lässt, wie in einem Land, das seit ein paar Jahren in der Rezession steckt?
Schon Lipset sah im Wirtschaftswachstum den Garanten dafür, dass Demokratien stabil bleiben. Solange es den Menschen immer besser geht, halten sie tendenziell am bestehenden politischen System fest. Das Gegenteil, nämlich Stagnation, wachsende Arbeitslosigkeit, erodierende Einkommensmöglichkeiten, steigende Lebenshaltungskosten und überlastete Sozialsysteme haben die meisten Demokratien noch nicht über längere Zeiträume erlebt. Unter anderem, weil die Regierungen rezessionsbedingte Probleme mit Subventionen und zusätzlichen Sozialleistungen unter Aufnahme von Schulden kaschieren konnten. Genau dies dürfte künftig schwerer werden, allein schon, weil der demografische Wandel die Kosten für die alternde Bevölkerung in die Höhe treibt. Die finanziellen Spielräume der Staaten sind geschrumpft und sie werden weiter zurückgehen. Die demokratiefördernde (und damit auch wirtschaftsfördernde) Umverteilung wird immer schwieriger.
Kaum verwunderlich, dass das Vertrauen in das politische System der Demokratie geschwunden ist. Längst bröckelt es an den Rändern: Sobald größere Kreise der Bevölkerung Einbußen erleiden oder zumindest das Gefühl haben, dies könnte bald geschehen, wenden sie sich neuen politischen Kräften zu, die eine Rückkehr zu jenen Zeiten versprechen, als Wohlstandszuwächse noch selbstverständlich waren.
Genau das lässt sich seit Jahren beobachten, in den USA wie in Deutschland, in Italien und Österreich, in Frankreich oder sogar in der reichen Schweiz. Das helvetische Beispiel zeigt, dass allein die Befürchtung, es könne nicht so weitergehen wie gewohnt, kombiniert mit der Propaganda der Populisten, die gleich noch die vermeintlich Schuldigen für den Niedergang benennt, ausreicht, um Zweifel an der Demokratie und den etablierten Parteien zu nähren.
Bislang ist ungeklärt, welche Chance Demokratien haben, wenn ihr die Grundlagen, die zu ihrer Entstehung und Stabilisierung geführt haben, verloren gehen. In allen demokratischen Industriestaaten und mittlerweile auch in den Schwellenländern, die bestenfalls auf dem Weg zu einer Demokratie sind, hat sich das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten verlangsamt. Die Länder sind abhängig von einem Wirtschaftswachstum, das sich offensichtlich gar nicht mehr realisieren lässt. Das ist eine Zeitenwende, die Demokratien vor eine Überlebensfrage stellt. Demokratien müssten auf demokratische Weise neu verhandelt werden. Darauf sind sie schlecht vorbereitet.
Wenn das kein Thema für den Wahlkampf gewesen wäre.
14.01.2025
Doppelt in der Kreide
Das Problem wachsender Schulden – an den Finanzmärkten und an der Umwelt
Schulden zu machen, ist zunächst einmal nichts Verwerfliches. Wer sich ein Eigenheim bauen oder sein Unternehmen modernisieren will, borgt sich in der Regel Geld. Auch Staaten machen das so: Wenn die Wirtschaft schwächelt oder besondere Aufgaben anstehen, die mit Steuereinnahmen nicht zu finanzieren sind, begeben die Regierungen Anleihen. Mit dem geliehenen Geld erhöhen sie die öffentlichen Ausgaben, erfinden Subventionen, senken Steuern oder fördern neue Technologien, um den Konsum anzukurbeln und die Produktivität zu steigern.
Mit dem Pump holt man sich die Zukunft in die Jetztzeit. Ist das Geld gut investiert, entsteht ein Mehrwert. Wer ein Eigenheim bezogen hat, kann sich fortan die Miete sparen. Unternehmen können aus Investitionen neue Gewinne schöpfen. Und staatliche Maßnahmen zur Konjunkturbelebung sorgen im besten Fall für höhere Steuereinnahmen. In jedem Fall lassen sich die Schulden nebst den fälligen Zinsen zurückzahlen. Schulden ermöglichen neues Wachstum. Genau dafür sind die Finanzmärkte da.
Die Menschen gehen aber nicht nur zur Bank, um sich Zukunft zu leihen, sondern auch in die Umwelt. Sie entnehmen der Natur Rohstoffe, sägen Holz aus dem Wald, pumpen Trinkwasser aus dem Untergrund oder fangen Fische aus dem Meer. Sie verdienen damit Geld und verbessern ihr Leben, schaffen also ebenfalls einen Mehrwert. Zurückzahlen müssen sie den Kredit an der Natur nicht im eigentlichen Sinne, also das Holz zurück in den Wald bringen oder die Fische ins Meer zurückwerfen. Vielmehr müssen sie der Umwelt ausreichend Zeit lassen, um die Verluste auszugleichen. Genau dafür sind die Ökosysteme da.
Maximale Schuldenberge
Soweit die Theorie. Die Praxis sieht allerdings meist anders aus. Kaum noch einem Staat gelingt es aus seinen Schulden „herauszuwachsen“. Vielmehr werden alte Schulden meist mit neuen beglichen und weitere kommen hinzu. Weltweit wachsen die Verbindlichkeiten der Staaten, während die Wirtschaftswachstumsraten sinken und damit die Chancen, die Schulden zu bedienen – eine denkbar schlechte Kombination. Die Staaten der Welt stehen mittlerweile mit Anleihen von über 60 Billionen (das sind 60.000 Milliarden) US-Dollar in der Kreide – Tendenz weiter steigend. Allein die deutsche Staatsverschuldung (von Bund, Ländern und Gemeinden) lag Ende 2024 bei fast 2,5 Billionen Euro, das ist historischer Höchststand. Schätzungen gehen für 2025 von 2,9 Billionen Euro aus, das wäre der nächste Rekord. Deutschland gibt regelmäßig mehr aus als es einnimmt.
Alles nicht so schlimm?
Das bedrohlich klingende Mehr an Schulden gilt politisch nicht unbedingt als Problem. Denn wichtig ist nicht die Verschuldung in absoluten Zahlen, sondern es sind zwei andere Messgrößen: Erstens die Kreditkosten, also die fälligen Zinsen. Die waren jahrelang so niedrig oder sogar negativ, dass der deutsche Staat kaum etwas zu zahlen hatte für seine Anleihen. Das aber hat sich seit 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und der Zinswende geändert. Waren 2021 lediglich 3,9 Milliarden Euro Zinsen fällig, sind im Haushalt 2024 bereits 36,8 Milliarden eingeplant. Dieses Geld fehlt dem Staat, um seine eigentlichen Aufgaben zu erfüllen.
Zweitens die Schuldenquote, also der relative Schuldenstand, gemessen an der jährlichen Wirtschaftsleistung, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Sie liegt in Deutschland bei 63,7 Prozent und damit nur knapp oberhalb des Maastricht-Kriteriums von 60 Prozent. Floriert die Wirtschaft und sprudeln die Steuereinnahmen, lassen sich zusätzliche Schulden locker verkraften. Kredite sind tragbar, so lautet die finanzpolitische Küchenweisheit, solange sich die Zinsen über das Wirtschaftswachstum bedienen lassen. Herrscht allerdings Wachstumsflaute, wie derzeit in Deutschland, wird das Leben auf Pump zur fiskalischen Herausforderung. Ein „Herauswachsen“ aus dem Schuldenberg wird unmöglich. Es droht eine Schuldenfalle.
Geliehenes Naturkapital
Mit den Schulden an der Umwelt sieht es ähnlich aus. Nicht nur entnehmen wir den Ökosystemen mehr Rohstoffe aller Art, die nicht entsprechend nachwachsen, wir hinterlassen auch unerwünschte Nebenprodukte unseres Wirtschaftens in einer Menge, welche die Naturkreisläufe im gleichen Zeitraum nicht unschädlich machen können. So reichern sich Treibhausgase in der Atmosphäre an, Ewigkeitschemikalien in den Flüssen, Mikroplastik in den Ozeanen.
Unser Wohlstand fußt nicht nur auf geliehenem Geld, das sich womöglich nicht zurückzahlen lässt, sondern auch auf ökologischem Pump. Wir nutzen die Serviceleistungen der Natur – fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser oder eine lebensfreundliche Atmosphäre – wie einen Kredit. Aber wir tilgen ihn nicht, was dazu führt, dass die Ökosysteme überlastet werden und ihre Leistungen künftigen Generationen nicht mehr wie gewohnt zu Verfügung stehen: Weltweit lässt die Bodenerosion die landwirtschaftlichen Erträge schwinden, die Grundwasserreserven gehen vielerorts zur Neige und fossile Abgase reichern sich über unseren Köpfen an und heizen dem Klima ein. Die Selbstheilungskräfte der Natur sind überfordert: Bis sich Ackerböden erholen können, vergehen Jahrzehnte. Bis das Kohlendioxid aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas wieder in natürliche Kreisläufe eingebunden ist, Jahrhunderte. Für die Natur ist das irrelevant, sie wird irgendwann ein neues Gleichgewicht finden. Allerdings wird das neue Gleichgewicht kaum menschenfreundlich sein.
Zwischen Hoffnung und Unzufriedenheit
Allem Anschein nach herrscht weit verbreitet die Hoffnung, dass trotz der zweifachen Schuldenfalle alles irgendwie gut geht. Dass die Wirtschaft wieder wächst wie früher einmal, dass der Staat seine Aufgaben schultern kann und die Bevölkerung zufrieden stellt, dass sich die Natur mit technischen Lösungen reparieren lässt.
Das könnte schwierig werden. Denn die Aufgaben der Staaten werden größer, während die Bevölkerung vieler Länder zunehmend mürrischer wird, was sich am Erstarken populistischer Parteien zeigt. Offenbar trauen viele den politisch Verantwortlichen keine Lösung der Probleme zu. Oder sie wollen nichts von Lösungen hören, weil diese mit Einschränkungen, mit Verzicht auf einst erworbene Privilegien verbunden sind.
Zum Beispiel in Deutschland: Hier sorgt die Alterung der Gesellschaft für eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung bei einer wachsenden Zahl an Ruheständlern. Das bedeutet geringere Einnahmen und höhere Kosten für das Rentensystem. Dieses ist zwar von der Idee her umlagefinanziert aufgebaut, kann also eigentlich nur auszahlen, was es einnimmt. Niedrigere Renten wären die Folge. Das aber will niemand, schon weil die Ruheständler die zahlenmäßig stärkste Wählergruppe sind. Also schießt der Staat immer größere Beträge zu, die notgedrungen an anderer Stelle fehlen. 2023 waren es bereits 109 Milliarden Euro, eine Summe, die mit Sicherheit weiter steigen wird.
Auch an anderer Stelle wird es teurer: Die Infrastruktur des Landes ist in die Jahre gekommen, Schulen, Verkehrswege und Energienetze wurden lange vernachlässigt. Nicht nur die Bahn und ihre täglich etwa 20 Millionen Fahrgäste können ein Lied davon singen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schätzt den Finanzierungsbedarf der öffentlichen Hand für die Sanierung von Bahnstrecken, Straßen, Wasser- und Abwassersystemen in den nächsten zehn Jahren auf 400 Milliarden Euro.
Hinzukommen die Aufwendungen für die Ukraine und höhere Verteidigungsausgaben wegen der Bedrohung durch Russland. Und die Kosten, die durch Klimawandel und andere Umweltfolgen anfallen. Allein die Flut im Ahrtal im Jahr 2022 schlug mit Schäden von 35 bis 40 Milliarden Euro ins Kontor. Eine Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), der Prognos AG und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) im Auftrag des Umweltministeriums rechnet bis 2050 mit Kosten zwischen 280 und 900 Milliarden Euro, je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt.
Neue Schulden – oder Realismus?
Woher all diese Finanzmittel kommen sollen, ist die große Frage. Neue Schulden wären eine Möglichkeit, aber die wären so wenig nachhaltig wie die Klimapolitik. „Sondervermögen“, die der Bund beschließen kann, um „außergewöhnliche Notsituationen“ zu bewältigen, wie die Corona-Pandemie, die Unterfinanzierung der Bundeswehr oder die nach dem russischen Gas-Stopp eingetretene Energiekrise, sind nach dem Urteil des Bundesrechnungshofes keineswegs Vermögen, sondern Sonderschulden. Auch für sie müssen neue Kredite aufgenommen werden. Unterm Strich bleibt die nüchterne Erkenntnis: Die guten, fetten Jahre sind vorbei.
Was aber wäre eine angemessene Reaktion auf die multiple Notsituation? Notwendig wäre ein Realitätscheck, eine klare Ansage an die Bürgerinnen und Bürgern, dass wir in doppelter Weise über unsere Verhältnisse leben und dass dies auf lange Sicht nicht gut enden wird. Dass alle den Gürtel enger schnallen müssen, um einen (anderen) Wohlstand zu sichern.
Der Wahlkampf zur anstehenden Bundestagswahl wäre ein guter Moment, um der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken. Das wäre Realismus anstelle der üblichen Wahlversprechen.
Dann müssten die Realisten aber auch gewählt werden. Denn zu einer vernünftigen Politik gehören immer zwei: vernünftige Politikerinnen und Politiker und eine vernünftige Wählerschaft.
13.12.2024
Wetterextreme für Arme
Die am wenigsten entwickelten Länder leiden am meisten unter dem Klimawandel – aber sie können auch Einiges dagegen tun
Für die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre, die dem Planeten immer stärker einheizen, sind die klassischen Industrienationen hauptverantwortlich, mittlerweile tragen aber auch aufstrebende Schwellenländer wie China und Indien kräftig dazu bei. Die am wenigsten entwickelten Länder sind schlicht und einfach zu arm, um Kohle, Öl und Gas in großen Mengen zu verheizen. Dummerweise müssen sie die Hauptlast der Klimaveränderungen tragen.
Zwar richten die auf einem wärmeren Planeten wahrscheinlicher werdenden Dürren, Fluten und Waldbrände auch in reichen Ländern Katastrophen an, die immer höhere Kosten verursachen: In den vergangenen drei Jahrzehnten hätten die versicherten Schäden weltweit um 5,9 Prozent zugenommen, während die globale Wirtschaftsleistung lediglich um 2,7 Prozent gewachsen sei, schreibt der Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Aber versichert sind in der Regel nur Schäden im wohlhabenden Teil der Welt.
Wirklich hart trifft der Klimawandel deshalb jene Länder, in denen die Menschen gar keine Versicherung abschließen können und wo sie ohnehin oft schon ums Überleben kämpfen. Überschwemmungen, Wassermangel und Missernten dürften bis 2030 mehr als 120 Millionen Menschen zusätzlich in die Armut treiben, schätzen die Vereinten Nationen. Sie haben kaum Mittel und Möglichkeiten, sich an die Folgen der Klimaveränderungen anzupassen.
Dennoch können sie mit relativ einfachen Mitteln dazu beitragen, dass die Atmosphäre nicht immer mehr Treibhausgase aufnehmen muss. Indem sie ihre Wälder schützen, neuen Wald wachsen lassen oder mit regenerativen Energien kochen anstatt mit klimaschädlicher Holzkohle. Ein Entwicklungsprojekt in Sambia soll jetzt zeigen, wie sich das trotz aller lokalen Probleme praktisch umsetzen lässt.
Wie der Klimawandel Entwicklung behindert
Bis zu 600 Millionen sind allein in Afrika von Unterernährung bedroht, wenn die Landwirtschaft aufgrund von Dürrewellen und verheerenden Regengüssen Einbußen erleidet. Das veränderte Klima verursacht in den Ländern Afrikas Schäden in Höhe von auf zwei bis fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, meldet die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Rekordtemperaturen wie im Sommer 2023, als das Thermometer in Tunis auf 49,0 Grad und im marokkanischen Agadir auf 50,4 Grad stieg, machen den Aufenthalt im Freien praktisch unmöglich und fordern tausende Hitzetote.
Das alles sind nüchterne Zahlen, die wenig darüber aussagen, was der Klimawandel konkret für den Alltag der Menschen bedeutet. Anschaulicher wird die Lage schon, wenn man sich die Berichte von Organisationen zu Gemüte führt, die Entwicklungs- und Naturschutzprojekte vor Ort unterstützen. Zum Beispiel von „GEO schützt den Regenwald e.V.“, einem kleinen, aber feinen Verein aus Hamburg, der zusammen mit lokalen Organisationen Projekte in verschiedenen tropischen Ländern plant und finanziert. „In praktisch allen Regionen erleben wir derzeit klimabedingte Probleme“, erklärt Ines Possemeyer, Redakteurin des Monatsmagazins GEO und Geschäftsführerin des Vereins.
Zum Beispiel in Nepal, wo die Gletscher des Himalaya abschmelzen und der Zeitplan für den Monsun durcheinandergerät. Quellen versiegen, so dass in der Trockenzeit Wasser für die Landwirtschaft fehlt.
Dafür regnet es während des Monsuns stärker und über einen längeren Zeitraum. Die Folgen sind Hochwasser und Erdrutsche. Besonders entwaldete Berghänge können den Niederschlägen nicht standhalten, weichen auf und gehen zu Tal, reißen Häuser, Ackerland und Straßen mit. Allein im September 2024 kamen in den Fluten über 240 Menschen ums Leben, meldet die nepalesische Regierung.
In der Mittelgebirgsregion Dhading, fünf Autostunden westlich der Hauptstadt Kathmandu, betreibt „GEO schützt den Regenwald“ gemeinsam mit der nepalesischen Umweltschutzorganisation „National Conservation and Development Center“ ein Aufforstungs- und Entwicklungsprojekt. Dabei wurden Baumschulen eingerichtet, mit lokalen Waldnutzergruppen 325.000unge Bäume auf kahlen Hängen gepflanzt, holzsparende Kochherde eingeführt sowie die Gesundheits- und die Trinkwasserversorgung verbessert. Im September gingen in dem Gebiet über drei Tage schwere Spätmonsun-Regenfälle nieder. „Zum Glück blieben unsere Projektdörfer weitgehend verschont“, berichtet Ines Possemeyer, „aber die Niederschläge haben nicht weit entfernt Erdrutsche verursacht, Pistennbefahrbar gemacht und zwei vollbesetzte Busse in die Tiefe geschoben“.
Am anderen Ende der Welt, in Ecuador, einem Land mit einzigartiger Biodiversität, herrscht seit vier Monaten extreme Trockenheit und Brände breiten sich aus. Die geografische Lage beschert dem Land die verschiedensten Klimazonen, von subtropischen Küsten am Pazifik über die gebirgigen Andengebiete mit Bergregenwäldern bis zum Tiefland im Osten, deren Regenwälder zur Amazonas-Region zählen. Die ganze Region, von Brasilien bis Peru, von Venezuela bis Bolivien, ist von einer ungewöhnlichen Trockenperiode betroffen. Die ecuadorianische Hauptstadt Quito war tagelang in Rauch und Aschewolken gehüllt. Die Regierung spricht von einer Jahrhundertdürre und rief im November einen 60-tägigen Notstand aus.
Betroffen sind sogar die immergrünen Bergnebelwälder an den westlichen Andenhängen der Region Intag, die eigentlich dauerhaft vor Wasser triefen. Dort unterstützt „GEO schützt den Regenwald“ die lokale Organisation Decoin beim Aufkauf von Wald, der dann unter Schutz gestellt wird. Nicht nur für Brillenbären, Pumas und zahlreiche andere seltene Arten sind diese Wälder von großer Bedeutung, sondern auch als Wassereinzugsgebiete. Doch 2024 geriet der nicht mehr ganz so feuchte Nebelwald an drei Stellen in Brand, weil die Flammen von angrenzenden Weiden die Bäume übersprangen.
Nobelpreisträger für Klimaschutz
Mit am schlimmsten hat es in der jüngeren Vergangenheit den Süden Afrikas getroffen. In Simbabwe, Sambia und Botswana herrscht ein Regenmangel, wie es ihn seit über 60 Jahren nicht gegeben hat. Millionen Menschen hungern, weil auf den Feldern die Ernten verdorrt sind. Ohne künstliche Bewässerung lagen die Ernteausfälle bei 100 Prozent. Betroffen ist auch eine Region im Süden Sambias, in der „GEO schützt den Regenwald“ sein bisher ambitioniertestes Projekt plant. Das Besondere an dem Unternehmen ist nicht nur sein Modellcharakter, sondern auch, dass der Physiknobelpreisträger Klaus Hasselmann fast sein gesamtes Preisgeld an die Initiative gespendet hat, mit dem Ziel, Klimaschutz, Klimaanpassung, Artenschutz und Entwicklung unter einen Hut zu bringen. Das Nobelpreiskomitee hatte Hasselmann 2021 ausgezeichnet, weil er als erster Wissenschaftler bereits 1979 nachweisen konnte, dass der Klimawandel auf von Menschen verursachte Emissionen zurückzuführen ist.
In einem „Climate Village Lab“ sollen zunächst drei Dörfer in der Pufferzone des Lower Zambezi Nationalparks unterstützt werden, ihre Kohlendioxid-Emissionen (CO2) zu senken, den Wald zu erhalten und sich nachhaltig zu entwickeln. Die Ortschaften liegen unweit des Nachbarlandes Simbabwe in der Nähe des Sambesi und des Kafue, der beiden größten Flüsse Sambias. Wissenschaftler werden Kosten und Nutzen der einzelnen Hilfsmaßnahmen analysieren, um nach einem Baukastensystem weitere Dorf-Projekte mit größtmöglicher Wirkung anzuschieben.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sollen Dörfer, in denen eine arme Bevölkerung lebt, ihren CO2-Ausstoß senken, wo die Leute weder Autos besitzen noch Kohlekraftwerke betreiben oder im klimatisierten Supermarkt einkaufen? Die Antwort liegt wiederum in der Armut: Die meisten Familien leben von dem, was sie auf ihren kleinen Feldern anbauen. Selten erzielen sie Überschüsse, mit denen sich ein Einkommen erwirtschaften ließe. In der Dürre reicht das nicht einmal zum Überleben. Dann wird die illegale Produktion von Holzkohle zur einzigen Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen. Und die wiederum führt zu erheblichem CO2-Ausstoß. Eine Vorstudie für das GEO-Projekt quantifiziert die holzkohlebedingten Emissionen der drei Dörfer auf 6.226 Tonnen CO2 pro Jahr. Damit kommen die Bewohner auf Pro-Kopf-Emissionen, die etwa ein Drittel so hoch liegen wie in Deutschland. Die Holzkohleproduktion ist damit so ziemlich die ineffizienteste und klimaschädlichste Methode des Gelderwerbs.
Mittlerweile sind die Wälder im Hinterland der Dörfer stark geschädigt. Zudem führt die Nähe zu großen Nationalparks mit vielen Elefanten in zwei der drei Dörfer zu massiven Mensch-Tier-Konflikten. Denn auch die Elefanten leiden unter dem aktuellen Wassermangel, müssen auf der Suche nach Nahrung immer weitere Strecken zurücklegen und machen sich über die Mais- oder Bananenfelder der Anwohner her. Allein im zweiten Quartal 2024 wurden in der Region Chiawa sechs Menschen durch Elefanten getötet.
Armut = Energiearmut
Eigentlich wäre es einfach, die Felder zu schützen und die Ernten mit Bewässerung zu steigern. Aber nur die wenigsten Bauern können sich dieselbetriebene Pumpen leisten und Flusswasser auf ihre Äcker leiten. Das wird sich erst ändern, wenn im Rahmen des GEO-Projektes Solarpaneele aufgestellt werden, die über ein lokales Versorgungsnetz den Strom für Elektrozäume und -pumpen liefern. Bisher verfügt keiner der Haushalte über einen Stromanschluss, und damit über Beleuchtung oder Kühlschränke zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Die Erfahrung zeigt, dass mit Zäunen und Bewässerungsanlagen nicht nur deutlich bessere Ernten möglich werden, sondern sogar zwei pro Jahr. Damit wäre nicht nur die Versorgung der Familien gesichert, sondern sie könnten auch einen Teil ihrer Ernten verkaufen und sich die mühsame und gesundheitsgefährdende Produktion von Holzkohle schenken. Plan ist, dass sich im Rahmen des Projektes die Einnahmen der Familien aus der Landwirtschaft über zehn Jahre verfünffachen.
Weitere Verdienstmöglichkeiten entstehen, wenn die Bauern Nutzbäume wie Avocado oder Mango pflanzen. Jeder Baum speichert CO2. Flächen von degradiertem Wald sollen die Chance bekommen, sich natürlich zu regenerieren. Für diese „Naturverjüngung“ ist es lediglich nötig, einen Zaum um das Gelände zu ziehen und darauf zu warten, dass herbeigetragene Baumsamen von alleine keimen und zu einem veritablen Wald heranwachsen. Berechnungen für das geplante Projekt haben ergeben, dass die Bäume nach zehn Jahren pro Hektar 114,5 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft ziehen und im Holz binden. Die eingefangene Menge des Treibhausgases lässt sich dann im Rahmen des internationalen CO2-Zertifikate-Handels nutzen.
Dieses umweltpolitische Instrument zur Bekämpfung des Klimawandels beruht darauf, dass es für CO2-Emittenten in Industrie und Gewerbe, aber auch für Privathaushalte künftig immer teurer wird, Kohle, Öl und Gas zu verfeuern und CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Um die Kosten zu sparen, müssen sie entweder runter mit den Emissionen oder sich im Emissionshandel Zertifikate von Akteuren kaufen, die ihren Ausstoß deutlich gesenkt haben beziehungsweise der Atmosphäre sogar CO2 entziehen, etwa durch Waldschutz und neugepflanzte Bäume.
Das GEO-Projekt ist so angelegt, dass die drei Modelldörfer mit ihren 612 Haushalten respektive 2.319 Einwohnern pro Jahr insgesamt 7.000 bis 8.000 Tonnen C02 einsparen oder der Atmosphäre entziehen. Das entspricht etwa der Menge, die 1.000 Einwohner Deutschlands im Schnitt pro Jahr zu verantworten haben.
Arme Bauernfamilien in Sambia würden damit leisten, was deutsche Wohlstandbürger nicht hinbekommen. Die Einnahmen aus dem Emissionshandel fließen dann in den Climate Village Fund, von dem die Dorfbewohner profitieren. Sie können etwa Bewässerungspumpen kaufen oder eine gemeinschaftliche Kornmühle, mit der sich Mais zu Mehl verarbeiten lässt. Oder die Dorfbewohner können Mikrokredite aufnehmen, mit denen sie Kleinbetriebe gründen.
Mit dem Projekt lässt sich zwar nicht das Weltklima retten. Aber es ist ein erster Schritt, eine Entwicklung in einer armen Region voranzubringen, ohne dass dabei zusätzlicher Klimaschaden angerichtet wird. Und es verbessert die Möglichkeiten der Menschen, sich an den Wandel, der nicht mehr zu verhindern ist, bestmöglich anzupassen. Vor allem dann, wenn die ersten Erfolge in dem Projekt eine Skalierung zulassen. Also das, was in den drei Pilotdörfern funktioniert, an möglichst vielen weiteren Orten zu wiederholen.
31.10.2024
Berliner Mogelpackung
Die deutsche Entwicklungs-Politik fördert vieles – aber nicht unbedingt Entwicklung
Die 26 ärmsten Länder der Welt kommen nicht vom Fleck. Nach einem Bericht der Weltbank stehen sie im Schnitt wirtschaftlich schlechter da als vor der Corona-Pandemie. Sie erhalten aktuell weniger internationale Unterstützung als in den Vorjahren und sind verstärkt von klimabedingten Naturkatastrophen betroffen. Zudem sind sie so hoch verschuldet wie seit 20 Jahren nicht mehr. Sie können wegen der Kreditzinsen wenig in die Zukunft investieren und sich schon deshalb kaum aus der Armutsfalle herausarbeiten. Mancherorts sinken sogar die Pro-Kopf-Einkommen, weil die Bevölkerung so stark wächst. Die meisten dieser Länder, in denen immerhin zehn Prozent der Weltbevölkerung leben, liegen in Afrika südlich der Sahara.
Ihnen zu helfen wäre ein humanitärer Akt der Solidarität, läge aber auch im Eigeninteresse: Denn die wenig entwickelten Länder sind potenzielle Krisenherde ̶ in einer Welt, die weder weitere Konflikte noch eine unkontrollierte Migration der Verzweifelten brauchen kann.
Aber reicht die Hilfe der Geberländer wie Deutschland. Vor allem: Wird sie zielgerichtet eingesetzt? Immerhin ist die Bundesrepublik einer der größten finanziellen Unterstützer im internationalen Geschäft der Entwicklungszusammenarbeit (EZ).
Weniger Geld für die armen Länder
Längst steht der Entwicklungsetat auf der Streichliste der Bundesregierung, der es momentan an allen Ecken an Geld fehlt. Waren für das Jahr 2023 noch 12,2 Milliarden Euro für die EZ eingeplant, ist es für das laufende Jahr fast eine Milliarde weniger. Weitere Kürzungen dürften in den Folgejahren anstehen.
Allerdings spiegelt der Etat des zuständigen Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) bei weitem nicht die Summe der gesamten Entwicklungshilfe wieder, nach dem international gebräuchlichen englischen Fachbegriff
„Official Development Assistance“ ODA genannt. Nach der Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind ODA staatliche Unterstützungen, „die gezielt darauf ausgerichtet sind, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Entwicklungsländern zu fördern“.
So vermeldet die OECD für Deutschland im Jahr 2023 ODA in Höhe von 33,9 Milliarden Euro, zweieinhalbmal so viel wie der eigentliche BMZ-Haushalt. Das macht Deutschland nach den USA zum zweitgrößten Geldgeber der Welt. Die zusätzlichen Mittel stammen von den Bundesländern und anderen Ministerien, allen voran dem Auswärtigen Amt. Sie fließen beispielsweise in humanitäre Hilfen oder in Stipendien, die an ausländische Studierende in Deutschland gehen. Das von den Vereinten Nationen vorgegebene Ziel, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens in die Entwicklungszusammenarbeit zu stecken, ist damit locker erreicht.
Das klingt erst einmal gut, zumal nur wenige Länder dieses Ziel erreichen. Allerdings zeigt sich beim Studium der Einzelposten im erweiterten Entwicklungshaushalt, dass große Summen in Projekte fließen, die mit der Entwicklung der bedürftigen Länder gar nichts zu tun haben. Der größte Posten etwa ist die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter in Deutschland. Im Jahr 2022 (dem letzten Jahr mit einer abgeschlossenen Bilanz) beispielsweise waren es 3,6 Milliarden Euro, was sich unter anderem durch die vielen Geflüchteten aus der Ukraine erklärt. Damit verbessern sich kaum die Lebensbedingungen in Afrika südlich der Sahara. Auch wenn Generatoren, medizinisches Gerät oder Krankenwagen in die Ukraine geschickt werden, um die Folgen des russischen Angriffskrieges zu mildern, zählt die Bundesregierung dies zu dem ODA-Mitteln. Das gleiche gilt für Beiträge an multilaterale Organisationen oder an deutsche Wissenschaftsinstitute, wenn sie mit Steuermitteln zu Tropenkrankheiten forschen.
Ein weiterer wichtiger Posten im erweiterten Entwicklungshaushalt ist die sogenannte Klimafinanzierung mit 6,4 Milliarden Euro im Jahre 2022. Damit werden im globalen Süden Projekte gefördert, die den Treibhausgasausstoß senken beziehungsweise ihn nicht so ausufern lassen sollen, wie es die wohlhabenden Länder seit Jahrzehnten vorleben. Deutschland beispielsweise ist für das 2,8-fache der Menge des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre verantwortlich, die ganz Afrika südlich der Sahara erzeugt. Dort leben allerdings 1,3 Milliarden Menschen, fast 16-mal mehr als hierzulande.
Das World Resources Institute aus Washington kritisiert in einer Studie, dass die finanziellen Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels oft der „klassischen“ Entwicklungshilfe entzogen werden. Klimaschutz kommt zwar auch den armen Ländern zugute, aber er liegt vor allem im Eigeninteresse Deutschlands, denn Extremereignisse wie Dürren, Stürme oder Überschwemmungen verursachen mittlerweile enorme Kosten. Mit anderen Worten: Sollen doch wenigstens die Entwicklungsländer ihre Treibhausgas-Emissionen niedrig halten, wenn wir selbst weiter auf viel zu hohem Niveau bleiben.
Welche Hilfe wirkt wirklich?
Wie aber wäre den am wenigsten entwickelten Ländern am meisten geholfen? Sicher nicht mit der Idee, die 17 Ziele der Nachhaltigen Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) nebst ihren 169 Unterzielen erfüllen zu wollen. Mit diesem überambitionierten Aufgabenpaket, das offiziell dazu dienen soll, die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein Leben in Frieden und Wohlstand zu ermöglichen, sind alle Länder, insbesondere die ärmsten hoffnungslos überfordert. Wer immer versuchen würde, sämtliche 169 Ziele zu erreichen, würde sich komplett verzetteln und keinerlei Fortschritte verzeichnen. Zum Teil widersprechen sich die einzelnen Ziele sogar.
Die Regierungen sowohl der Geber- wie auch der Empfängerländer von Entwicklungsgeldern rühmen sich zwar unentwegt, möglichst viele der SDGs zu verfolgen, aber bisher ist kein Land der Welt dabei, die Ziele auch nur annähernd zu erreichen. In manchen Bereichen müssen die Vereinten Nationen sogar Rückschritte vermelden, etwa beim Klimaschutz, bei der Bekämpfung der Ungleichheit oder beim Kampf gegen den Hunger auf der Welt. Studien zufolge gab es sieben Jahre nach Proklamation der SDGs kaum Belege dafür gibt, dass die Ziele zum Klimaschutz oder zum besseren Schutz von Biodiversität und Natur beitragen.
Die SDGs wurden so hemmungslos überladen, weil die Vereinten Nationen 2015 versucht hatten, die große Zahl an Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsproblemen mit einer entsprechend großen Zahl von Lösungen zu beantworten. Dieses Behandeln von Symptomen entspricht der gängigen Praxis im politischen Tagesgeschäft. Es ist aber meist ineffizient und zum Scheitern verdammt.
Auf zentrale Schaltstellen der Entwicklung konzentrieren
Sinnvoller wäre es, die Entstehungsorte der einzelnen Probleme zu identifizieren und deren eigentliche Ursachen aufzuspüren. Dabei zeigt sich oft, dass diese wie Fäden zu einem oder wenigen Knoten zusammenlaufen, den zentralen Schaltstellen der Entwicklung. Das Auflösen solcher Knoten verspricht generell mehr Erfolg als das Behandeln von Symptomen.
Gesundheit, Bildung und Arbeitsplätze sind vermutlich die wichtigsten Schaltstellen in der sozioökonomischen Entwicklung der armen Länder. Gerade in Afrika südlich der Sahara herrschen hier die größten Defizite. In der Region haben die Menschen die weltweit größte Krankheitslast zu tragen. HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria fordern dort überproportional viele Opfer. Für 1.000 Personen stehen im Schnitt gerade mal 1,3 Gesundheitshelfer zur Verfügung und das sind in der Regel keine ausgebildeten Ärztinnen oder Ärzte. Es fehlt an Medikamenten und medizinischem Gerät. Kein Wunder, dass Subsahara-Afrika die mit Abstand höchsten Raten an Säuglings-, Kinder- und Müttersterblichkeit vermeldet.
Ähnlich schlecht steht es um die Bildung in diesen Ländern. Das Lehrpersonal ist tendenziell schlecht qualifiziert und erscheint häufig nicht zum Unterricht. Vielerorts drängen sich in Grundschulklassen 50 bis 90 Kinder. Ein Drittel der Grundschulen verfügt über keine Toiletten oder Sanitäranlagen, die Hälfte hat kein Trinkwasser, die Mehrheit keinen Stromanschluss. Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen Unesco geht ein Drittel der Kinder zwischen 12 und 14 Jahren in Subsahara-Afrika nicht zur Schule. Ebenso die Hälfte der Jugendlichen im Sekundarschulalter von 15 bis 17 Jahren. Besonders Mädchen bleiben häufig von der Bildung ausgeschlossen oder sie besuchen nur sehr kurz die Schule. Ein Viertel aller jungen Menschen zwischen 25 und 24 Jahren können nicht lesen und schreiben. Bei den Erwachsenen gilt das für ein Drittel. All diese Analphabeten haben in einer globalisierten Welt kaum eine Chance auf ein auskömmliches Leben und sie können ihren Ländern auch nicht bei der notwendigen Entwicklung helfen.
Die dritte große Baustelle Afrikas ist der Mangel an Jobs. Die Bevölkerung wächst schneller als die Zahl der Arbeitsplätze und damit auch der Unmut unter den jungen Menschen. Die African Development Bank schreibt, dass jährlich zehn bis zwölf Millionen junge Menschen in den Arbeitsmarkt hineinwachsen, aber lediglich drei Millionen in formellen Jobs landen. Der Rest bleibt ohne Arbeit oder findet lediglich Beschäftigung im informellen Sektor, mit schlechter Bezahlung und ohne jede soziale Absicherung.
Gesundheit und Bildung sind die Grundlagen für das sogenannte Humankapital, das einen Menschen befähigt, seine Interessen zu verfolgen und für das eigene Wohlergehen und das seiner Familie zu sorgen. Dafür müssen die Regierungen, auch mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, alles tun, damit produktive Arbeitsplätze entstehen. Ohne Gesundheit und Bildung bleiben Gesellschaften in dem Kreislauf aus Armut und hohen Geburtenraten gefangen. Es ist statistisch belegt, dass erst mit besserer Gesundheitsversorgung und sinkender Kinder- und Müttersterblichkeit die Geburtenziffern zurückgehen. Erst wenn die Menschen wissen, dass ihre Kinder bessere Überlebenschancen haben, sinkt der Wunsch nach mehr Nachwuchs. Kleinere Familien haben die Möglichkeiten, mehr in die Bildung ihrer Kinder zu investieren. Besser gebildete Frauen wiederum wünschen sich deutlich weniger Nachwuchs als gebildete und können diesen Wunsch auch leichter in die Wirklichkeit umsetzen. Überall auf der Welt sind die Geburtenziffern gesunken, wenn Mädchen nicht nur eine Grundschule besuchen, sondern möglichst lange vom Lernen profitieren. Wenn sich das Bevölkerungswachstum reduziert, steigt das Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung und der Staat hat mehr Spielraum in die notwendigen Infrastrukturen zu investieren, etwa in Krankenstationen und Schulen.
Bessere Bildung eröffnet Frauen wie Männern bessere Einkommensmöglichkeiten und fördert die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Kinder von besser gebildeten Frauen haben ein deutlich geringeres Risiko in jungen Jahren zu versterben. Bildung und Gesundheit stehen in einer positiven Wechselwirkung zueinander: Epidemiologische Statistiken zeigen klar, dass besser Gebildete im Schnitt gesünder und leistungsfähiger sind. Sie leben auch länger.
Menschen, die nicht gesund und kaum gebildet sind, können sich kaum produktiv betätigen. Ohne Gesundheit und Bildung haben Gesellschaften keine Chance auch nur einige der SDGs zu erfüllen. Die wohltönenden Ziele sind dann obsolet. Auch die Entwicklungshilfe muss scheitern, wenn den Menschen die Grundlagen fehlen, ihre Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen. Sie sind auch nicht stark genug ihre Rechte einzuklagen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Länder am Tropf der Entwicklungshilfe hängenbleiben und trotzdem nicht vorankommen. Der amerikanische Ökonom und ehemalige Weltbank-Mitarbeiter William Easterly konnte sogar nachweisen, dass viele der erfolgreichen Schwellenländer ihren Aufstieg ohne wesentliche Hilfe von außen bewältigt haben ̶ oder gerade deshalb.
Hilfe zur Selbsthilfe
Somit wäre es sinnvoll, das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit komplett zu überdenken und sich bei der Förderung auf jene wesentlichen Interventionen zu beschränken, die den Menschen die Aneignung der lebenswichtigen Basiskompetenzen ermöglichen. Hilfe zur Selbsthilfe hat man das früher genannt. Es ist aber ein wenig aus der Mode gekommen.
Dabei geht es sicher nicht nur um Gesundheit und Bildung, sondern auch um eine Verbesserung der Infrastrukturen, um Exporterleichterungen, gute Regierungsführung oder die Eindämmung der Korruption. Ansonsten kann man die meisten Ziele und Unterziele der SDGs getrost erst einmal vergessen. Denn mit besser befähigten Menschen, die sich wie überall auf der Welt volkswirtschaftlich betätigen, die in der Lage sind eine Zivilgesellschaft aufzubauen, die selbstbewusst um demokratische Rechte kämpfen, lassen sich viele dieser Ziele mittelfristig von ganz alleine oder zumindest einfacher lösen. Armutsbekämpfung, Wirtschaftswachstum und ein Ende des Hungers, drei Hauptanliegen der SDGs, lassen sich ohne eine gesunde und gebildete Bevölkerung nie erreichen.
16.09.2024
Lange gewusst – trotzdem schlecht vorbereitet
Die Babyboomer gehen in Rente
Als ob das eine Überraschung wäre: Weil in dem Jahrzehnt von 1955 bis 1964 in Deutschland so viele Kinder zur Welt kamen wie seither nicht mehr, nähert sich jetzt eine ungewöhnlich große Kohorte jenem Alter, in dem sich die allermeisten Menschen in den Ruhestand verabschieden. 1964, im Spitzenjahr der sogenannten Babyboomer, gab es deutschlandweit 1,36 Millionen Neugeborene. 2023 waren es mit 693.000 nur noch halb so viele. 1964 bekamen Frauen in Deutschland im Schnitt 2,5 Kinder, heute sind es noch 1,35. Das ist ein Wert, bei dem jede Nachwuchsgeneration ein Drittel kleiner ist als die ihrer Eltern. Da kann man getrost von einer Zeitenwende sprechen.
Seit den frühen 1970er Jahren, als mit dem sogenannten Pillenknick die Geburtenziffern in Deutschland rapide zurückgingen, war somit klar, dass es zeitversetzt um ein gutes halbes Jahrhundert zu einem Mangel an jungen Arbeitskräften bei gleichzeitig starkem Anstieg an versorgungsberechtigten Älteren kommen würde. Alarm für die Sozialversicherungen! Trotzdem hat sich die Politik bis heute nicht angemessen auf diese Zeitenwende vorbereitet.
Und die kommt jetzt zur Unzeit: Denn die Kassen sind leer. Und sie werden auch nicht voller werden, weil der demografische Wandel ein Hauptgrund für sinkendes Wirtschaftswachstum ist, das sich in Deutschland bereits um die Nulllinie herum eingependelt hat. Obendrein hat der Wandel in der Bevölkerungsstruktur einen erheblichen Einfluss auf die gesellschaftliche Stimmung im Land: Bei den jüngsten Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben populistische Parteien besonders gut in jenen Regionen abgeschnitten, die in den vergangenen Jahren viel Bevölkerung verloren haben. Weil vor allem junge Menschen abgewandert sind, ist die verbliebene Einwohnerschaft stark gealtert, was weiteren Schwund in der Zukunft bedeutet. Die Infrastruktur ̶ Busverbindungen, Kneipen oder Krankenhäuser ̶ verschwindet peu à peu, Häuser stehen leer, die Menschen sind unzufrieden. Und wählen Parteien, von denen sie sich Besserung versprechen. Mit diesen in den Parlamenten werden notwendige Reformen noch unwahrscheinlicher.
Viele der heutigen Herausforderungen im Lande beruhen auf der Vernachlässigung des Themas Demografie: Der Mangel an Auszubildenden, der Fachkräftemangel in nahezu allen Branchen, eine Zuwanderung, die zu wenig an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert ist, Finanzierungslücken in Renten-, Gesundheits- und Pflegekassen, ganz zu schweigen von den stark wachsenden Pensionslasten, die der Staat (also der Steuerzahler) zu finanzieren hat, denen aber keinerlei Einzahlungen gegenüberstehen.
Lange hat sich kaum wer für Demografie interessiert
Warum aber hat die Politik den demografischen Wandel so lange zu wenig ernst genommen, ihn geradezu ignoriert?
Deutschland hat relativ spät begonnen sich für demografische Prozesse überhaupt nur zu interessieren. Erst Anfang der 2000er Jahre dämmerte es einer breiten Öffentlichkeit und der Politik, ausgelöst durch zwei viel diskutierte Publikationen, dass rückläufige Geburtenziffern und ein immer länger währendes Leben die Gesellschaft grundlegend verändern dürften.
Es gab in Deutschland (West) lange Zeit keine einflussreichen Stimmen aus der demografischen Forschung. Das lag an der dunklen Vergangenheit des Landes, denn die Nationalsozialisten hatten die Demografie für ihre völkischen Ideen missbraucht. Parolen wie „Herrenrasse“, „Volk ohne Raum“ oder „Lebensraum in Osten“ haben ein verbranntes Feld hinterlassen, das auch die Politik kaum betreten wollte.
Davon zeugen etwa die beschwichtigenden Worte Konrad Adenauers: „Kinder kriegen die Leute sowieso“. Oder die von Helmut Schmidt, der abwiegelte, die Politik solle sich aus den Ehebetten raushalten. Und Helmut Kohl machte die Warner aus der eigenen Partei mundtot, etwa Kurt Biedenkopf oder Meinhard Miegel, die früh gefordert hatten, auf den demografischen Wandel zu reagieren. Warum auch sollte er sich um Veränderungen kümmern, die Jahre, Jahrzehnte vor ihm lagen?
Die goldenen Jahre der Demografie sind vorbei
Zumal der demografische Wandel lange von wirtschaftlichem Vorteil war. Zum einen bedeuten weniger Kinder weniger Kosten. Zum anderen war die große Kohorte der Babyboomer zwar stets im Gedrängel, in den Schulen, um Ausbildungsplätze und auf der Suche nach einem Job. Aber der Mangel an Arbeitsplätzen hielt die Einkommen unter Kontrolle, die Wirtschaft florierte. Zudem waren die Boomer besser qualifiziert als jede Generation zuvor. Sie fanden gute Jobs und sorgten für Rekordeinnahmen in den Steuer- und Sozialkassen. Die Boomer mögen einen schlechten Ruf haben, aber sie sind hauptverantwortlich dafür, dass es dem Land heute vergleichsweise gut geht.
Das waren die goldenen Jahre der Demografie, die nunmehr zu Ende gehen. Um das Jahr 2030 herum, wenn sich die kopfstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit in den Ruhesstand verabschieden, wird jeder Jahrgang, der ins Erwerbsleben einsteigt, nur noch etwa halb so groß sein wie der jeweilige Neurentnerjahrgang. Wir hinterlassen den kleiner werdenden jungen Generationen also neben einer Reihe von Umweltproblemen und einer wachsenden Schuldenlast bei sinkendem Wirtschaftswachstum neue, ungedeckte Rechnungen durch die Alterung der Gesellschaft. Generationengerechtigkeit geht anders.
Die Generation 60+ hat die Mehrheit an der Wahlurne
Es hilft wenig, darüber zu klagen, dass die Politik die lange Vorlaufzeit des demografischen Wandels verschlafen hat, um sich auf die erwartbaren Herausforderungen angemessen vorzubereiten. Die Versäumnisse in der Familien-, Sozial-, Bildungs- und Zuwanderungspolitik lassen sich nicht rückgängig machen. Es bleiben nur Reparatur- und Anpassungsmöglichkeiten, und die sind heikel genug.
Das politische Hauptproblem hierbei ist wiederum die Alterung der Gesellschaft. Die Generation 60+, also die heutigen und baldigen Ruheständler, kommen auf einen Anteil unter den Wahlberechtigten von knapp 50 Prozent. Weil sie häufiger zur Wahl gehen als die Jungen, haben sie an der Wahlurne bereits die Mehrheit, die sich noch vergrößern wird. Große Parteien sind auf die Stimmen dieser Menschen angewiesen. Und sie werden sich erfahrungsgemäß kaum für mehr Generationengerechtigkeit zugunsten der Jüngeren einsetzen. Das könnte in einem Wahldesaster enden. Schließlich ist die Rente mit 67, die der frühere SPD-Sozialminister Müntefering einst durchgeboxt hat, zum Trauma der Sozialdemokraten geworden.
Heute üben sich die meisten Parteien in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der Generation 60+ und lassen sich in Wahlkampfreden kaum auf Leistungseinschränkungen für Ältere ein, welche die Jungen weniger belasten würden. Der Philosoph Wolfgang Kersting hat den „Automatismus einer stetigen Erhöhung der Transferleistungen“ einmal als phantasielos bezeichnet. Dieser verwandle „den Sozialstaat in eine Kriegskasse zur Finanzierung parteipolitischer Wiederwahlkampagnen“.
Aufgeweckte DDR
Die Ignoranz gegenüber dem demografischen Wandel war allerdings lange Zeit ein typisches Westphänomen. Im Osten des Landes, in der ehemaligen DDR, war die Politik sehr viel wacher. Auch dort gab es in den 1960er Jahren den Babyboom und anschließend den Geburteneinbruch, runter auf 1,5 Kinder pro Frau. Nun war die DDR nicht gerade ein Land, das attraktiv für Zuwanderer war. Auch einigen angestammten Bewohnern gelang es, trotz Mauer und Stacheldraht, sich aus dem Sozialismus zu entfernen. So kam es, dass die DDR in jedem einzelnen Jahr ihrer Existenz Einwohner verlor. Damals entstand der sarkastische Ost-Spruch, der Letzte möge doch bitte irgendwann das Licht ausmachen.
Den Machthabern in Ostberlin war schnell klar, dass Sozialismus ohne Menschen keinen Sinn ergibt. Aus dieser Überlegung entstand eine DDR-Familienpolitik, die den Bürgerinnen und Bürgern das Kinderkriegen wieder schmackhaft machen sollte: Es gab Kredite für junge Familien, die man „abkindern“ konnte. Mit dem ersten Kind war die Hälfte des Darlehens getilgt, mit dem zweiten der Rest. Zudem konnten junge Menschen nur eine neue Wohnung bekommen, wenn sie verheiratet waren und Nachwuchs hatten. Das war Druck genug und prompt bekamen die DDR-Frauen wieder mehr Nachwuchs und zwar in viel jüngeren Jahren als im Westen. Binnen weniger Jahre stieg die Kinderzahl je Frau bis 1981 wieder auf 1,9. In der Fertilitätskurve der DDR wird dies als „Honecker-Buckel“ bezeichnet.
Dummerweise haben derartige Anreize für das Kinderkriegen meist nur einen vorübergehenden Effekt: So ganz zufrieden mit sich und der Welt waren die DDR-Bewohner doch nicht und tatsächlich gingen die Kinderzahlen je Frau bald wieder zurück. 1989, als die Mauer fiel, hatten sie fast das niedrige West-Niveau von 1,5 erreicht. Weil nach der Wende rund 1,8 Millionen Menschen ihr Glück im Westen suchten und die Geburtenziffer in den 1990er Jahren vorübergehend auf den historisch niedrigen Wert von 0,7 absackte, löste sich der Erfolg des Honecker-Buckels komplett in Luft auf.
Was tun?
Mittlerweile haben sich die Geburtenziffern in Ost und West weitgehend angeglichen. 2023 lagen sie bundesweit bei 1,35, mit leichtem Vorsprung im Westen. Damit nimmt der demografische Wandel seinen Lauf und es bleibt nichts weiter, als sich an die kommenden, drastischen Veränderungen anzupassen. Was wären die wichtigsten Empfehlungen an die Politik?
- Angesichts der Tatsache, dass derzeit gut sechs Prozent der jungen Menschen ohne Schulabschluss ins Leben entlassen werden und weitere geschätzte zehn Prozent als nicht ausbildungsfähig gelten, weil sie nicht angemessen lesen, schreiben und rechnen können, muss deutlich mehr in Bildung investiert werden. Ein Land mit wenig Nachwuchs sollte diesen bestmöglich qualifizieren.
- Die Rentenbezugsdauer in Deutschland hat sich seit 1990 von gut 15 Jahren auf mittlerweile fast 21 Jahre verlängert. Das eigentlich umlagenfinanzierte Rentensystem ist bereits heute auf Zuzahlungen aus dem Steuertopf in Höhe von 109 Milliarden Euro (2023) angewiesen. Tendenz steigend. Damit ist das Rentensystem in keiner Weise demografiefest. Deshalb dürften die Renten künftig nur noch langsamer steigen als die Löhne, um die Erwerbstätigen nicht unmäßig zu belasten. Zudem sollte das Renteneintrittsalter automatisch an die durchschnittliche Lebenserwartung gekoppelt werden. Steigt sie um ein Jahr, müssten die Menschen acht Monate länger arbeiten und könnten vier Monate länger Rente beziehen. Dieses Verhältnis von 2:1 entspricht genau den heutigen Bedingungen, wonach das durchschnittliche Erwerbsleben etwas 40 Jahre währt und der Ruhestand 20 Jahre. Diese Reform wäre fair und einfach zu vermitteln.
- Dem Fachkräftemangel, der sich demografisch bedingt ausweiten wird, muss mit einer geordneten, am Arbeitsmarkt orientierten Zuwanderung begegnet werden. Schätzungen zufolge braucht das Land rund 400.000 Menschen aus anderen Ländern, die umgehend in Lohn und Brot kommen. Fachkräfte aus Drittstaaten gilt es offensiver als heute anzuwerben und die Einwanderungsbedingungen bürokratisch zu entschlacken. Asylverfahren für Geflüchtete sind zu beschleunigen. Anerkannte Flüchtlinge brauchen sofortige Deutschkurse und die Möglichkeit sich weiterzubilden, damit sie möglichst schnell zu Arbeitskräften und Steuerzahlern werden.
03.07.2024
Kühlen, bis die Erde dampft
Klimaanlagen behindern den Kampf gegen den Klimawandel
Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Wohnung zu kühlen, indem Sie einfach die Tür des Kühlschranks offenstehen lassen? Im ersten Moment mag es erfrischend sein, wenn das Gerät eine kalte Brise verströmt. Aber auf Dauer funktioniert das nicht, denn bei geöffneter Tür frisst das Kühlaggregat nicht nur eine Menge Strom, sondern es produziert an der Rückwand des Schrankes auch mehr Wärme, als es vorne an Kälte liefern kann. Die Bude heizt sich immer weiter auf, weshalb es nicht ratsam ist, auf diese Weise der Sommerhitze zu entkommen.
Interessanterweise versucht ein großer Teil der Menschheit genau dies trotzdem – und zwar im Großmaßstab: Wo es unangenehm warm ist und aufgrund des Klimawandels immer schneller immer wärmer wird, werden immer mehr Klimaanlagen in Wohnungen und Büros eingebaut. Autos sind ohne Kühlaggregate ohnehin kaum mehr zu haben.
Die Energiefresser beanspruchen rund 20 Prozent der weltweit verfügbaren Elektrizität. Sie brauchen Strom, der bis heute weltweit mehrheitlich aus fossilen Quellen wie Kohle und Erdgas erzeugt wird, wobei zwangsläufig das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) anfällt. Allein die Klimaanlagen in Haushalten dürften nach Angaben des US-amerikanischen Rocky Mountain Institute, einem Thinktank für Energiefragen, bei anhaltendem Trend bis 2050 global über 130 Gigatonnen CO2 verursachen. Damit würden sie 20 bis 40 Prozent des verbliebenen CO2-Budgets aufzehren, das zu emittieren erlaubt wäre, wollte man das 2-Grad-Ziel noch erreichen (vom auf dem Pariser Klimagipfel ausgelobten 1,5-Grad-Ziel spricht ernsthaft kaum noch ein Experte). Hinzu kommt, dass viele der weltweit betriebenen Klimaanlagen noch fluorierte Kohlenwasserstoffe als Kühlmittel enthalten, Chemikalien, die nicht nur als besonders starke Treibhausgase wirken, sondern auch die Ozonschicht schädigen.
Die Internationale Energieagentur (IAE) schätzt, dass bis 2050 in jeder Sekunde irgendwo auf der Welt zehn neue Klimaanlagen eingebaut werden. Diese ziehen einen zusätzlichen Strombedarf nach sich, der dem heutigen Verbrauch der EU, den USA und Japan zusammengenommen gleichkommt. Demzufolge dürfte allein das Kühlen von Haushalten über den Ausstoß von CO2 die globalen Temperaturen bis 2100 um 0,5 Grad steigen lassen. Hinzu kommt, dass die Klimaanlagen durch ihren Betrieb ihrerseits Wärme produzieren, die sie an die umgebende Luft entlassen. Sie sorgen damit gerade in Städten für ein zusätzliches Aufheizen und fördern die berüchtigten urbanen Hitzeinseln. Nach einer französischen Untersuchung würde sich die Luft auf den Straßen von Paris bei einer neuntägigen Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von 38 Grad um 2,4 Grad erhöhen, wenn die Raumtemperatur in den Gebäuden auf 23 Grad heruntergekühlt wird. Die Kühlung mit Klimaanlagen heizt dem Planeten also genauso ein wie die offene Kühlschranktür der Wohnung. So kann Klimaschutz nicht funktionieren.
Wenn Hitze tötet
Was aber wäre zu tun in diesem Dilemma? Dabei geht es weniger um die Menschen in Deutschland, wo das Gestöhne schon groß ist, wenn die 30-Grad-Grenze überschritten wird. Das ist Jammern auf hohem Niveau: Weit über zwei Milliarden Menschen mussten schon im Juni dieses Jahres 40 Grad und mehr ertragen. Allein auf der Hadsch nach Mekka starben mehr als 1.300 Pilger an mörderischen Temperaturen von 50 Grad und mehr. In Mexiko wurden 52 Grad gemessen. Indien registrierte die stärkste je gemessene Hitzewelle des Landes und Peru, wo eigentlich gerade Winter herrscht, meldete den Rekordwert von 36 Grad.
Extreme Hitze reduziert die Arbeitsproduktivität, erschwert klares Denken und das Lernen. Gerade wenig entwickelte Länder werden so an ihrem wirtschaftlichen Aufstieg gehindert. Bei Temperaturen oberhalb der durchschnittlichen Körpertemperatur von 36,6 Grad ist an normales Arbeiten kaum noch zu denken, weder im Büro oder in der Fabrik noch im Freien, wo oft noch die sengende Sonnenstrahlung hinzukommt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit wird es schon ab 31 Grad kritisch, weil der Körper nicht mehr schwitzen kann. Ab 40 Grad hört der Spaß komplett auf. Allerdings haben die Menschen in vielen ärmeren Ländern der Welt keine Chance, der Glut zu entkommen. Wird der Körper seine Wärme nicht mehr an die Umgebungsluft los, drohen Hitzekrämpfe, Hitzschlag, Dehydrierung, Herz-Kreislauf-Probleme und Atemnot. Menschen mit chronischen Vorerkrankungen wie Nierenleiden oder Diabetes geraten leicht in Lebensgefahr. Besonders Ältere sind gefährdet, auch weil sie gefährliche Hitze weniger gut wahrnehmen und weniger Durst empfinden. Allein der Sommer von 2022 (der wärmste je registrierte in Europa) forderte einer im britischen Fachblatt Nature veröffentlichten Studie zufolge mehr als 70.000 Hitzetote in Europa, dem Kontinent, der sich im Klimawandel relativ betrachtet am stärksten aufheizt.
Wo Kühlung Leben rettet
Gesegnet ist, wer seine Umgebung mit einer Klimaanlage herunterkühlen kann. Welche segensreichen Vorteile diese Geräte haben, hat zum Beispiel Frankreich gezeigt. Dort mussten die Behörden in dem sehr warmen August 2003 fast 15.000 Hitzetote vermelden, vor allem unter älteren Personen in Pflegeeinrichtungen. Mittlerweile ist das Land besser gerüstet: Die meteorologischen Dienste können früher vor einer Hitzewelle warnen, Krankenhäuser sind besser vorbereitet. Vor allem verfügen Senioreneinrichtungen jetzt über mindestens einen klimatisierten Raum, in dem sich die Menschen abkühlen können. Im Sommer 2022, als es in Frankreich ähnlich heiß wurde wie 2003, gab es etwa 80 Prozent weniger Hitzeopfer wie 2003.
Kühlung kann Leben retten, aber sie sorgt paradoxerweise dafür, dass sich die Heißzeiten künftig verstärken werden, was wiederum mehr Klimaanlagen erfordert, die dem Klima weiter einheizen. Auch wegen des wachsenden Kältebedarfs hält sich der globale Ausstoß von Treibhausgasen allen Einsparbemühungen zum Trotz auf hohem Niveau. 2023 gilt als jüngstes Rekordjahr, was klimaschädliche Emissionen betrifft.
In Indien, Indonesien oder Brasilien, also in Ländern, die künftig massiv unter dem Temperaturanstieg leiden werden, sind bis heute gerade einmal 7, respektive 9 beziehungsweise 16 Prozent aller Haushalte mit den kühlenden Geräten ausgerüstet. Von den 2,8 Milliarden Menschen, die in den wärmsten Zonen der Welt leben, haben laut IAE bisher nur zehn Prozent Zugang zu Klimaanlagen. Mit wachsendem Wohlstand werden es mit Sicherheit mehr. In den USA, wo Bürogebäude und Restaurants im Sommer gefühlt auf Temperaturen nahe der Frostgrenze heruntergekühlt werden, verfügen 90 Prozent der Haushalte über die Kältemaschinen. In China, den Land mit der dynamischsten wirtschaftlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit, laufen mittlerweile rund 800 Millionen Klimaanlagen, so viele wie sonst nirgendwo auf der Welt.
In Europa lassen erst 20 Prozent der Haushalte ihre Räume herunterkühlen, aber auch hier dürfte sich der Anteil angesichts der um sich greifenden Hitzewellen rasch erhöhen. Die IAE schätzt, dass sich die Zahl der Anlagen auf unserem Kontinent bis 2050 vervierfachen wird. Und damit die Energiekosten für die Verbraucher. Neben Rechenzentren und KI-Anwendungen gelten Klimaanlagen als die größten zusätzlichen Stromfresser der Zukunft.
Wie der Kühlungs-Hitze-Falle entkommen?
Klimaanlagen zu verbieten wäre eine naheliegende, aber ebenso unüberlegte wie unpraktikable Lösung. Der Bedarf an Kälte wird weiter steigen, schon weil die Weltbevölkerung bis Ende des Jahrhunderts noch einmal um knapp zwei Milliarden anwachsen dürfte – und zwar gerade in jenen Ländern, in denen es jetzt schon sehr warm ist. Die Forscher vom Rocky Mountain Institute schlagen deshalb eine andere Lösung vor: Danach müssten Gebäude deutlich energieeffizienter werden, was für Deutschland bedeutet, nicht nur an Heizungsgesetze zu denken, sondern so zu bauen respektive renovieren, dass auch weniger Kühlung notwendig ist. Städte müssten mehr für „passive Kühlung“ sorgen, sprich: weniger Böden versiegeln, mehr schattenspendende Bäume pflanzen und mehr Dächer begrünen. Und wenn schon gekühlt werden muss, dann sollte die dafür nötige Elektrizität einzig aus erneuerbaren und nicht aus fossilen Quellen stammen.
Vor allem ließe sich die Effizienz heutiger Klimaanlagen verbessern. Die Mehrheit der weltweit installierten Geräte besteht aus relativ simplen, teilweise betagten Kisten, die in Fensteröffnungen eingebaut sind, Kälte nach innen pusten, Wärme nach außen ableiten und stoisch vor sich hinbrummen. Sie gehen verschwenderisch mit Energie um und verbrauchen mehr als doppelt so viel Strom wie Anlagen, die aktuell verkauft werden. Schon eine bessere Wartung der Geräte könnte für eine Stromersparnis von bis zu 20 Prozent sorgen, schreiben die Wissenschaftler des Rocky Mountain Institute.
Die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen würde diese Gewinne allerdings mehr als wettmachen. Deshalb fordern die Experten Geräte, die fünfmal so effizient sind wie die heute üblichen und lediglich ein Fünftel der aktuellen Klimaschäden anrichten. So ließe sich, mit technischen Möglichkeiten, die weitgehend schon heute existieren, aber noch nicht im Einsatz erprobt sind, eine menschenfreundliche Kühlung gewährleisten, die nicht zu einer weiteren Erwärmung der Erde führen würde.
Bei Fragen der praktischen, finanziellen und politischen Umsetzung dieser Strategie bleiben die Autoren allerdings etwas vage. Was den Schluss zulässt, dass nicht jede gute Idee zur Rettung des Weltklimas ein Selbstläufer ist. Die Bemühungen um das Heizungsgesetz der Bundesregierung sind da das denkbar schlechteste Vorbild.
26.04.2024
Aussterben oder Überleben?
Die Diskussion um weltweit sinkende Geburtenziffern ist hysterisch
Vor kurzem beklagte Matthias Rüb, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in einem Beitrag mit dem martialischen Titel „Kultur des Todes“, dass in Italien und anderswo immer weniger Kinder zur Welt kommen. In der Tat gab es im Jahr 2023 zwischen Südtirol und Sizilien nur noch 379.000 Neugeborene. Das seien so wenige wie nie seit der italienischen Staatsgründung als Königreich im Jahr 1861, vermeldet das nationale Statistikamt ISTAT. Und fast nur noch ein Drittel dessen, was es 1964, zum Höhepunkt des italienischen Nachkriegsbabybooms, in den Standesämtern einzutragen gab. Damals wurde in Italien etwas mehr als eine Million Kinder geboren. Italiens Bevölkerung wuchs stark. Die Geburtenziffer lag bei 2,7 Kindern je Frau.
Das müssen wunderbare Zeiten gewesen sein, so könnte man Matthias Rüb interpretieren: Vor allem im Süden Italiens, wo die Bambini-Zahlen damals am höchsten lagen und das Klischee von der kinderreichen Großfamilie noch halbwegs zutraf, waren Arbeitslosigkeit und Armut weit verbreitet und zwangen viele Menschen zur Gastarbeiter-Abwanderung. Der Bildungsstand und die Erwerbsquote von Frauen lagen auf niedrigem Niveau, ebenfalls ein Indikator für hohe Geburtenziffern. In dieser Zeit veröffentlichte Papst Paul VI. seine Enzyklika „Humanae vitae“, auf Deutsch: „Über die Weitergabe des Lebens“. Darin erteilte das Oberhaupt der katholischen Kirche jeder modernen Familienplanung, etwa durch Kondom oder Pille, eine Abfuhr. Er sprach Frauen das Recht auf eine menschenwürdige, freie Entscheidung ab, ob sie durch Geschlechtsverkehr schwanger werden wollten oder nicht.
Hinter der Enzyklika stand die wissenschaftlich schwer zu belegende Vorstellung, menschliches Leben auf der Erde sei gottgewollt und einzigartig und dürfe schon deshalb zahlenmäßig nicht begrenzt werden. Die Frage, warum Gott uns Erdlingen dann nicht auch einen unbegrenzten Planeten geschenkt hat, stellte sich allerdings weder Paul VI. – der auch als „Pillen-Paul“ in die Geschichte einging – noch irgendeiner seiner Nachfolger.
Ebenso wenig die Frage, ob das Verhütungsverbot in den wenig entwickelten Ländern förderlich für die Würde der dort lebenden Menschen war. Dort wuchs die Bevölkerung schneller als die Wirtschaftskraft, der Lebensstandard sank und die Armut nahm zu. Viele Frauen starben in Folge einer Schwangerschaft oder an ihrer letzten Geburt. Deshalb erwog Hans Fleisch, der damalige Geschäftsführer der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW), in den 1990er Jahren ernsthaft, den Nachfolgepapst Johannes Paul II. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor ein internationales Gericht zu ziehen. Die DSW setzt sich für gesundheitliche Aufklärung und den freien Zugang zu Verhütungsmitteln in Entwicklungsländern ein.
Nicht nur in Italien: Geburtenrückgang durch sozioökonomischen Wandel
Doch offenbar interessierte sich gerade in Italien, wo die Menschen mehrheitlich der katholischen Kirche angehören, kaum jemand für die päpstliche Nachhilfe in Sachen Familienplanung: Nach dem Geburtenhoch im Jahr 1964 bekamen die Frauen in Italien immer weniger Kinder, ein Trend, der in allen entwickelten Ländern zu beobachten war. Er wird häufig als Pillenknick bezeichnet, hat aber nur indirekt mit dem damals auf den Markt gekommenen Kontrazeptivum zu tun, sondern viel mehr mit einer veränderten Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Bis 2023 hat sich die Geburtenziffer in Italien gegenüber 1964 auf 1,2 Kinder je Frau mehr als halbiert. 2,1 Kinder wären ohne Zuwanderung für eine mittelfristig stabile Bevölkerung nötig. Wäre die Geburtenziffer so hoch geblieben wie im Rekordjahr 1964, hätte Italien heute rund 30 Millionen Einwohner mehr ̶ und einen um 50 Prozent größeren ökologischen Fußabdruck.
Die Gründe für den universellen Rückgang waren vielfältig: Mit der Modernisierung, mit sich ausbreitendem Wohlstand und Möglichkeiten sein Leben individueller zu planen, mit besserem Zugang von Frauen zu Bildung und Arbeitsmarkt, mit mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wurden die Familien überall kleiner. Manche Bevölkerungsforscher glaubten deshalb an ein demografisch-ökonomisches Paradoxon: Je moderner eine Gesellschaft, desto weniger Nachwuchs habe sie. Der demografische Niedergang sei der Preis für Wohlstand und Gleichstellung. Das war Wasser auf die Mühlen konservativer Kräfte und der katholischen Kirche.
Interessanterweise gibt es aber in weit entwickelten Gesellschaften gar kein demografisch-ökonomisches Paradoxon. Innerhalb der EU jedenfalls liegen die Kinderzahlen je Frau in jenen Ländern am höchsten, wo der Wohlstand (gemessen am Bruttoinlandsprodukt je Einwohner) am höchsten ist, wo die Gleichstellung am weitesten fortgeschritten ist, wo mehr Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am besten organisieren lässt. Diese Bedingungen kennzeichnen die vergleichsweise kinderreichen skandinavischen Länder und Frankreich. Die ärmeren Länder Osteuropas und die katholisch geprägten Länder Südeuropas verzeichnen dagegen die niedrigsten Geburtenziffern.
Der Zusammenhang zwischen der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Fertilität ist somit nicht linear negativ, sondern U-förmig: Zu Beginn der sozioökonomischen Entwicklung, während noch weitgehend patriarchale Strukturen vorherrschen, führen mehr Bildung und mehr Rechte für Frauen zu sinkenden Kinderzahlen. Die Rolle von Frauen zu stärken, kann also in heute noch wenig entwickelten Ländern helfen, das nicht nachhaltige Bevölkerungswachstum zu bremsen. Haben sich die Länder jedoch weitgehend modernisiert, führen die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie gute Betreuungsbedingungen für die Kleinen, die es beiden Elternteilen ermöglichen einer Beschäftigung nachzugehen, zu tendenziell höheren Geburtenziffern.
Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass ein Zurück zur klassischen Aufgabenverteilung, die Frauen vor allem am Herd und bei der Familie sieht, auch ein Zurück zu alten demografischen Verhältnissen bedeuten würde. Insofern dürfte der Aufruf des amtierenden Papstes Franziskus ins Leere laufen, das Kinderkriegen als „patriotische Aufgabe“ zu betrachten, um den „demografischen Winter“ zu beenden. Auch von der Familienpolitik der ob des Geburtenschwunds besorgten italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni sind keine demografischen Erfolge zu erwarten. Ihre Rechtspartei hat als familienpolitische Maßnahme die Mehrwertsteuer auf Windeln und Babymilch halbiert. Das aber dürfte wenig bringen, solange die Kinderbetreuung für viele Familien kaum zu bezahlen ist. Generell gilt: Finanzielle Transferleistungen wie Kindergeld oder Babyprämien können die Nachwuchszahlen kaum erhöhen. Staatliche Zuschüsse für eine familienfreundliche Infrastruktur, die eine Erwerbstätigkeit beider Elternteile ermöglichen, haben einen größeren Effekt.
Geburtenrückgang vermutlich irreversibel
Aber auch in Ländern, die in Sachen Wohlstand, Bildung, Gleichstellung und Familienfreundlichkeit am besten aufgestellt sind, etwa in Island, Dänemark oder Schweden, erreichen die Geburtenziffern nicht mehr die „bestandserhaltende“ Zahl von 2,1 Kindern je Frau. Mit anderen Worten: Wenn es den Menschen bessergeht, sinken die Geburtenziffern. Selbst wenn es ihnen so gut geht wie sonst nirgendwo auf der Welt, beginnt die Bevölkerung zu schrumpfen. Nur Zuwanderung könnte die Verluste ausgleichen.
Mittlerweile verzeichnen über 100 Länder Geburtenziffern von unter 2,1 Kindern je Frau. Weit über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in diesen Ländern, darunter die Milliardenstaaten Indien und China. Bis dato gibt es keinerlei Anzeichen, dass sich dieser Trend wieder umkehrt. Das ist kein Grund zur Panik, sondern so ziemlich die beste Nachricht für einen begrenzten Planeten, der ökologisch längst unter der Last von über acht Milliarden ächzt. Weniger Menschen gerade in den reichen und aufstrebenden Ländern, die am meisten zu den globalen Umweltschäden beitragen, wären ein Segen. Ein Ende des Bevölkerungswachstums aufgrund einer positiven sozioökonomischen Entwicklung ist allemal besser als ein Ende durch Hungersnöte, Kriege oder Seuchen.
Traditionelle Vorstellungen lassen die Bevölkerung schrumpfen
Zweifelsohne bringen rückläufige Geburtenziffern bei steigender Lebenserwartung auch Herausforderungen mit sich: Die Bevölkerung altert. Überall dort, wo sich kopfstarke Jahrgänge in den Ruhestand verabschieden, aber nur schwache besetzte in den Arbeitsmarkt nachwachsen, kommt es zu einem Fachkräftemangel. Mit dem wachsenden Anteil an Ruheständlern entgehen dem Staat Steuereinnahmen. Die Renten- und Gesundheitssysteme lassen sich nicht mehr wie gewohnt finanzieren. Eine schrumpfende Bevölkerung bedeutet zudem eine sinkende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, also weniger Wirtschaftswachstum.
Für Italien mit seiner sehr niedrigen Geburtenziffer von 1,2 Kindern je Frau sind diese Herausforderungen besonders groß. Das Land altert schneller als der Rest Europas und hat den höchsten Anteil an über 65-Jährigen (jeweils dicht gefolgt von Portugal).
Diese Probleme bedeuten freilich keinen Untergang. Vielmehr lassen sie sich auf unterschiedliche Weise abfedern: Erstens durch bessere Bildung, denn so werden die Menschen produktiver und können den demografisch bedingten Arbeitskräftemangel zumindest teilweise auffangen. Sie sind damit zweitens auch in der Lage, länger berufstätig zu bleiben und würden die Systeme der Alterssicherung entlasten. Drittens durch eine Zuwanderungspolitik, die Menschen aus anderen Ländern möglichst schnell und zielgerichtet in den Arbeitsmarkt integriert. Und viertens mit Hilfe einer Familienpolitik, die den heutigen Erwartungen junger Menschen entspricht. Die meisten von ihnen wünschen sich sowohl Kinder als auch eine berufliche Karriere. Und sie wollen, dass sich Frauen und Männer in einer Partnerschaft möglichst auf Augenhöhe begegnen. Nur wo das möglich ist, sinken die Geburtenziffern nicht auf ein sehr tiefes Niveau ab, sondern scheinen sich auf einem Niveau von 1,5 bis 1,8 Kindern je Frau einzupendeln, wie in Schweden, Dänemark oder Frankreich. Unterstützt von Zuwanderung lässt sich die Bevölkerung in derartigen Ländern einigermaßen stabil halten.
Problematischer sieht es in Ländern wie Spanien, Italien, Polen oder der Ukraine aus, wo nur zwischen 1,2 und 1,3 Kinder je Frau zur Welt kommen. Oder in den ostasiatischen Ländern Japan und China, wo die Zahl bei 1,3 respektive 1,1 liegt. In Südkorea, dem weltweiten Schlusslicht, beträgt sie sogar nur gut 0,7. Dort sind die Arbeitszeiten mit einer 52-Stunden-Woche nicht gerade familienfreundlich. Wohnraum und Bildung für den Nachwuchs sind sündhaft teuer. Die gesellschaftlichen Vorstellungen zu Ehe und Partnerschaft sind immer noch konservativ-traditionell und Frauen haben bisher wenig von einer Gleichstellung profitiert. Im „Gender Gap Index 2023“ des Weltwirtschaftsforums, der die Teilhabe der Geschlechter in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Gesundheit und Politik misst, findet sich Südkorea auf Platz 105 von 146 untersuchten Nationen, deutlich hinter Ländern wie Bangladesch oder Madagaskar. Island, Norwegen und Finnland liegen auf den Top-3-Plätzen.
Die Diskriminierung hat zur Folge, dass südkoreanische Frauen sich immer häufiger einer Ehe und Familiengründung verweigern, weshalb Männer (darunter der Präsident) einen schädlichen „Feminismus“ beklagen, was die Geschlechterdisharmonie weiter befördert. Unter diesen Umständen wirken die familienpolitischen Maßnahmen der Regierung geradezu hilflos: Eine 2023 eingeweihte, ultraschnelle U-Bahn in der Hauptstadt Seoul soll die Menschen schneller von der Arbeit nachhause bringen. Die Erwartung ist, dass sie dann mehr Zeit für die Familie haben und so die Geburtenrate erhöhen.
Auch China, wo die Geburtenziffer in den 1960er Jahren noch bei über 6 Kindern je Frau lag und mittlerweile auf 1,1 kollabiert ist, erlebt eine rapide Alterung der Gesellschaft und einen baldigen Mangel an Arbeitskräften. Seit 2011 sinkt die Zahl der Menschen im Erwerbsalter. China droht alt(?) zu werden, bevor es reich ist, und der famose wirtschaftliche Aufstieg des Landes könnte ein jähes Ende finden. Entsprechend besorgt ist die Regierung in Peking mittlerweile. Sie hat nicht nur die lange Zeit geltende rigorose Ein-Kind-Politik gegen eine Drei-Kind-Politik ausgetauscht, sondern Präsident Xi Jinping schlägt mittlerweile auch neue Töne an: Das Land brauche eine andere Art von Geburtenkultur und Frauen sollten sich mehr um „Familienharmonie, soziale Harmonie, nationale Entwicklung und nationalen Fortschritt“ bemühen. Manche Provinzen und auch einzelne Unternehmen zahlen inzwischen Prämien für ein zweites oder drittes Kind oder übernehmen die Kosten für eine künstliche Befruchtung.
Doch ein einzelnes Kind (oder gar kein Nachwuchs) ist in den Köpfen der Chinesinnen und Chinesen längst zur gesellschaftlichen Norm geworden. Die meisten Menschen im Familiengründungsalter sind selbst als Einzelkinder aufgewachsen und können sich ein anderes Dasein gar nicht mehr vorstellen. Zudem sind, ähnlich wie in Südkorea, die Kosten für Kinder enorm, der Arbeitsstress hoch und die Vorstellungen vom Familienleben noch weitgehend patriarchal geprägt.
Kinder zeugen für Putins Kriege
Theoretisch hätten die Länder mit sehr niedriger Fertilität die Chance, mit einer klugen Familienpolitik die Nachwuchszahlen wieder leicht zu erhöhen. Allerdings werden sie es aller Erfahrung nach nicht schaffen, daraus ein Bevölkerungswachstum zu generieren. Von wirklich wirksamen Methoden, die sich an den Interessen der jungen Menschen orientieren, sind sie ohnehin weit entfernt.
Das gilt auch für Russland, das mit ganz eigenen Demografieproblemen zu kämpfen hat, unter anderem, weil im Krieg gegen die Ukraine viele Männer als Kanonenfutter enden. Präsident Putin versucht seine Landsleute seit vielen Jahren zu mehr Nachwuchs zu bewegen. Für das erste Kind gibt es ein „Mutterschaftskapital“ von umgerechnet 6.500 Euro, für das zweite und weitere Kinder von 8.500 Euro, das für die Bildung, eine bessere Wohnung oder die Altersvorsorge genutzt werden kann. Seit 2022 zeichnet Putin Frauen, die zehn oder mehr russische Staatsbürger zur Welt gebracht haben, als „Heldinnen-Mütter“ aus. Nach dem Vorbild von Adolf Hitler, der 1938 das „Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ für mindestens vier „deutschblütige“ Kinder einführte, versucht Putin die Geburtenrate der Russinnen mit Verweis auf die traditionellen Werte „nachhaltig“ zu steigern. Der putinnahe Patriarch Kyrill, Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, würde gerne mit einer Beschränkung von Abtreibungen die Statistik nach oben biegen. Als „langfristiges Ziel“ hat er einen Zuwachs der Bevölkerung von heute 140 Millionen auf 600 Millionen ausgegeben. Eine Vision, die vermuten lässt, dass der Geistliche nicht die geringste Ahnung von demografischen Zusammenhängen hat.
Viel gebracht haben die pronatalistischen Kampagnen allerdings nicht. Seit Beginn des Ukrainekrieges sind die ohnehin schon niedrigen Geburtenziffern weiter gesunken. Dabei hätte der Diktator allen Grund, sich um die Demografie seines Reiches zu kümmern. Viele junge Männer sind an der Front und kommen verletzt oder gar nicht zurück. Wer konnte, hat sich ins Ausland abgesetzt, um dem Militärdienst zu entkommen. Zudem ist die Lebenserwartung in Russland erschreckend niedrig: Männer sterben im Schnitt mit 66 Jahren, oft durch Unfälle und Gewalteinwirkung unter Alkoholeinfluss. Männer in Bangladesch haben sechs Jahre mehr vom Leben.
Ein friedliches Zusammenleben mit den Nachbarstaaten und freie Entfaltungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger würden mit Sicherheit für mehr Nachwuchs sorgen als Putins nationalistische Aufrufe zur Vermehrung. Auch Russland könnte seinen Bewohnern bessere Daseinsbedingungen bieten und für eine zeitgemäße Familienpolitik sorgen. Von den Folgen würde die ganze Welt profitieren.
Wo liegt das Problem, wenn die Zahl der Menschen sinkt?
Ein einfaches Rechenbeispiel soll das verdeutlichen. Angenommen, alle Länder der Welt würde eine Politik betreiben wie die nordischen Länder Dänemark, Schweden oder Island. Dort ist die gesellschaftliche Ungleichheit relativ gering, die Menschen leben auf einem hohen Wohlstandsniveau, sie sind sozial gut abgesichert, haben eine hohe Lebenserwartung, sie können frei und unbeeinflusst über die Größe ihrer Familie entscheiden und gehören zu den glücklichsten Menschen der Welt, wie Umfragen regelmäßig bestätigen. Unter diesen Bedingungen, die sich für irdische Verhältnisse als ideal bezeichnen lassen, bekommen die Frauen aus freien Stücken im Schnitt etwa 1,6 Kinder.
Diese Länder sollten das Vorbild für den Rest der Welt sein. Würden sich die heute armen und wenig entwickelten Länder diesem Ideal annähern, ging die dort noch problematisch hohen Kinderzahlen rasch auf ein nachhaltiges Niveau zurück. In den Ländern mit sehr niedriger Fertilität, von Italien bis Südkorea, würde sich die Position von Frauen in der Gesellschaft verbessern und die Menschen wären zufriedener. Aller Wahrscheinlichkeit nach würden sie dann wieder etwas mehr Nachwuchs in die Welt setzen.
Wären alle Länder bei der Geburtenziffer von Dänemark und Co. angekommen, würde sich die Weltbevölkerung erstaunlich schnell verkleinern. Im Jahr 2300, also in gerade mal 276 Jahren, hätte der Planet weniger als drei Milliarden Bewohner, über fünf Milliarden weniger als heute. Sie wären besser gebildet, im Schnitt älter als heute und schon deshalb friedlicher. Und sie könnten leichter mit den verheerenden menschengemachten Umweltveränderungen klarkommen, die heutige Generationen verursachen, vom Klimawandel bis zum Massenverlust von Tier- und Pflanzenarten. Der Bevölkerungsrückgang würde die Weiterexistenz der Spezies Homo sapiens erheblich vereinfachen.
Kleinere Familien haben also eher mit Überleben als mit Aussterben oder einer „Kultur des Todes“ zu tun. Bevölkerungsrückgang ist kein Drama. Drei Milliarden Menschen hat es schon mal gegeben, nämlich im Jahr 1960. Das ist gar nicht lange her.
15.04.2024
Sind E-Autos Schimpansenkiller?
Die grüne Energieversorgung benötigt Unmengen kritischer Mineralien – deren Förderung zerstört oft tropische Naturräume, auf die unsere engsten biologischen Verwandten angewiesen sind
Der Klimawandel zwingt uns zum Abschied von den fossilen Energieträgern. Gelingen soll der vor allem mit „grünen“ Technologien wie Windkraft und Solarenergie, mit regenerativ hergestelltem Wasserstoff, mit E-Autos und Batterien als Speichermedien für jene Phasen, in denen Sonne und Wind nicht liefern können.
Diese grundsätzliche Umstellung der Energiewirtschaft erfordert große Mengen sogenannter kritischer Metalle: Kupfer und Kobalt, Nickel und Lithium, Indium, Gallium oder Neodym und viele mehr. Und die gibt es als metallführende Gesteine nicht in Lagerstätten im Erzgebirge oder im Schwarzwald, zumindest nicht in wirtschaftlich förderbaren Mengen. Sie liegen im Untergrund von China, Indonesien, afrikanischen oder südamerikanischen Ländern, häufig in sensiblen, wenig erschlossenen, noch halbwegs intakten Naturräumen mit einzigartiger Artenvielfalt. Manche dieser oftmals armen Regionen erleben aufgrund der grünen Wünsche der reichen Länder gerade einen regelrechten Rohstoffboom – mit fatalen Folgen für die dort lebenden Tiere und Pflanzen.
Im Fachblatt Science berichtet ein 16-köpfiges internationales Forschungsteam jetzt von der Gefahr für die letzten Populationen von Menschenaffen in Afrika durch die Bemühungen der Industrienationen ihre Wirtschaft zu dekarbonisieren. Noch steht in Afrika ein Sechstel aller verbliebenen Wälder auf Erden. Ein Viertel aller wildlebenden Säugetiere findet hier ein Zuhause, darunter die Primaten oder Hominiden, die als eine der gefährdetsten aller Tierordnungen gelten (für die Primatenspezies Homo sapiens gilt diese Einstufung allerdings nicht.) Der Studie zufolge ist bis zu einem Drittel der afrikanischen Schimpansen- und Gorilla-Populationen durch den Bergbau bedroht. Ähnliches dürfte für die letzten verbliebenen Orang-Utan-Bestände in Indonesien gelten, die zwar nicht Teil der Untersuchung waren, jedoch teilweise in Gebieten leben, in denen große Kobalt- und Nickel-Vorkommen erschlossen werden.
Rohstoffboom mit Schattenseiten
Nun sind Schimpansen und Gorillas, ähnlich wie Pandabären oder Wale, medienwirksame Vorzeigespezies, wenn es um Artenschutz geht. Doch wenn ihr Lebensraum, in der Regel Regenwald, schwindet, gehen ganze Ökosysteme und tausende weniger spektakuläre Spezies über den Jordan. Der dringend notwendige Umbau der Energieversorgung, der, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich zu Protokoll gab, „richtig gut“ laufe, hat also seine Schattenseiten. Zumal der beschriebene Rohstoffboom in Afrika erst der Anfang sein dürfte: Der Kontinent birgt 30 Prozent aller weltweiten Mineralienvorräte, aber bisher stammen von dort weniger als 5 Prozent der globalen Fördermengen. Der „return on investment“, also die Rendite, die sich Investoren von dem Abbau versprechen können, liegt in Afrika so hoch wie sonst irgendwo, nämlich bei sagenhaften 38 Prozent.
Weil die Energiewende gerade erst begonnen hat, wird sich der Bedarf kräftig erhöhen. So liegt die Weltproduktion von Kupfer heute bei 20 bis 25 Millionen Tonnen pro Jahr. In 60 Jahren sind Prognosen zufolge 70 bis 100 Millionen Tonnen jährlich? vonnöten. Der Bedarf an Nickel dürfte sich Schätzungen zufolge verdreißigfachen, der von Lithium fast verzweihundertfachen.
Artenschwund durch Energiewende
Nach Angaben der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) sind Primaten überwiegend gefährdet durch Abholzungen, Brandrodungen und die sich ausbreitende Landwirtschaft. Bergbau gilt bisher nur als das Viertschlimmste, was Schimpansen und Gorillas passieren kann. Das Problem ist allerdings, dass für den Abbau von Erzen Straßen und Bahnlinien in den Wald geschlagen werden, was auf Satellitenbildern gut dokumentiert ist und Holzfäller, Wilderer und Bauern nach sich zieht. Sind die Explorateure und Ausbeuter erst einmal vor Ort, wird wie wild gebaggert und gesprengt, was mit Lärm und Zerstörung, mit Bodenerosion und der Vergiftung von Gewässern verbunden ist und zuvor kaum gestörte Primatenpopulationen vertreibt. Zusätzlich bedroht werden die Menschenaffen durch Wilderer und eingeschleppte Krankheiten.
Bergbau ist also für die nächsten Verwandten des Menschen weitaus problematischer, als es auf den ersten Blick erscheint, zumal die durch die Suche nach Mineralien ausgelöste Waldvernichtung in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen hat.
Gleichzeitig zeigen die am Abbau beteiligten Unternehmen bisher wenig Interesse, die Folgen ihrer Aktivitäten analysieren zu lassen, geschweige denn sie umweltfreundlicher zu gestalten: Gerade mal fünf Prozent von 400 untersuchten Firmen haben gemäß eines Reports der World Benchmarking Alliance eine wissenschaftliche Umweltbewertung ihrer Geschäftsmodelle erstellen lassen. Unter anderem deshalb wurde bisher völlig unterschätzt, welche Gefahr von dem Bergbau für die Primatenbestände Afrikas ausgeht. Entsprechend wenig erforscht ist, wie sich die Menschenaffen besser vor dem Verlust ihrer Lebensräume schützen ließen oder zumindest in Ersatzquartiere ausweichen könnten.
Um herauszufinden, wie stark die Primaten durch den Mineralienabbau gefährdet sind, haben die Wissenschaftler für ihre Studie Daten aus 17 Staaten in West-, Zentral- und Ostafrika über eine Fläche von 1,5 Millionen Quadratkilometern ausgewertet. Am stärksten unter Druck geraten Schimpansen in Westafrika, wo auch die größte Zahl der Bergbaugebiete liegt. 82 Prozent der Schimpansen-Bestände leben im kritischen Umkreis von aktiven beziehungsweise geplanten Abbauzonen.
Insgesamt sehen die Forscher kaum Möglichkeiten die heutigen, ohnehin schon stark dezimierten Primatenbestände zu erhalten, es sei denn, die Erzförderer dringen gar nicht erst in die Lebensräume der Menschenaffen ein. Naheliegend ist deshalb der Appell der Forscher an Kreditgeber wie die Weltbank, nur Projekte zu finanzieren, bei denen vorher sichergestellt ist, dass sie schützenswerte Flora und Fauna nicht schädigen. Im besten Fall bedeutet das, sensible Ökosysteme einfach in Frieden zu lassen. Die Studie verdeutlicht auf Grundlage akribischer Berechnungen, welche gravierenden Folgen das für die Produktion der für die Energiewende so wichtigen Mineralien hätte: Würden die Exploratoren sich von all jenen Gebieten fernhalten, in denen eine Gruppe von mindestens 20 Affen lebt, müssten 38 Prozent aller Abbauprojekte auf Eis gelegt werden.
Wenn Klimaschutz das Gegenteil bewirkt
Die Studie bezeugt auch ein Paradoxon der Klimapolitik: Mit der Energiewende lässt sich theoretisch das CO2-Problem lösen, also die Emission des wichtigsten Treibhausgases minimieren. Aber gleichzeitig brockt man sich damit eine ganze Latte von neuen Problemen ein. Denn die Nachfrage der reichen Länder mit schlechtem (Umwelt-)Gewissen und dem Wunsch den Klimawandel einzuhegen, bedeutet fast zwangsläufig die Zerstörung tropischer Hotspots der Artenvielfalt, deren Weiterexistenz ähnlich wichtig ist wie ein stabiles Weltklima.
Die Wissenschaftler der Studie halten es zudem für möglich, dass die Folgeerscheinungen des unter dem Mantel des Klimaschutzes propagierten Rohstoffabbaus letztlich mehr Klimaschaden anrichten, als die kritischen Mineralien im Rahmen der Energiewende vermeiden können. Denn die Erschließung bislang wenig gestörter Regenwaldgebiete, in denen eindringende Holzfäller und brandrodende Bauern erhebliche Waldverluste verursachen, befördert große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre. Gehen die Wälder in tropischen Regionen verloren, fehlt ein wichtiger Puffer, der das Weltklima stabilisieren kann. Bislang, und ohne Rohstoffabbau, sind diese Gebiete jedenfalls relativ gut geschützt. In Afrika beispielsweise werden die potenziellen Ausbeutungsflächen zu 77 Prozent von einer geringen Zahl von Indigenen und Subsistenzbauern mit kleinen Agrarflächen bewohnt, die kaum Schaden an der Umwelt anrichten können.
20.02.2024
Wenn’s kippt, wird’s kritisch
Aber wenn sich unser Verhalten ändert, kann alles besser werden
Wie schnell sich die Menschheit aus ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen lösen kann, wird die Zukunft von Milliarden von Erdenbewohnern bestimmen. Das ist keine Panikmache, sondern die nüchterne Schlussfolgerung des Reports einer internationalen über 200-köpfigen Wissenschaftlergruppe um Forscher vom Global Systems Institute der britischen Universität Exeter in Partnerschaft mit dem Bezos Earth Fund. Im Zentrum des Reports steht die Sorge, dass durch multiple Umweltschäden bestimmte Bestandteile des Erdsystems – sogenannte Kippelemente – abrupt instabil werden, mit verheerenden Folgen.
Ein Kippelement ist mit einem Holzbalken vergleichbar. Man kann ihn über eine Kante schieben und nichts passiert. Aber von einem Zehntel Millimeter zum nächsten, am so genannten Kipp-Punkt, bekommt er ein Übergewicht und stürzt ab. Wissenschaftlich betrachtet ist dies ein typischer nichtlinearer Prozess. Für Menschen im Allgemeinen und Politiker im Besonderen ist das eine große Herausforderung, denn unsere Lebenserfahrung und unser Denken sind in der Regel linear geprägt.
Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Kipp-Punkten, die irreversible Veränderungen nach sich ziehen und fatale Kaskadeneffekte auslösen können. Der „Global Tipping Points Report“ warnt vor 26 solchen negativen Kipp-Punkten, die erreicht werden, wenn die Menschheit weiterhin so liederlich mit dem blauen Planeten umgeht wie bisher: Etwa das Abschmelzen größerer Eispanzer wie in Grönland, das Auftauen der Permafrostgebiete im hohen Norden, der Zusammenbruch der Atlantischen Zirkulation, das Absterben des Amazonas-Regenwaldes oder der Verlust der Korallenriffe in den immer wärmeren Ozeanen.
Die genannten fünf wichtigen Kipp-Punkte dürften bald erreicht sein, was dem Globus weiter einheizen würde. Für drei weitere gilt das, sollte die Erderwärmung längerfristig über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau steigen. Dieser Zustand ist in wenigen Jahren zu erwarten. Bei 2 Grad Erwärmung wird es endgültig kritisch: In diesem Fall würden ganze Ökosysteme zusammenbrechen, die weltweite Nahrungsmittelproduktion wäre gefährdet, Menschen müssten in großen Zahlen ihre angestammte Heimat verlassen. Denn werden erst einmal ökologische Kipp-Punkte erreicht, beginnen auch politisch-soziale Systeme zu kippen: Demokratische Regierungen verlieren an Stabilität, Unruhen und Konflikte drohen. Die Welt sei auf einem verheerenden Weg, schreiben die Autoren des Reports. Die Erdsysteme drohten sich zu verändern, wie es die Menschheit noch nicht erlebt hat.
Bitte ab sofort in die andere Richtung kippen
Aber Kipp-Punkte können auch Hoffnungsanker sein, schreiben die Wissenschaftler. Nämlich, dann, wenn sie nicht ins Chaos führen, sondern – umgekehrt – wünschenswerte Effekte für Gesellschaften hervorrufen, die sich gegenseitig verstärken. Die Geschichte der Menschheit ist voll von abrupten sozialen und technologischen Veränderungen, die das Leben maßgeblich verbessert haben. Ein historisches Beispiel für das Zusammenwirken zweier positiver Kippelemente war die Erfindung des Buchdrucks und die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther vor über 500 Jahren. Beide Elemente waren die Voraussetzung für die Reformation. Die gedruckten Worte zogen eine Alphabetisierungskampagne für die breiten Massen nach sich und eine Bildungsrevolution in den reformierten Gebieten, die letztlich zu den Wissensgesellschaften westlicher Prägung führten, mit all ihren Errungenschaften.
Positive Kipp-Punkte können sich (genau wie die negativen) gegenseitig verstärken. Sie können Gesellschaften in der aufziehenden Ära des raschen Wandels der Umweltbedingungen resilienter machen und ganze Volkswirtschaften in Richtung einer nachhaltigen Zukunft lenken. Wenn sich beispielsweise Elektroautos irgendwann durchsetzen, werden Batterien leistungsstärker und billiger. Mit günstigeren Batterien lässt regenerativ erzeugter Strom einfacher speichern, wenn die Sonne im Übermaß scheint oder der Wind heftig weht. Mit dieser „grünen“ Energie ließen sich dann Stickstoffdünger, Stahl oder synthetische Treibstoffe herstellen, ohne dass fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen müssten. Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft käme voran. Die Wahrscheinlichkeit, dass negative Kipp-Punkte erreicht werden, sänke. Flankierend müssten allerdings auch die Entwaldung, die Emissionen des Klimagases Methan und der Artenschwund gestoppt werden, um die Ökosysteme insgesamt zu stabilisieren, schreiben die Autoren. Auch die globale Landwirtschaft und die Ernährungsgewohnheiten der Menschen warteten bislang noch vergebens auf positive Kipp-Punkte.
Immerhin scheint ein wichtiger positiver Kipp-Punkt mittlerweile erreicht: Durch vielfältige staatliche Förderung von regenerativen Energien sei es mittlerweile günstiger geworden, Wind- und Solarparks zu bauen als Kohle, Öl oder Gas zu verbrennen. Kein Wunder, dass bereits im Jahr 2022 rund 80 Prozent der weltweit neu installierten Stromerzeugungskapazität auf regenerativen Quellen fußten.
Das Gute an positiven Kipp-Punkten ist, dass es, wenn sie fast erreicht sind, nur noch einen kleinen Anschub braucht, um einen bedeutenden Effekt zu erzeugen. Diesen Umstand sollte die Politik ausnutzen, um notwendige Veränderungen im Rahmen der ökologischen Transformation schnell und effizient auf den Weg zu bringen. Ebenso können sich soziale Normen und Verhaltensmuster unter geeigneten Rahmenbedingungen rasch verändern.
Ein Problem bleibt: Die negativen Kipp-Punkte im Erdsystem werden erreicht, weil die Menschen bislang zu wenig unternehmen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Diese weitgehende Untätigkeit, also „business as usual“, frei übersetzt „Weiterwurschteln wie bisher“, führt so von ganz alleine ins Desaster. Positive Kipp-Punkte hingegen stellen sich nicht von alleine ein. Um sie zu erreichen, ist aktives Handeln vonnöten: politische Aktion, Verhaltensänderungen in der Bevölkerung, technische Innovation und die entsprechenden Finanzierungen. Genau dabei aber sind wir Menschen bislang ziemlich schlecht aufgestellt.
Bisher sei die Welt im Blindflug unterwegs, heißt es im Resümee des Reports. Wir müssten unser Verständnis von Kipp-Punkten verbessern, um die mit ihnen verbundenen Gefahren einzuhegen und die Chancen zu nutzen. Und zwar unverzüglich.
07.02.2024
Wirre Remigrations-Phantasien
Wer will schon in einem Altersheim mit völkischer Identität leben?
Nicht erst seit einem jüngst aufgeflogenen Treffen konservativer C-Intellektueller in einer Villa am Potsdamer Lehnitzsee geistert die Vorstellung durch die Lande, Deutschland sei „überfremdet“. Damit ist gemeint, die Gemeinschaft, die Identität, ja die ganze Nation sei von Einflüssen aus dem Ausland, also von Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen bedroht und letztlich dem Untergang geweiht. Also wäre es besser das Fremde wieder loszuwerden, will heißen, Menschen aus anderen Ländern oder mit Vorfahren aus anderen Ländern zur „Remigration“ zu veranlassen.
Einmal davon abgesehen, dass Kultur immer Wandel bedeutet, dass sie von Vielfalt profitiert und äußere Einflüsse überaus hilfreich sein können, stellt sich eine grundsätzliche Frage: Wäre die Reinigung des „deutschen Volkskörpers“ von ausländischen Einflüssen durch Remigration, sprich: angeordnete Auswanderung oder Vertreibung, überhaupt praktikabel oder sinnvoll?
Zunächst ein paar Zahlen als Diskussionsgrundlage: In Deutschland leben insgesamt 84,6 Millionen Menschen (Stand Januar 2024), so viele wie nie zuvor. Das ist erstaunlich, denn seit 1972 versterben zwischen Rügen und dem Bodensee in jedem Jahr mehr Menschen als geboren werden. 1972 hatte das Land (Ost und West zusammengerechnet) gerade mal 78,6 Millionen Einwohner. Wir müssten heute also längst deutlich weniger sein. Es ist allein der Zuwanderung zuzurechnen, dass die Bevölkerung nicht geschrumpft, sondern seither um sechs Millionen Köpfe angewachsen ist.
Bunte Republik Deutschland
Rund 13,4 Millionen der hierzulande gemeldeten Menschen leben mit einem ausländischen Pass, das sind knapp 16 Prozent der Bevölkerung. Sie stammen vor allem aus der Türkei, der Ukraine, Syrien, Rumänien und Polen. Sie allein sind ein Dorn im Auge der Remigrations-Befürworter. Neben dieser ausländischen Bevölkerung gibt es zusätzlich fast elf Millionen Personen mit ausländischen Wurzeln, die mittlerweile rechtmäßig die deutsche Staatsbürgerschaft erworben („erschlichen“ im Jargon der Remigrationsszene) haben, oder deren Kinder, die qua Geburt auf Wunsch der Eltern Deutsche werden konnten. Dabei handelt es sich dem Gesetz nach um ganz normale Deutsche, auch wenn sie Özdemir, Podolski, Gnabry oder Chialo heißen.
Zusammengerechnet ergibt das rund 24 Millionen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Das sind Personen, die mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden oder bei denen das für mindestens einen Elternteil gilt, ganz egal, ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht. Insgesamt haben damit über 28 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. Bei den jüngeren Generationen beträgt der Anteil etwa ein etwa 33 Prozent, weil Zugewanderte im Schnitt rund 13 Jahre jünger sind als die Alteingesessenen und tendenziell etwas mehr Kinder in die Welt setzen als diese. Deutschland ist somit eine ziemlich bunte Republik, auch wenn manch konservativer Politiker bis vor wenigen Jahren wähnte, das Land sei kein Zuwanderungsland.
Keine Rechtsgrundlage für Remigration
Da gäbe es also Einiges zu tun, wollte man der Vorstellung Martin Sellners von der in Deutschland als rechtsradikal eingestuften Identitären Bewegung in Österreich folgen, der auf dem Potsdamer Treffen laut Correctiv vorgetragen haben soll, wie er Millionen von „Asylbewerbern, Nicht-Staatsbürgern und nicht assimilierten Staatsbürgern“ loszuwerden gedenke.
Auch wenn es gar keine Rechtsgrundlage für diese Art von Vertreibung gibt, sollte man sich einmal ausmalen, wie Deutschland aussähe, könnte man all diese Menschen ausweisen oder hätte sie gar nicht erst reingelassen ins Land? Sagen wir seit 1972 (also erst nach Phase der „Gastarbeitermigration“), dem Jahr, als die Geburtenziffer erstmals unter den Wert von 2,1 Kindern je Frau gefallen ist, der mittelfristig für eine stabile Bevölkerungszahl notwendig wäre. Dem Jahr, in dem erstmals mehr Menschen verstarben als Neugeborene hinzukamen.
Deutschland sähe mit Sicherheit anders aus: Es gäbe schätzungsweise 20 Millionen Einwohner weniger, wobei sich der Schwund von Jahr zu Jahr beschleunigen würde. Viel Platz also, kein Wohnungsmangel, aber auch eine deutlich weniger leistungsfähige und international kaum noch wettbewerbsfähige Wirtschaft. Arbeitskräfte würden in sämtlichen Branchen fehlen, vor allem im medizinischen Bereich und in der Pflege, denn die Bevölkerung wäre im Schnitt wesentlich älter, als sie es heute ohnehin schon ist. Vor allem das wirtschaftsstarke Baden-Württemberg, das wie kein anderes Bundesland auf Arbeitskräfte mit ausländischen Wurzeln angewiesen ist, könnte die meisten Industriebetriebe dicht machen. Die Fußball-Nationalmannschaft würde noch weniger Tore schießen. Renten- und Gesundheitssysteme müssten ihre Leistungen einschränken, weil sich die Zahl der Einzahler gegenüber den Leistungsempfängern dramatisch verringern würde. Und spätestens wenn die große Gruppe der biodeutschen Babyboomer sich bis 2030 komplett in den Ruhestand verabschiedet hat, gliche das Land einem Seniorenheim mit völkischer Identität.
07.01.2024
Klimakiller Wohlstand
Spitzenverdiener schaden der Umwelt am meisten - und dabei Jüngere mehr als die Älteren
Die gerade veröffentlichte Umfrage stammt zwar aus der Schweiz, aber sie dürfte auch für Deutschland repräsentativ sein: Das Meinungsforschungsinstitut Sotomo wollte herausfinden, wie klimafreundlich (eigentlich müsste es heißen: klimafeindlich) sich verschiedenste Bevölkerungsgruppen in der Eidgenossenschaft verhalten. Das Ergebnis ist ernüchternd: Es wirft Zweifel auf, ob die Menschen in der Schweiz und anderen reichen Ländern überhaupt zu einem wirksamen Klimaschutz in der Lage sind.
Die repräsentative Befragung von 3.000 Schweizerinnen und Schweizern im Auftrag des Energieunternehmens Helion liefert erstmals ein detailliertes Bild des CO₂-Fußabdrucks unterschiedlicher sozioökonomischer Kohorten. Die Erkenntnisse in aller Kürze:
– Junge Erwachsene (18 bis 35 Jahre) haben unter allen Altersklassen die höchsten Treibhausgasemissionen zu verantworten.
– Personen mit hohem Einkommen (monatlich über 16.000 Schweizer Franken) tragen besonders stark zum Klimawandel bei.
– Ob die Befragten in Städten oder auf dem Land wohnen, macht praktisch keinen Unterschied bei den Emissionen.
– Insgesamt hält sich die Mehrheit der Befragten für klimafreundlicher, als sie tatsächlich sind.
– Die Bereitschaft zu klimaschonenden Verhaltensänderungen ist gering. 59 Prozent der Befragten geben zu Protokoll, dass sie das Thema Klimawandel mittlerweile nervt.
Wer will schon aufs Autofahren, Fliegen und Shoppen verzichten?
Diese fünf Kernpunkte mögen nur bedingt überraschen. Umso interessanter sind die Details der Studie. Während der oder die Durchschnittsschweizer/in auf eine jährliche Gesamtemission von 10,5 Tonnen CO₂ kommt, macht schon das Geschlecht einen kleinen Unterschied: Männer sind etwas klimaschädlicher als Frauen. Sie besitzen häufiger Autos, sie fahren auch mehr damit herum und sie essen mehr Fleisch als Frauen.
Deutlicher wird der Unterschied bei den Altersgruppen: Die 18- bis 35-Jährigen (die Generationen Greta, X oder Y, denen mitunter ein besonderes Umweltbewusstsein zugeschrieben wird) kommen im Schnitt auf 11,3 Tonnen CO₂, die über 55-Jährigen (darunter die Boomer als vermeintliche Umweltschweine) nur auf 9,8 Tonnen. Die Hauptgründe für den größeren ökologischen Fußabdruck der jüngeren Frauen und Männer sind deren hohe Freude an Flugreisen und am intensiven Shoppen. Für den angerichteten Klimaschaden sind allerdings nicht alle 18- bis 35-Jährigen gleichermaßen verantwortlich. Nur ein Viertel von ihnen emittiert besonders viel CO2 und zieht damit den Schnitt nach oben, beziehungsweise den Ruf der Jungen als Umweltsünder nach unten. Die beste CO₂-Bilanz aller untersuchten Gruppen haben ältere Frauen (über 65 Jahre). Sie fliegen am seltensten, fahren am wenigsten Auto und konsumieren verhalten.
An diesen Ergebnissen zeigt sich bereits deutlich, wie stark das Einkommen den Fußabdruck beeinflusst. Einkommen fließt zu einem guten Teil in den Konsum und wer viel konsumiert, emittiert auch viel. Der CO2-Ausstoß steigt kontinuierlich mit dem verfügbaren Einkommen, geht aber ab einer bestimmten Höhe geradezu durch die Decke. Wer richtig viel verdient, fährt die dicksten Autos, konsumiert kräftig, fliegt am meisten und über die größten Distanzen. Auch wenn es niemand hören will: Wohlstand bedeutet Klimaschaden.
Die Studie hat vor allem die Emissionen in den wichtigsten Bereichen Wohnen, Mobilität und Konsum untersucht. Interessanterweise zeigt sich beim Wohnen nicht der erwartete Einkommenseffekt. Der Wohn-Fußabdruck wächst von den tiefen zu den mittleren Einkommen, sinkt dann aber wieder. Das liegt daran, dass Personen mit sehr hohen Einkommen zwar größere Wohnungen haben, jedoch über modernere und weniger klimaschädliche Heizungen verfügen, die häufiger mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ärmere hingegen leben oft in kleinen, aber schlecht isolierten Altbauwohnungen. Ganz so harmlos dürfte das Wohnen der Reichen allerdings doch nicht sein, wie die Studienautoren anmerken: Zweitwohnungen, Yachten oder Hotelübernachtungen (ein nicht unerheblicher Konsumfaktor bei den Wohlhabenden) konnten in der Untersuchung nicht berücksichtigt werden.
Wo aber leben die klimafreundlicheren Menschen in der Schweiz, in den urbanen Agglomerationen oder auf dem Land? Immerhin sind Städter häufiger im emissionsarmen öffentlichen Nahverkehr unterwegs, während Landbewohner oft per Auto über längere Strecken zur Arbeit pendeln. Doch der Umweltvorteil der Städter egalisiert sich komplett dadurch, dass sie häufiger in den Flieger steigen. Ergebnis: Gleichstand.
Die meisten Befragten halten sich für klimafreundlicher, als sie sind
Insgesamt gehört die Schweiz zu den klimaschädlicheren Nationen weltweit. Zwar feiert sich das Land gerne für seine in vielen Statistiken vermeldeten geringen CO2-Emissionen von rund vier Tonnen CO2 pro Kopf. Das liegt vor allem daran, dass in dem Alpenland viel regenerative Wasserkraft genutzt wird. Bei diesen Statistiken werden allerdings nur die Emissionen berücksichtigt, die im Land selbst stattfinden, aber nicht jene, die in anderen Ländern bei der Produktion von Gütern anfallen, die in der Schweiz konsumiert werden. Die Eidgenossenschaft importiert jedoch sehr viele Waren, die sich irgendwo auf der Welt billig und im Zweifel klimaschädigend herstellen lassen. Im Gegenzug exportiert sie nur hochveredelte, teure Produkte, etwa Uhren oder Arzneimittel, bei deren Herstellung kaum Treibhausgase anfallen. Korrekterweise berücksichtigt die Sotomo-Studie die gesamten konsumbedingten Emissionen. Und die sind mehr als dreimal höher als die „territorialen“ Emissionen. Im Vergleich dazu sind die Deutschen etwas weniger klimaschädlich, was kein Wunder ist, denn sie sind auch weniger wohlhabend: Das an die Kaufkraft angepasste Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt Deutschlands liegt um 23 Prozent unter jenem ihrer schweizerischen Nachbarn.
Doch nicht nur die offizielle Statistik schätzt anhand der territorialen Emissionen ihren Einfluss auf den Klimawandel falsch ein, auch die Schweizerinnen und Schweizer lügen sich quer durch alle Bevölkerungsgruppen in Sachen Klimaschutz gerne in die Tasche: So schätzt die Hälfte von ihnen ihr eigenes Verhalten als überdurchschnittlich klimafreundlich ein. Auf die Frage, ob sich die Bevölkerung insgesamt eher oder sehr klimafreundlich verhält, antwortet indes nur ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer mit Ja. Es sind also immer die anderen, die den Schaden anrichten. 56 Prozent schätzen ihr eigenes Verhalten als klimafreundlicher ein als das der Gesamtbevölkerung. Gerade einmal 10 Prozent der Befragten denken, dass sie sich weniger klimafreundlich verhalten als
die Bevölkerung als Ganzes. Besonders groß ist der Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und dem tatsächlichen Verhalten bei Personen mit hohem Einkommen.
Lieber technische Lösungen als das eigene Verhalten ändern
Wie weit Wunsch und Wirklichkeit auseinanderliegen, zeigt sich auch in der Einschätzung der Befragten, wonach es beim Kampf gegen den Klimawandel zu langsam vorangeht. Dabei setzen sie vor allem auf neue Technologien und weniger auf Eigenverantwortung und Regulierungen. Zwei Drittel wollen, dass die Energieerzeugung aus Wind und Sonne ausgebaut wird, aber weniger als die Hälfte glaubt, dass sie ihr eigenes Verhalten ändern sollte. Rund zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer geben zu Protokoll, dass sie in den Bereichen Konsum, Wohnungsheizung und bei Flugreisen ihr Verhalten bereits angepasst haben – eine Behauptung, die sich an den Emissionen keineswegs ablesen lässt.
Lässt sich daraus schließen, dass die Menschen in der Schweiz selbstzufrieden sind? Vermutlich ja. Eine letzte Frage in der Erhebung liefert dazu einen interessanten Einblick. Sie lautete: „Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Klimawandels (zum jetzigen Zeitpunkt / in 20 Jahren) auf die Lebensumstände der Bevölkerung (an Ihrem Wohnort / in der gesamten Welt) ein?“ Die mehrheitliche Antwort war, dass die Auswirkungen der Erderwärmung eher im fernen Ausland zu spüren sein werden und weniger in der helvetischen Heimat.
31.12.2023
Freie Wahl? Fehlanzeige
Wie konservative US-Regierungen weltweit in Rechte von Frauen eingreifen
GASTBLOG VON SABINE SÜTTERLIN
Wenn eine Frau in Malawi, die schon sechs Kinder zur Welt gebracht hat, keinen weiteren Nachwuchs möchte, diesen Wunsch aber nicht in aller Entscheidungsfreiheit umsetzen kann, dann haben womöglich die USA die Finger im Spiel. Und das, obwohl das kleine ostafrikanische Land ein souveräner, halbwegs demokratischer Staat ist.
Wie ist das möglich? Als Donald Trump 2017 US-Präsident geworden war, bestand eine seiner ersten Amtshandlungen darin, eine verschärfte Form der „Mexico City Policy“ wieder in Kraft zu setzen. Diese gilt Kritikern auch als „Global Gag Rule“, zu Deutsch etwa „Weltweite Knebelungsregel“. Geknebelt werden dabei internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die sich mit finanzieller US-Unterstützung um die Gesundheitsversorgung in wenig entwickelten Ländern kümmern. Die betreffende NGO muss nachweisen, dass sie „Abtreibung als Methode der Familienplanung in anderen Nationen weder vornimmt noch aktiv begünstigt“, sonst gibt es kein Geld. Darüber hinaus darf die Organisation ihre Mittel – aus US- wie auch aus anderen Quellen – nicht dafür verwenden darf, über Abtreibung auch nur neutral zu informieren. Oder sich bei der Regierung des Landes, in dem sie tätig ist, für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einzusetzen.
Hü und Hott zwischen Demokraten und Republikanern
Die Regel geht auf Ronald Reagan zurück, der sich vom Hollywood-Schauspieler mit liberaler Haltung zum konservativen Politiker und Anhänger der „Pro-Life“-Bewegung gewandelt hatte. Als Gouverneur von Kalifornien (1967 bis 1975) hatte er noch ein für die damalige Zeit sehr liberales Abtreibungsgesetz abgezeichnet. Unter seiner Präsidentschaft (1981 bis 1989) aber kündigte die US-Regierung 1984 anlässlich der Weltbevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen (UN) in Mexiko-Stadt besagte Regelung an. Im Jahr darauf trat diese in Kraft.
Seither setzte noch jeder Präsident mit Demokraten-Parteibuch, kaum war er ins Weiße Haus eingezogen, die „Mexico City Policy“ aus, jeder republikanische Amtsinhaber erneuerte sie sogleich wieder. Dabei kam sie bis 2009, zum Ende der Regierung von George W. Bush, nur für Organisationen zur Anwendung, die Programme für Familienplanung und reproduktive Gesundheit anbieten. 2017 weitete die Trump-Regierung die Auflagen für die Förderung auf den gesamten Bereich Gesundheitsversorgung aus: Unter der neuen Überschrift „Protecting Life in Global Health Assistance“ (PLGHA) galten die Restriktionen jetzt auch für jedwede internationale NGO, die sich beispielsweise für Kinder- und Müttergesundheit einsetzt, für Ernährung, für Prävention und Behandlung von Malaria oder HIV/Aids.
Schwerwiegende Folgen für Afrika südlich der Sahara
Ein Forschungsteam um die Gesundheits-, Umwelt- und Entwicklungsökonomin Nina Brooks von der Boston University hat jetzt die Auswirkungen von Trumps PLGHA-Politik auf Anbieter von Gesundheitsdiensten und auf Frauen in acht Ländern Subsahara-Afrikas untersucht. Sie haben dafür Daten ausgewertet, etwa zur generellen Verfügbarkeit von modernen Mitteln der Familienplanung, zu Auftreten und Dauer von Versorgungslücken oder zum Angebot von Dienstleistungen rund um Schwangerschaft, Geburt und HIV/Aids. Das Ergebnis, auf den Punkt gebracht: Unter der PLGHA-Politik bieten Gesundheitseinrichtungen weniger Dienstleistungen im Bereich Familienplanung an, einschließlich der Notfallverhütung, also der „Pille danach“. Entsprechend nutzen Frauen seltener moderne Methoden zur Empfängnisverhütung, werden also tendenziell häufiger schwanger – ob sie wollen oder nicht.
Damit verfehlt die PLGHA-Politik das in ihrer Bezeichnung formulierte Ziel, „Leben zu schützen in der weltweiten Gesundheits-Entwicklungszusammenarbeit“, und hat unbeabsichtigte schädliche Folgen, wie die Autoren der Studie in „Science Advances“ schreiben: Sie verhindert über Abtreibungen hinaus auch den Zugang zu modernen Mitteln der Familienplanung und greift damit tief in die reproduktive Gesundheit, die Entscheidungsfreiheit und damit das Leben von Frauen in weit von den USA entfernten Ländern ein.
Geburtenkontrolle und Bevölkerungswachstum – lange umstrittenes Thema
Wie kam es, dass die Reagan-Regierung ihre Politik zur globalen Einschränkung von Schwangerschaftsabbrüchen bei der „International Conference on Population“ ankündigte? Bei dem Treffen 1984 in Mexiko-Stadt ging es eigentlich um Bevölkerung. Seit den 1950er Jahren geisterte das Schlagwort der „Überbevölkerung“ des Planeten durch die Diskussion. Die demografischen Daten zeigten, dass vor allem die Länder des globalen Südens weiterhin hohe Geburtenziffern verzeichneten, während die durchschnittlichen Kinderzahlen je Frau in den meisten reichen Nationen bald zurück gingen. Die Sorge ging um, dass ungebremstes Bevölkerungswachstum in wenig entwickelten Ländern jedweden sozioökonomischen Fortschritt zunichtemachen würde. Klar war nur, dass sich das einzig über eine Senkung der Geburtenziffern vermindern lässt. Doch Familienplanung oder sogar eine Politik, die den Menschen Zugang dazu ermöglicht, war ein überaus heikles Thema – für viele geradezu ein rotes Tuch.
Ein Durchbruch gelang erst 1994: Bei der folgenden Bevölkerungskonferenz in Kairo anerkannte die Weltgemeinschaft ein allgemeines Recht auf reproduktive Gesundheit, das über den ungehinderten Zugang zu Methoden der Empfängnisverhütung und Beratung zu Belangen der Fortpflanzung hinaus geht. Es schließt unter anderem auch das Recht auf Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten ein, die sichere Schwangerschaften und Geburten ermöglichen. Dabei sollte der Schwangerschaftsabbruch nicht als Familienplanungsmethode gefördert werden, er sollte aber dort, wo er legal ist, ungefährlich und kundiger Hand vorgenommen werden können. Die konservative US-Politik, maßgeblich beeinflusst durch die evangelikalen Christen, der Vatikan sowie manche islamische Organisationen unterliefen den in Kairo erreichten Konsens jedoch konsequent.
Bildung ist die beste Verhütung
Tatsächlich bedeutet starkes Bevölkerungswachstum für die armen Länder bis heute eine große Herausforderung: Viele Regierungen schaffen es nicht, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, mit Nahrung, Gesundheitsdiensten, Bildung und Arbeitsplätzen. Damit wachsen Unzufriedenheit und Konfliktrisiken. Hinzu kommt, drängender denn je, dass der Bevölkerungsdruck schädliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, dass beispielsweise Wälder verschwinden oder übernutzte Ackerböden erodieren. Und wo all dies zusammenkommt, wandern die Menschen ab, vom Land in die Slums der Großstädte oder gleich in andere Länder, wo sie sich bessere Lebensbedingungen erhoffen.
Indes ist längst erwiesen, dass Menschen sich eher für eine kleinere Familie entscheiden, wenn Frauen und Männer gleiche Rechte haben, wenn durch bessere Gesundheitsdienste und hygienische Bedingungen die Kinder- und Müttersterblichkeit sinkt und wenn insbesondere Frauen besseren Zugang zu Bildung haben. So bekommen beispielsweise Frauen in Äthiopien, die nie zur Schule gegangen sind, im Schnitt dreimal mehr Kinder als Frauen, die einen Sekundarabschluss in der Tasche haben. Und natürlich müssen die Menschen dann auch kontinuierlich und preisgünstig auf moderne Methoden der Empfängnisverhütung zugreifen können.
Ein Eingriff in die nationale Souveränität Malawis
Somit wäre es eigentlich für so manche Regierung ein leichter erster Schritt, mit NGOs zusammenzuarbeiten, um ihrer Bevölkerung eine bessere Gesundheitsversorgung und die freie Wahl bei der Familienplanung zu ermöglichen. Indessen hat die Anwendung der Förder-Restriktionen unter der Trump-Regierung etwa in Malawi dazu geführt, dass das Parlament 2021 auf Druck von Abtreibungsgegnern die Debatte über eine Liberalisierung des geltenden Gesetzes einstellte. Dieses erlaubt einen Abbruch nur bei Lebensgefahr für die Schwangere, nicht aber in Fällen von Inzest und Vergewaltigung. Aus Interviews mit NGOs, die in Malawi arbeiten, ging außerdem hervor, dass manche zögern, weiterhin in Programme für reproduktive Gesundheit zu investieren – aus Furcht, eine künftige konservative US-Regierung könnte die globale Knebelungsregel wieder in Kraft setzen.
17.12.2023
Märchenstunde in Dubai
Das 1,5-Grad-Ziel wird glatt verfehlt – weshalb feiern alle den Erfolg?
Für Annalena Baerbock war der 13. Dezember „ein guter Tag“. An diesem Mittwoch endete die UN-Klimakonferenz COP-28 in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die fast 200 Vertragsstaaten hatten sich auf ein Schlussdokument geeinigt, das als „historischer Erfolg“ gefeiert wurde. Alle um sie herum hätten Tränen in den Augen gehabt, erinnert sich die deutsche Außenministerin. Von einem Durchbruch beim Klimaschutz war die Rede. Die FAZ feierte in einem Kommentar gar den „Doppelwumms aus Dubai“.
Tatsächlich gibt das Dokument lediglich Empfehlungen, etwa die erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 zu verdreifachen oder die Energieeffizienz zu verdoppeln. Der Konjunktiv regiert das gefeierte Papier, alles müsste, sollte soundso gemacht werden und der Klimawandel ist gebändigt. Verdreifachen und Verdoppeln binnen sechs Jahren sind allerdings Ziele, die noch nie irgendwo in so kurzer Zeit erreicht wurden und aller Erfahrung nach auch diesmal nicht hinzubekommen sind. Wunsch und Wirklichkeit der Beschlüsse von Klimakonferenzen lagen schon immer Lichtjahre voneinander entfernt.
Rückschritt gegenüber Paris 2015
Gemessen an dem Vertrag von Paris aus dem Jahr 2015 ist das Verhandlungsergebnis von Dubai ein Rückschritt. Damals hatte die Weltgemeinschaft einstimmig beschlossen, die Temperaturen der erdnahen Luftschichten bis 2100 möglichst nicht um mehr als 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit steigen zu lassen. Die Paris-Vision, die auch in Dubai als Ziel herhalten musste, ist allen wissenschaftlichen Analysen nach so gut wie unerreichbar. Heute schon hat sich die Erde um rund 1,2 Grad erwärmt. Eigentlich ist das 1,5-Grad-Ziel längst gerissen, denn die so genannte braune Wolke, ein Gewaber aus dem Dreck von Kohlekraftwerken, schmutzigen Autoabgasen sowie dem Rauch abgebrannter Felder und Wälder, das über China und dem indischen Subkontinent hängt, kühlt die Erde wie ein Sonnenschirm.
Sollte es in dieser Region zu mehr Klimaschutz kommen, was dringend notwendig wäre und Millionen Menschen den frühzeitigen Tod durch Atemwegserkrankungen ersparen würde, wäre die Luft über Asien sauberer, aber der Beschattungseffekt entfiele. Allein dadurch würde die globale Mitteltemperatur Studien zufolge um 0,3 Grad steigen und die Erde wäre um 1,5 Grad wärmer. Selbst eine Begrenzung auf zwei Grad dürfte nach heutigem Stand der Klimaschutzmaßnahmen kaum zu schaffen sein: Alle angekündigten, aber keinesfalls eingelösten Einsparversprechen der Weltgemeinschaft laufen auf eine Erwärmung von 2,5 bis 3 Grad zu.
Wie wahrscheinlich ist es unter diesen Umständen, dass es die Staaten schaffen, wie im Dubai-Dokument ausgewiesen, die Treibhausgas-Emissionen so weit herunterzufahren, dass es auf Erden nicht wärmer als 1,5 oder 2 Grad wird? Es ist extrem unwahrscheinlich. Schon ein Blick in ein paar ernstzunehmende Zeitungen in den Tagen vor und nach Ende des Klimagipfels lässt an der tränenreichen Eigenlobhudelei der Konferenzteilnehmer zweifeln.
De facto kein Rückgang der Emissionen
Da meldet beispielsweise die Internationale Energieagentur (IAE) ein neues weltweites Allzeithoch bei der Verbrennung von Kohle, dem klimaschädlichsten aller fossilen Rohstoffe. Vor allem China und Indien heizen so dem Globus ein, weil die Stromnachfrage steigt und die Wasserkraftwerke infolge des Klimawandels weniger Elektrizität liefern. Allein China wird nach IAE-Angaben 2023 rund 4,7 Milliarden Tonnen Kohle verfeuern, das sind fast vier Tonnen je Einwohner im Reich der Mitte. Da hilft es wenig, dass der Kohlekonsum in den USA und der EU langsam, aber sicher zurückgeht.
Dafür feiern die USA einen anderen Rekord in Sachen Klimaschaden: Das Land wird 2023 mehr Erdöl fördern als je zuvor in seiner Geschichte und die zuvor größten Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland hinter sich lassen. Nach Meldung der staatlichen Energie-Informationsagentur (EIA) kommen die US-Förderer auf eine durchschnittliche Tagesproduktion von 13 Millionen Fass à 159 Liter. Das sind 757 Milliarden Liter im Jahr 2023, die in den USA oder anderen Ländern verbraucht werden. Wenn man davon ausgeht, dass das klebrige schwarze Gold in irgendeiner Form irgendwann verbrannt wird, werden daraus 1,9 Gigatonnen des Klimagases CO2. Das entspricht mehr als der Hälfte der Emissionen sämtlicher EU-Länder und ist mehr als der gesamte afrikanische Kontinent in die Luft jagt. Die EIA rechnet mit einer weiter steigenden Förderung für 2024.
Auch die Deutschen können sich einen negativen Umweltrekord ans Revers heften. Sie sind Europameister, nicht im Fußball, aber in der Produktion von Verpackungsmüll. 237 Kilogramm hinterließ ein Durchschnittsbürger im Jahr 2021, ließ das Statistische Bundesamt nach neusten Zahlen mitteilen – mehr als jeder andere Europäer und 26 Prozent mehr als im Jahr 2005. Nur ein kleiner Teil davon wird stofflich recycelt, das meiste landet in der „thermischen Verwertung“, wird also verbrannt und entkommt dem Schornstein der Müllverbrennungsanlage als CO2.
Zeitgleich zu diesen Meldungen verkündet die Förderbank KfW den Stopp ihres Förderprogramms Klimafreundlicher Neubau, weil das Geld aufgebraucht sei und der zum Sparen verpflichteten Bundesregierung die Mittel für ein verlängertes Programm fehlen.
In die Tasche gelogen
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) veröffentlicht in derselben Woche eine Studie, aus der hervorgeht, dass die als klimapolitisches Heilsversprechen gehypten Elektroautos gar nicht unbedingt weniger CO2 verursachen als die klassischen Verbrennerfahrzeuge. Das liegt vor allem an den Batterien, deren Herstellung sehr rohstoff- und energieaufwändig ist. Selbst kleinere E-Autos wie der Volkswagen ID.3 tragen einen CO2-Rucksack von etwa zehn Tonnen CO2 mit sich herum – bevor sie auch nur einen Kilometer gefahren sind. Und auch danach bleiben die E-Autos CO2-Schleudern, jedenfalls solange sie nicht ausschließlich mit regenerativ erzeugtem, „grünen“ Strom geladen werden. Das ist bislang nur selten der Fall. In Deutschland entstammte die Elektrizität 2022 nur zu 46 Prozent aus Wind, Wasser- oder Sonnenkraft. Für den Rest waren Kohle- und Gaskraftwerke zuständig.
Je größer, schwerer und leistungsstärker ein E-Auto ist, desto schlechter seine Umweltbilanz. Etwa von dem gerade vorgestellten elektrischen Porsche Macan, der gleich mit zwei Elektromotoren auf Vorder- und Hinterachse daherkommt, die für ein Drehmoment von über 1.000 Newtonmeter sorgen. Ganz zu schweigen von dem martialischen Tesla Cybertruck, der in der Topversion auf drei Elektromotoren angewiesen ist, um das Drei-Tonnen-Gefährt in 2,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer zu katapultieren. Diese Karossen können sicher viel, aber eines mit Sicherheit nicht: Irgendein Klimaziel erreichen.
Insgesamt erreichen die CO2-Emissionen im Jahr 2023 ein neues Rekordniveau. So klimaschädlich war die Menschheit noch nie in ihrer Geschichte. Die Kurve des Treibhausgases CO2 steigt munter weiter. Nur im Schlussdokument von Dubai steht geschrieben, dass die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 (also in nur sechs Jahren!) um sage und schreibe 43 Prozent sinken sollen. So beschert uns die Weihnachtszeit mal wieder ein Wunder aus dem Morgenland, das Märchen von Dubai.
Auf das nächste Märchen müssen wir nur noch ein Jahr warten. Dann findet COP-29 statt, die 29. Weltklimakonferenz. In Baku, der Hauptstadt Aserbeidschans, eines Landes, das noch stärker von der Öl- und Erdgasförderung abhängt als die Vereinigten Arabischen Emirate.
07.12.2023
Sind wir zu doof für Klimaschutz?
Die Politik braucht mehr Rückgrat für Beschlüsse in Richtung Nachhaltigkeit
Es gibt gute Gründe zu verzweifeln: Da tummeln sich in Dubai rund 80.000 Delegierte und Beobachter aus 196 Ländern auf der UN-Klimakonferenz, genannt COP28. Alles voller Politiker, Industrievertreter, Mitglieder von Umweltverbänden und Journalisten, gekrönte Monarchen wie König Charles III. und einfache Kanzler wie Olaf Scholz. Allein die Bundesregierung hat eine 245-köpfige Abordnung geschickt. Alle wollen das Klima retten. Alle wissen, dass die Hütte brennt. Alle wissen, was der Klimawandel bedeutet und wie er zu bändigen wäre. Alle wissen alles. Immerhin bedeutet COP28, dass es die 28. Konferenz ihrer Art ist.
Doch trotz all der immer wieder aufgewärmten und weiter entwickelten Erkenntnisse, trotz der guten Vorsätze, die erdnahen Luftschichten nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmen zu lassen, sind die Treibhausgas-Emissionen seit der ersten Konferenz im Jahr 1979 in Genf quasi kontinuierlich gestiegen – um über 70 Prozent. 2023 ist das neue Rekordjahr. Der Weltklimarat prognostiziert auf Basis der heutigen Klimapolitik der Staatengemeinschaft eine Erwärmung von zweieinhalb bis drei Grad – mit katastrophalen Auswirkungen für einen Großteil der Erdbewohner. Wunsch und Wirklichkeit könnten nicht weiter voneinander entfernt sein.
Warum sind wir alle so unvernünftig?
Wie kommt es, dass die verantwortlichen Politiker so gut wie keine wirksamen Regeln zum Klimaschutz zustande bringen? Weshalb ändern die eigentlichen Emittenten, also die gemeinen Bürgerinnen und Bürger, kaum etwas an ihrem Verhalten? Jedenfalls nichts, was zu vorzeigbaren Ergebnissen führen würde. Zwar sinken in weit entwickelten Ländern wie Deutschland die Emissionen seit Jahren. Aber sie kommen von hohem Niveau. Deutschland ist immer noch meilenweit davon entfernt „treibhausgasneutral“ zu wirtschaften, was das erklärte Ziel der Bundesregierung bis 2045 ist.
Vernünftig ist das alles nicht. Vernünftig handeln bedeutet, Regeln zu befolgen und gleichzeitig das eigene Verhalten zu durchdenken und die Konsequenzen abzuwägen, die das Verhalten nach sich zieht. Das kann, nach allem, was man weiß, nur der Mensch als einzige Spezies auf Erden. Aber diese Fähigkeit hilft uns offensichtlich nicht, die fatale Lücke zwischen Wissen und Handeln zu schließen – beim Klimaschutz, ebenso beim Artensterben oder der Ozeanverschmutzung.
Vernunft ist wahrscheinlich die am meisten überschätzte Eigenschaft des Menschen. Unter Experten, seien es Philosophen oder Gehirnforscher, ist nicht einmal geklärt, was Vernunft überhaupt ist. Dabei denken diese Fachkräfte für menschliches Verhalten seit Jahrtausenden über diese Frage nach.
Für den alten Griechen Platon war die Vernunft nur einer von drei Seelenteilen. Die beiden anderen, Übermut und Begierde, stritten lebenslang mit ihr um die Vorherrschaft. Auch für den Landsmann Aristoteles war die Vernunft kein Selbstgänger, sondern nur die Mitte zwischen zwei alltäglichen Irrwegen. Alles jenseits der Mitte war für ihn extrem und von „Furchtsamkeit“ oder „Kühnheit“ geprägt. Die entsprechenden Personen waren entweder feige oder verwegen, also weder damals noch heute zu gebrauchen.
Falsches Verhalten ist leider menschlich
Immanuel Kant, der wichtige Wegbereiter der Aufklärung aus Königsberg, glaubte zwar, dass der Mensch ein Wesen sei, das nach den Grundsätzen der Vernunft handeln kann, ja, dass er überhaupt nur frei sei, wenn er vernunftbegabt handle. Nach dieser Messlatte allerdings wären die allermeisten Menschen unfrei. Was nach Kant daran liegt, dass uns nicht nur die „reine“ oder theoretische Vernunft zu eigen ist, sondern auch die „unreine“ oder praktische Vernunft. Mit der theoretischen Vernunft können wir uns des Verstandes bedienen, Schlüsse ziehen, auf den Pfad der Rationalität kommen und ein friedliches Auskommen mit anderen Menschen und der Umwelt finden. In diesem Fall tun wir das „Richtige“, aber häufig auch eher Langweilige.
Die praktische Vernunft hingegen resultiert aus Leidenschaft und Triebhaftigkeit und beschert in der Regel mehr Spaß. Aus subjektiver Sicht ist dieses Verhalten durchaus rational. Der Kauf eines tonnenschweren SUV, die lodernde Affäre, der Griff zur nächsten Zigarette oder die zweite Flasche Wein sind das Ergebnis einer kognitiven Abwägung, auch wenn das Erwachen Kopfschmerzen bedeuten kann. Kant bezeichnet das Handeln aus unreiner Vernunft als „falsch“. Aber das ändert nichts daran, dass der Wettstreit zwischen der reinen und unreinen Vernunft meist mit einer unbefriedigenden Zwischenlösung endet (siehe das Ergebnis von COP1 bis COP28). Wir Menschen verhalten uns nun mal ziemlich häufig falsch.
Die moderne Neurowissenschaft hat die Definition von Vernunft weiter an die gesellschaftliche Realität angepasst, kommt aber auch zu keinem erhellendem Ergebnis. Sie geht davon aus, dass wir nicht nur von Verstand und Vernunft gesteuert sind, sondern auch von deren Gegenpol, von den Gefühlen und Trieben. KI-gesteuerte Roboter wären deshalb die besseren Menschen. Sie würden vernünftiger handeln, denn sie kennen keine blinde Wut, keinen Überschwang oder Liebeswahn, die den Homo sapiens gelegentlich Dinge tun lassen, die komplett realitätsfern und bar jeder Vernunft sind.
Dummerweise waren für die Spezies, der wir alle angehören, in ihrer Evolutionsgeschichte Triebe, die kurzfristige Gewinne bescheren (Hunger, Durst oder Sex) wichtiger als die Vernunft und der lange Blick nach vorne. Offenbar hat uns die Evolution auf impulsives, kurzfristig orientiertes Verhalten getrimmt und nicht darauf, alles bis zum Ende durchzudenken. Diesen evolutionären Rucksack haben wir heute noch zu tragen.
Gefühle können kein Instrument der Klimapolitik sein
Für den 2023 verstorbenen Bremer Verhaltenspsychologen und Entwicklungsneurobiologen Gerhard Roth war klar, dass wir mit Verstand und Vernunft alleine nicht leben können. Handlung entstehe erst, wenn die Gefühle mit ins Spiel kommen, denn sie hätten bei der Handlungssteuerung das erste und das letzte Wort, so der Wissenschaftler. Gefühle beeinflussen uns so übermächtig, weil sie dem limbischen System entstammen, einem stammesgeschichtlich sehr alten Teil des Gehirns, das sich schon früh in der Evolution der Säugetiere entwickelt hat. Es sorgt dafür, dass wir im Millisekundenbereich auf äußere Reize reagieren können und quasi automatisch überlebensnotwendige Entscheidungen treffen: Wir fliehen vor einer akuten Gefahr, wehren uns gegen einen Angreifer oder schrecken vor verdorbenem Fleisch zurück.
Das limbische System allerdings hilft uns nicht beim Kampf gegen den Klimawandel. Dieses ist, wie auch das Artensterben, eine diffuse Gefahr, vor der wir gar nicht im Affekt entfliehen können. Wenn die Ahr mein Haus wegschwemmt, kann ich mit Glück noch schnell Reißaus nehmen. Aber ich reduziere damit nicht den menschengemachten Treibhauseffekt. Für richtige politische Entscheidungen in der Klimapolitik braucht es abstrakte Statistiken und Modellrechnungen, die sich nur mit Verstand und Vernunft erstellen und richtig interpretieren lassen. Gefühle helfen nicht weiter.
Die Politik ist an der Reihe
Insofern wäre es ganz praktisch, die Verantwortlichen von Dubai würden ihre Emotionen einmal ausschalten, die Lobbyisten allemal. Sie sollten ihre Illusionen, wir könnten noch ein paar Jahrzehnte weiter Kohle, Öl und Gas verheizen, begraben. Sie müssten ihre Wunschvorstellung, das viele CO2 in der Atmosphäre ließe sich irgendwann mal wieder einfangen und tief im Erdreich verbuddeln, entsorgen. Sie können der Öffentlichkeit nicht länger verkaufen, Klimaschutz sei preiswert, lasse sich technisch lösen und ohne persönliche Einschränkungen bewerkstelligen und das 1,5 Grad Ziel sei schon irgendwie zu erreichen.
Das wäre die Stunde einer verantwortungsvollen Politik. Einzelpersonen können keine globalen Probleme lösen. Sie sind tendenziell auf ihre eigenen und kurzfristigen Vorteile erpicht und erachten den Flug nach Bali oder das dicke Steak auf dem Teller für wichtiger als den langfristigen Klimaschutz. Zumindest in Demokratien wird deshalb die Verantwortung für übergeordnete, am Gemeinwohl orientierte Entscheidungen an eine gewählte Elite delegiert, deren Aufgabe es ist, über partikulare Interessen hinweg Investitionen zu tätigen und Gesetze zu erlassen. Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger ist es, die Anweisungen der Legislative zu akzeptieren und Einschränkungen hinzunehmen, auf die sie von alleine nicht unbedingt gekommen wären. Das ist das Normalste in einer Demokratie: Nicht jede oder jeder zahlt gerne Steuern, aber sie gelten als legitim, solange sie effizient und im Sinne des sozialen Ausgleichs ausgegeben werden.
Die nationale und internationale Politik muss endlich begreifen, dass für eine nachhaltige Entwicklung auch unbequeme Regeln nötig sind. Ohne das dafür notwendige Rückgrat kann man COP29 und weitere Folgekonferenzen gleich vergessen. Und wenn der Politik der Schneid fehlt, diese Regeln gut zu begründen und sich die Zustimmung dazu auch bei der nächsten Wahl einzuholen, dann steht es schlecht um die Zukunft der Demokratie.
03.12.2023
Verlustängste
Weniger Menschen wären gut für die Umwelt – aber das will auch wieder keiner
Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum gehen in der Regel Hand in Hand. Das gilt zumindest, solange die einfache Gleichung gilt: Mehr Menschen = mehr Produzenten, mehr Konsumenten und mehr Innovationstreiber. Alles wächst und die Menschen werden immer reicher.
Global betrachtet lässt sich dieser Zusammenhang seit 250 Jahren beobachten. Zuvor wuchsen Weltbevölkerung und Weltwirtschaft über Jahrtausende nur wenig. Die allermeisten Menschen waren arm, ungebildet und schlecht ernährt. Ihre Lebenserwartung lag im Schnitt bei nicht einmal 30 Jahren. Wirtschaftlich passierte nicht gerade viel.
Das änderte sich erst mit grundlegenden Erkenntnissen von Hygiene und Medizin, mit sauberem Trinkwasser, einer produktiveren Landwirtschaft und bahnbrechenden Erfindungen wie Dampfmaschine, Kunstdünger oder Elektrizität. Die Wirtschaft erblühte und mehr Menschen konnten überleben. Das Menschen-Mehr wiederum kurbelte die Wirtschaft an. Aus der einen Milliarde Menschen im Jahr 1800 wurden zwei Milliarden im Jahr 1927 und drei 1960. Heute sind es über acht Milliarden.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überholte das Wachstum der Weltwirtschaft sogar jenes der Weltbevölkerung. Seit Anfang der 1950er Jahre hat sich das Weltbruttoinlandsprodukt verfünfzehnfacht, während die Weltbevölkerung „nur“ um das Dreifache gewachsen ist. Die Menschen sind seither also im Schnitt fünfmal reicher geworden. Zeichen des Fortschritts ist die durchschnittliche Lebenserwartung, die bis 2019 weltweit auf 73,4 Jahre angestiegen ist. Erst Corona raubte der Menschheit dann wieder rund zwei Jahre Lebenszeit.
Fantastisches Wachstum – fatale Folgen
Dummerweise blieben Fortschritt, Wachstum und Wohlstand nicht ohne negative Begleiterscheinungen. Denn ein wachsendes Bruttoinlandsprodukt bedeutet mehr produzierte Güter und Dienstleistungen und dafür sind Energie und Rohstoffe aller Art notwendig. Aus Wohlstand wird Müll in jeder Form. Die Kollateralschäden des Wachstums zeigen sich überall, vom Klimawandel bis zum Artensterben.
Diesen Problemen mit technischen Lösungen zu Leibe zu rücken, mit Effizienz, Solarzellen, E-Autos oder Wasserstofftechnologie, also letztlich mit dem menschlichen Erfindergeist, der in der Vergangenheit zu Wohlstand und Wachstum geführt hat, zeigt bis dato keinen Erfolg. Das liegt unter anderem daran, dass Effizienzgewinne meist durch Mehrverbrauch kompensiert werden. Ein Beispiel: Automotoren werden immer sparsamer, aber die Fahrzeuge selbst werden immer adipöser, so dass der schönste „Vorsprung durch Technik“ (Audi) dahinschmilzt wie die Schneeflocke in der Aprilsonne.
Wenn aber die Technik zumindest auf absehbare Zeit keinen Ausweg aus den diversen Ökokrisen weisen kann und wenn der gut betuchte Teil der Menschheit kaum bereit ist seinen Konsum durch Bescheidenheit, Beschränkung und Verzicht, also durch Suffizienz zu mäßigen: Wären dann weniger Menschen ̶ insbesondere weniger Hochverbraucher in jenen wohlhabenden Ländern, die sich durch besonders hohe Emissionen hervortun ̶ nicht eine gute Nachricht für den Planeten, die Umwelt und ihre Bewohner?
Tatsächlich schleicht sich ein solches Schrumpfen gerade durch die Hintertür herein: Das Bevölkerungswachstum, ein wichtiger Treiber für das Wirtschaftswachstum, klingt aus, wenn es den Menschen bessergeht. Wohlstand, bessere medizinische Versorgung, Bildung und Gleichberechtigung der Geschlechter haben überall auf der Welt für sinkende Geburtenziffern gesorgt. Ökonomen würden das einen windfall profit nennen, einen zufälligen Gewinn durch günstige Umstände.
Weltweiter Trend zu kleineren Familien
Zwei Drittel der Menschheit leben heute in Ländern mit einer Fertilitätsrate von 2,1 (dem sogenannten Ersatzniveau) oder darunter. Das sind Bedingungen, unter denen eine Bevölkerung mittelfristig aufhört zu wachsen beziehungsweise in ein Schrumpfen übergeht, solange Zuwanderung die Verluste nicht ausgleicht. Die 15 wirtschaftsstärksten Länder der Welt, und dazu gehören neben den USA auch China und Indien, haben Geburtenziffern unterhalb des Ersatzniveaus. Deutschland verzeichnet seit 1972 in jedem einzelnen Jahr einen Überschuss der Sterbefälle über die Geburten, auch wenn die Bevölkerung dank Zuwanderung seither um fünf Millionen angewachsen ist. In anderen europäischen Ländern wie Portugal, Italien, Rumänien oder Griechenland, aber auch in Russland, Japan, Südkorea und China stehen die Zeichen längst auf Schwund. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dürften nach den Vorhersagen der Vereinten Nationen die Einwohnerzahlen aller Kontinente zurückgehen – mit Ausnahme von Afrika, wo die Geburtenziffern zwar auch sinken, aber deutlich langsamer als anderenorts.
Führt der demografische Wandel zum Wirtschaftskollaps?
Bevölkerungsrückgang und Alterung gelten als Problem für die Wirtschaft: Die Nachfrage sinkt, weniger Arbeitskräfte wachsen nach und die Kosten für die steigende Zahl an Ruheständlern gehen durch die Decke. Tatsächlich verzeichnen alle Industrienationen und mittlerweile auch aufstrebende Schwellenländer wie China im Zehnjahresmittel deutlich rückläufige Wirtschaftswachstumsraten. Ökonomen diskutieren dieses Phänomen unter dem Begriff der „säkularen Stagnation“ und sehen den demografischen Wandel als eine der Hauptursachen dafür.
Was aus ökologischer Sicht durchaus zu begrüßen wäre, lässt Papst Franziskus, der sonst gerne die Bewahrung der Schöpfung herbeibetet, verzweifeln: Menschen, die sich Haustiere halten, anstatt Kinder zu bekommen, seien selbstsüchtig, hat er einmal gesagt. Auch für die meisten Politiker bedeutet ein mögliches Ausklingen des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums ein Horrorszenario. Sie haben sich in eine gefährliche Abhängigkeit von Wachstum manövriert. Sie brauchen es, um eine ambitionierte Klimapolitik, die Verrentung der Babyboomer, die steigenden Gesundheitskosten und letztlich auch die ausufernde Schuldenpolitik zu finanzieren.
Selbst der eigentlich nüchtern argumentierende britische Economist (Ausgabe vom 01.06.2023) lässt sich von der Panik angesichts eines „weltweiten Kollaps der Geburtenziffern“ anstecken. Die Welt sei nicht annähernd voll (eine gewagte Behauptung angesichts der ausufernden Meeresverschmutzung und der ungebremsten Emission von Treibhausgasen), schreibt das Magazin, die wirtschaftlichen Probleme bei einem Mangel an jungen Menschen indes groß. Kreativität und Innovationskraft würden leiden, die Politik angesichts alternder Volksvertreter verknöchern.
Irreversible Entwicklung
Ob sich der Geburtenrückgang rückgängig machen lässt, wie es sich Papst oder Economist wünschen, ist allerdings fraglich. Nach allen Erkenntnissen scheint der Trend zu kleineren Familien irreversibel zu sein. Eine wachsende Zahl von Ländern versucht zwar mit finanziellen Förderungen ihre jungen Menschen vom Gegenteil zu überzeugen, aber wirkliche Erfolge erzielen sie damit nicht. In keinem Land ist es je gelungen, eine einmal deutlich abgesackte Fertilitätsrate wieder über den Schwellenwert von 2,1 Kindern je Frau zu hieven.
Pronatalistische Politik ist eine Geschichte der Fehlschläge: Der Stadtstaat Singapur gewährt großzügige Geldzahlungen, Steuererleichterungen und subventioniert die Kinderbetreuung, aber die Frauen bekommen im Schnitt kaum mehr als ein Kind. China fordert seine jungen Menschen mittlerweile auf wieder häufiger zu heiraten, traditionelle Familienwerte zu achten und mehr Nachwuchs zu bekommen, am besten drei Kinder. Staatspräsident Xi Jinping hat eine „nationale Politik zum Ankurbeln der Geburtenraten“ versprochen. In manchen Regionen werden im Rahmen des „nationalen Verjüngungsprogramms“ kostengünstige Massenhochzeiten gefördert, anderswo gibt es Cash, wenn sich die Menschen vor ihrem 25. Geburtstag vermählen. Tatsächlich aber kommen in China durchschnittlich 1,1 Kinder je Frau zur Welt.
Russland, Polen und Ungarn zahlen zum Teil hohe Prämien für Neugeborene (in Russland beträgt das „Mutterschaftskapital“ umgerechnet über 10.000 Euro) und versuchen Frauen an ihre traditionelle Geschlechterrolle in der Reproduktion zu erinnern. Auch das Schüren von Furcht vor einer demografischen Übermacht von Zuwanderern und Einschränkungen beim Recht auf Abtreibung sollen die Geburtenfreudigkeit erhöhen.
Vor allem in Russland hatte das Prinzip „Geld für Babys“ messbare Erfolge, die Geburtenziffern stiegen vorübergehend an, um nach ein paar Jahren wieder runterzugehen. Die höheren Nachwuchszahlen waren das Resultat eines Mitnahmeeffektes in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Die Menschen hatten den ohnehin geplanten Nachwuchs vorgezogen um einen Bonus zu kassieren, den es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr geben würde. Trotz Prämien und einer nationalistisch eingefärbten Wertedebatte liegen die Geburtenziffern in Russland, Ungarn und Polen bei 1,5 bis 1,6 Kindern je Frau und damit weit unter einem erhofften Wert von 2,1 und mehr, der wieder ein Bevölkerungswachstum verheißen würde.
Der demografische Wandel ist eine Folge einer sozioökonomischen Entwicklung, die den Menschen mehr Wohlstand und individuelle Freiheiten gebracht hat. Er dürfte in segensreicher Weise dafür sorgen, dass die Menschheit irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ihr Wachstum einstellt. Ein Ende des Wachstums, weil es den Menschen bessergeht, ist allemal erstrebenswerter als ein Ende, das durch Hungersnöte, Epidemien oder Kriege zustande kommt. Das ist vielleicht die beste Nachricht, die der Wandel zu bieten hat. Wenn dann auch noch die müllerzeugende Wirtschaft aufhört endlos zu wachsen, ergäbe sich ein neuer windfall profit, ein positiver Nebeneffekt für die Umwelt, eine Art ökologischer Dividende. Diese zu nutzen ist allemal sinnvoller als ein neues Bevölkerungswachstum herbei zu subventionieren.
27.11.2023
Der Planet braucht mehr bäume
aber wie geht das schnell und günstig?
Derzeit gehen weltweit pro Jahr rund zehn Millionen Hektar Wald verloren – abgeholzt, gezielt abgefackelt oder durch Waldbrände zerstört. Das entspricht der Fläche Portugals. Doch tatsächliche schwinden die globalen Wälder nur um die Hälfte, nämlich um fünf Millionen Hektar. Die andere Hälfte ist theoretisch auf dem Weg, irgendwann wieder zu einem echten Wald zu werden: Sie wird von Menschenhand mit jungen Bäumen aufgeforstet. Oder auf ihr sprießen – ganz ohne fremde Hilfe – die Keimlinge aus zufällig niedergegangenen Baumsamen. Naturverjüngung heißt dieser Prozess im Fachjargon.
Pro Kopf der Weltbevölkerung gibt es heute etwa 5.000 Quadratmeter Wald, so wenig wie nie zuvor. 1990 waren es noch gut 7.000, zu Beginn des 20. Jahrhunderts über 30.000 Quadratmeter. Dieser Rückgang gründet zum einen auf der quasi durchgängigen menschengemachten Waldvernichtung, in der Regel, um aus dem Forst Äcker oder Weideland zu machen. Zum anderen hängt der Pro-Kopf-Rückgang mit dem Wachstum der Menschheit zusammen: Die Weltbevölkerung hat sich seit 1900 auf über acht Milliarden fast verfünffacht.
Dass dieser Trend dringend umgedreht werden müsste, liegt auf der Hand: Wälder sind der wichtigste Hort der bedrohten Artenvielfalt. Geschätzte 80 Prozent aller an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten sind in Wäldern zuhause, vor allem in den tropischen und subtropischen Gebieten. Ihre genaue Zahl ist unbekannt, denn der größte Teil der Arten ist noch gar nicht entdeckt und wissenschaftlich beschrieben.
Nach Angaben der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen beherbergen die Wälder der Welt 60.000 verschiedene Baumarten, 80 Prozent aller Amphibienspezies, 75 Prozent aller Vogel- und 68 Prozent aller Säugetier-Arten. Wälder spenden Sauerstoff, schützen vor Erosion, speichern das Grundwasser und entziehen der Luft das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2), um daraus Holz aufzubauen. Die Wälder fungieren somit als „CO2-Senke“, was ein Segen ist, denn es gibt viel zu viele CO2-Quellen auf Erden, nämlich überall dort, wo fossile Brennstoffe in Flammen aufgehen. Büßt der Wald seine Funktion als Senke ein, wird auch er zur CO2-Quelle. Das einmal gespeicherte Kohlendioxid landet wieder in der Atmosphäre und feuert den Klimawandel weiter an. Deshalb bedeutet Waldschutz Klimaschutz.
Trendwende beim Waldverlust, aber längst kein Ende
Diese Zusammenhänge im Kopf, haben die Vereinten Nationen das laufende Jahrzehnt zur Dekade der Ökosystem-Restaurierung ausgerufen. Wälder und andere lebenswichtige Naturräume sollen geschützt, ertüchtigt oder neu geschaffen werden. Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten im November 2022 beschlossen die EU und 26 Länder, 16 Milliarden Dollar für Waldschutz und Wiederaufforstung bereitzustellen. Das klingt erst mal gut und spricht für ein wachsende Umweltbewusstsein.
Tatsächlich hat sich das Tempo der Waldvernichtung seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre in etwa halbiert. Dieser Zeitpunkt gilt als „Peak Deforestation“. Seither ließen sich die hemmungslosen Kahlschläge etwas eindämmen. Aufforstungen konnten die schlimmsten Wunden heilen, doch sie schaffen es bisher nicht annähernd den Schwund auszugleichen.
Theoretisch könnten die Wälder der Erde das 20-fache der aktuellen jährlichen CO2-Emissionen speichern. Das jedenfalls schreiben Forscher einer internationalen Arbeitsgruppe um Lidong Mo von der ETH Zürich in einer Studie, die sie jüngst im Fachblatt Nature publiziert haben. In Sachen Klimaschutz wäre das ein gewaltiger Fortschritt. Doch ganz so ermutigend sind die Ergebnisse bei genauer Betrachtung nicht.
Denn um die CO2-Emissionen der Menschheit aus zwei Jahrzehnten aufzunehmen, müssten sämtliche existierenden Wälder ungestört weiterwachsen, es dürften also keine Bäume entnommen werden. Zusätzlich wären alle einst gerodeten Flächen in dünn besiedelten Regionen wieder aufzuforsten. Keinerlei Waldbrände, Dürren, Windbruch oder Schädlingsbefall dürften die bestehenden Wälder dezimieren, was angesichts des galoppierenden Klimawandels recht unwahrscheinlich ist. Allein in Kanada hat sich 2023 ein Baumstand in CO2 und Asche aufgelöst, der etwa der gesamten Waldfläche Deutschlands entspricht. Schlussendlich bräuchten die Wälder 100 bis 200 Jahre, um die gigantische Menge von 830 Gigatonnen CO2 zu schlucken und in Holz zu verwandeln. So viel Zeit bleibt leider nicht, um den menschengemachten Treibhauseffekt zu bremsen.
Pflanzen oder sprießen lassen?
Dennoch wäre ein Mehr an Bäumen ein wichtiger Schritt, um wenigstens einen Teil des unerwünschten CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Um irgendwo neuen Wald wachsen zu lassen, kennen Förster zwei Methoden: Pflanzung oder Naturverjüngung. Beide haben Vor- und Nachteile. Für Pflanzungen müssen Bäume aus Saatgut in Baumschulen vorgezogen werden. Das dauert rund zwei Jahre, ist aufwändig und kostet Geld, bevor die empfindlichen Schösslinge dann an Ort und Stelle in den Boden gesetzt werden. Danach überleben nicht alle Jungbäume, sie verdorren in Trockenphasen, werden zertrampelt oder abgefressen. Einer Untersuchung in Süd- und Südostasien zufolge überstanden im Schnitt nur 44 Prozent der Setzlinge das fünfte Jahr nach Pflanzung. Zäune gegen unerwünschte Tiere und eine Bodenverbesserung vor der Pflanzung können die Überlebenschancen verbessern – machen das Geschäft aber noch einmal teurer. Kritiker halten das Pflanzen von Bäumen zum Waldaufbau deshalb für eine Geldverschwendung. Trotzdem ist die Methode beliebt, auch weil sich mit Pflanzaktionen gut Spenden einwerben lassen oder weil Fluggäste glauben, sie könnten mit einer Art Ablasszahlung an Aufforstungsprogramme ihre Treibhausgas-Emissionen kompensieren.
Waldwuchs durch Wildwuchs
Im Vergleich zu den teuren Baumpflanzungen kostet die Naturverjüngung erst einmal gar nichts. Man wartet einfach, bis das Saatgut vom Wind, von Vögeln oder im Fell von Säugetieren auf die Brachflächen transportiert wird. Dabei keimen viel mehr Baumsamen als schließlich in einem Wald Platz haben. Über eine natürliche Selektion setzen sich jene Baumarten und -individuen durch, die am besten an das Gelände angepasst sind. In der Regel machen sich zuerst die Pioniere breit, in hiesigen Gefilden sind das Erlen, Ebereschen oder Birken. Sie sind anspruchslos, wachsen schnell, lockern mit ihren Wurzeln den Boden auf, bringen über ihre Blätter Kompost in die Erde und sie spenden Schatten für Bäume wie Eiche oder Buche, die langsamer wachsen, aber irgendwann größer als die Pioniere werden. Diese Wegbereiter leben nur ein paar Jahre oder Jahrzehnte, sie opfern sich gewissenmaßen für den eigentlichen Wald, ein Prinzip, das sich über Jahrhunderttausende der Evolution herausgebildet hat. Über 90 Prozent aller Wälder rund um den Globus sind aus eigener Kraft entstanden, sie haben sich von alleine regeneriert.
Naturverjüngung klappt besonders gut auf Kahlschlägen, die noch von samenliefernden Bäumen umstanden sind, oder wenn der Boden nach Waldbränden gut mit Nährstoffen versorgt ist. Manchmal muss man lediglich den Jungwald einzäunen, damit er vor Wildverbiss oder Weidetieren geschützt ist. Unter natürlichen Bedingungen breitet sich der Wald auch dort von alleine aus, wo vorher gar keiner war: In Bergregionen, wo sich die Waldgrenze durch den Klimawandel in die Höhe verschiebt, oder in Sibirien und Nordamerika, wo es die Erwärmung möglich macht, dass auf der vormals baumlosen Kältesteppe namens Tundra zusehends ein borealer Nadelwald aus Lärchen, Fichten und Kiefern emporkommt.
Auch wenn Naturverjüngung das ökologische Mittel der Wahl zu sein scheint, sind Pflanzungen mitunter vielversprechender. Sie bringen den Waldwuchs nicht nur schneller auf Trab, sondern damit lässt auch steuern, welche Baumarten wachsen, vor allem, wenn es sich um seltene, ökologisch wertvolle Arten handelt, die zuvor von Monokulturen verdrängt wurden. Zudem sind vielerorts in den Tropen wichtige Samenverbreiter, wie große Vögel oder Säugetiere, durch Jagd stark dezimiert. Zum Teil nutzen Förster auch eine Mischtechnik beim Waldneuaufbau: Sie pflanzen auf größeren Brachen verschiedene Baumarten als „Inseln der Regeneration“ und überlassen den Rest der Natur. Auf Testflächen in Costa Rica entstanden so diversere Wälder als bei einer Komplettbepflanzung.
Größte Verluste dort, wo die wertvollsten Wälder wachsen
Vor allem in tropischen Gebieten, wo es dem Wald am stärksten an den Kragen geht und entsprechend viel gespeicherter Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt wird, wären Aufforstungen, welcher Art auch immer, dringend nötig. 95 Prozent der weltweiten Waldverluste finden in den besonders artenreichen tropischen Regenwäldern am Amazonas, in Afrika und Indonesien statt, wo die vor Ort lebenden Menschen meist relativ arm und auf Brennholz angewiesen sind und das Bevölkerungswachstum hoch ist. Nur ein kleiner Teil der zerstörten Flächen kann sich regenerieren.
Positiv ist die Waldbilanz hingegen, trotz Abholzungen und zunehmenden Waldbränden, in Osteuropa, Russland, Indien und China. Dort wächst mehr nach als verloren geht. Das liegt teils an massiven staatlich gelenkten Aufforstungskampagnen wie etwa in China. Teils daran, dass die Bevölkerungen dieser Länder bereits zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind. Generell sinkt überall dort, wo sich der Wohlstand ausbreitet, wo in der Folge das Bevölkerungswachstum ausklingt und die Landwirtschaft produktiver wird, der Druck auf die Wälder.
Outgesourcte Waldzerstörung
Die Vorstellung, dass Länder, in denen der Wald wieder an Fläche zulegt, damit groß zum Klimaschutz beitragen, ist allerdings falsch. Denn der wohlhabendere Teil der Welt importiert viele Güter, die im ärmeren Teil auf Flächen produziert werden, auf denen früher Wald stand: Palmöl, Soja, Tropenholz oder Rindfleisch. Auch Deutschland ist stark an dieser importierten Waldvernichtung beteiligt. Zwischen Rügen und dem Bodensee vergrößert sich die Waldfläche zwar geringfügig, um etwa 2.000 Hektar im Jahr. Dafür aber verantworten die Deutschen über ihre Importe die Zerstörung von jährlich 46.600 Hektar Wald an anderen Orten.
So wichtig Waldschutz und Aufforstung sind, die Bäume allein werden das Klima nicht retten können. Viel wichtiger ist es, so schnell wie möglich mit dem Verbrennen fossiler Rohstoffe aufzuhören. Trotz vielfältiger Bekenntnisse der Weltgemeinschaft zum Klimaschutz sind die Kohlendioxid-Emissionen im Jahr 2022 auf ein neues Allzeithoch von 36,8 Gigatonnen angestiegen. 2023 dürfte diesen Wert sogar noch übertreffen. Die großen fossilen Konzerne investieren derzeit Hunderte Milliarden Dollar in die Erschließung neuer Öl- und Erdgasfelder. Notwendig wären nach den Erkenntnissen der Wissenschaft eine Halbierung des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes bis 2030, um zu verhindern, dass aus dem Klimawandel eine Klimakatastrophe wird.
20.11.2023
Leben – Sterben – Umziehen
Warum sich der demografische Wandel leicht erklären, aber schwer beeinflussen lässt
Demografie ist im Grunde eine einfache Wissenschaft. Denn jede Bevölkerung lässt sich mit gerade mal drei Parametern beschreiben: Geburten, Sterbefälle und Umzüge. Wenn man dafür die Fachbegriffe Fertilität, Mortalität und Mobilität benutzt, klingt das Ganze zwar etwas wissenschaftlicher, aber diese Kenngrößen erklären auch nur, wie viele Menschen welchen Alters wo leben.
Nun hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges an den Parametern geändert. Die Fertilitätsraten, also die durchschnittlichen Kinderzahlen je Frau, sinken überall auf dem Globus. Gleichzeitig leben die Menschen länger als früher, weil sich die Daseinsbedingungen in nahezu allen Ländern verbessern. Und schließlich machen sich immer mehr Menschen auf die Wanderschaft. Sie verlassen ihre angestammte Heimat, suchen anderenorts bessere Lebensmöglichkeiten, fliehen vor Krieg und Terror und längst auch vor den Auswirkungen des Klimawandels. Dies alles verändert die Struktur der Bevölkerungen rund um die Welt. Sie werden älter und oftmals gleichzeitig bunter.
Die Familien werden kleiner, wenn es den Menschen bessergeht
Tendenziell sinken die Geburtenziffern, wenn sich Länder wirtschaftlich entwickeln, wenn der Bildungsstand steigt, sich die Rolle von Frauen in der Gesellschaft verändert und die Gleichstellung der Geschlechter verbessert. Dies geschieht in den meisten Ländern. Sie durchlaufen damit einen »demografischen Übergang«, der sie von einer Phase mit vielen Kindern, aber hoher Sterblichkeit in eine Phase mit niedrigen Nachwuchszahlen und hoher Lebenserwartung führt.
Weil aber die verschiedenen Staaten der Welt sozioökonomisch gesehen unterschiedlich weit entwickelt sind, befinden sie sich auch an einem jeweils anderen Punkt des demografischen Übergangs. Deutschland oder Japan liegen beispielsweise ganz vorne, sie sind die Pioniere des Wandels. Die Anzahl der Kinder je Frau liegt bei 1,5 und darunter, die Bevölkerungen altern stark, ohne Zuwanderung schrumpfen sie.
Uganda, Angola oder Niger hingegen befinden sich noch in frühen Phasen des demografischen Wandels. Frau bekommen dort noch vier bis nahezu sieben Kinder. Entsprechend jung sind die Bevölkerungen und sie wachsen rasant.
Diese divergierende Entwicklung teilt die Welt in unterschiedliche Zonen, in denen es demografisch ab- beziehungsweise aufwärtsgeht: Ein globaler Schrumpfgürtel breitet sich von Portugal, Spanien, Italien über Mittel- und Osteuropa, Russland bis nach China, Japan und Südkorea aus. In Westasien, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika ist hingegen bis auf weiteres Wachstum zu erwarten.
Mehr Migration
Das Nebeneinander von Schrumpfen und Wachstum erzeugt sowohl einen demografischen Druck wie auch einen Sog. Druck entsteht überall dort, wo die Bevölkerung so stark wächst, dass nicht alle Menschen mit dem Notwendigen für ein angemessenes Leben versorgt werden können: mit Nahrung und sauberem Trinkwasser, mit der nötigen Infrastruktur von Schulen oder Krankenstationen und vor allem mit Arbeitsplätzen, der wichtigsten Grundlage für eine gesellschaftliche Teilhabe. Das führt zu Unzufriedenheit, vor allem unter den immer größer werdenden jungen Altersgruppen. Und zu Abwanderung. Allerdings bisher nicht zu der lange befürchteten Armutsmigration von Süd nach Nord, sondern eher zu einer Elitenmigration. Denn es wandern meist jene aus, die sich entweder die teuren Passagen von Schlepperbanden erlauben können oder über Qualifikationen verfügen, die ihnen eine Arbeitserlaubnis in den Industriestaaten ermöglichen.
Manche Länder üben auch einen Sog aus, der die Menschen auf die Wanderschaft treibt. Klassische Einwanderungsländer wie die USA, Australien oder Kanada werben seit Jahrhunderten Migranten an, weil sie sich von einer wachsenden Bevölkerung positive Effekte für die Wirtschaft versprechen. Sie machen es den Neuankömmlingen vergleichsweise leicht, ökonomisch Fuß zu fassen und profitieren deshalb massiv von der Zuwanderung. Kanada etwa, das sich verfassungsgemäß als multikulturelle Gesellschaft definiert, verfolgt eine offensive Einwanderungspolitik mit dem Slogan: »Es zählt nicht, wo du herkommst, sondern wo du hinwillst.«
Alt, älter, Europa
Deutschland und andere europäische Staaten sind zwar keine klassischen Einwanderungsländer, müssen sich aber möglichst rasch an jenen Ländern orientieren, die mehr Erfahrung mit Zuwanderung haben. Mit durchschnittlich 1,5 Kindern je Frau ist Europa (Russland mitgerechnet) der erste Kontinent, der aufgehört hat, aus eigener Kraft zu wachsen. Trotz Zuwanderung dürfte die Bevölkerung künftig leicht schrumpfen. Europa wird Mitte des Jahrhunderts noch 8 Prozent der Weltbevölkerung stellen – 1960 waren es noch 20 Prozent. In Europa herrschen die niedrigsten Geburtenziffern aller Kontinente und die Menschen sind im Schnitt am ältesten. 19 Prozent sind bereits 65 Jahre oder älter, in Afrika gilt das nur für 3 Prozent aller Menschen.
Die Alterung der geburtenstarken Nachkriegs-Jahrgänge, der sogenannten Babyboomer, wird die Zahl der Menschen im Erwerbsalter europaweit rasch sinken lassen. In Deutschland wird um das Jahr 2030, dem Höhepunkt der Verrentungswelle der Boomer, jeder Jahrgang, der sich in den Ruhestand verabschiedet, annähernd doppelt so groß sein wie jener, der in das Erwerbsalter hineinwächst.
Die kleiner und älter werdende Schar der Arbeitenden und Steuern Zahlenden muss dann so produktiv sein, dass sie den deutlichen Zuwachs von Personen im Renten- und Pensionsalter finanzieren kann – und bis 2050 zusätzlich die Versorgung doppelt so vieler Pflegebedürftiger wie heute. Wie das gelingen soll, ist bis dato unbekannt.
Die Strategie lautet anpassen
Dass all das so kommen wird, ist seit langem bekannt, denn die Demografie erlaubt die besten Voraussagen aller sozioökonomischen Disziplinen. Gesellschaft und Politik haben allerdings wenig getan, um sich an den Wandel zu anzupassen – etwa die Sozialsysteme demografiefest gemacht oder das Angebot an Arbeitskräften den Bedürfnissen der Wirtschaft entsprechend auszuweiten. Anpassung ist aber die einzige Möglichkeit, mit dem demografischen Wandel umzugehen, denn ein erneutes Wachstum der Bevölkerung lässt sich nicht aus dem Hut zaubern.
Allen internationalen Erfahrungen nach lassen sich die im Rahmen des demografischen Übergangs gesunkenen Kinderzahlen nicht wieder so weit erhöhen, dass es zu einem Bevölkerungswachstum kommt. Der Weg zu kleineren Familien scheint irreversibel. Weder eine gute Familienpolitik noch Geldprämien für Neugeborene, wie sie in Russland und China mittlerweile üblich sind, können den Trend umkehren.
Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit auch nur einigermaßen aufrecht zu erhalten, müsste an sämtlichen Stellschrauben zur Bewältigung des demografischen Wandels gedreht werden. Das heißt: Erstens mehr in Bildung investieren, damit die kleiner werdende Zahl an jungen Menschen möglichst produktiv im Sinne der Gesellschaft werden kann und nur wenige ohne Schulabschluss oder ohne Ausbildung ins Leben entlassen werden. Zweitens das Renteneintrittsalter bei steigender Lebenserwartung weiter erhöhen. Und drittens die Zuwanderung so organisieren, dass ein möglichst großer Teil der Neuankömmlinge einen direkten Weg in den Arbeitsmarkt nimmt – auch um so die Integration zu erleichtern.
An der Kinderzahl je Frau, der Fertilitätsrate, dürfte sich in Deutschland mittelfristig wenig ändern. Die Lebenserwartung wird vermutlich hoch bleiben oder weiter steigen, jedenfalls solange sich die Gesundheitssysteme nach heutigem Muster finanzieren lassen. Von den drei Parametern der Demografie – Fertilität, Mortalität und Mobilität – wird deshalb letzterer die mit Abstand größte Bedeutung erlangen.
26.06.2023
Ausländer rein!
Wie kommt Deutschland an die dringend gesuchten Fachkräfte?
Deutschland war lange – und ist es zum Teil bis heute – eine Art Sehnsuchtsort für Zuwanderer. Die Gastarbeiter in den 1960er Jahren fanden hier eine Beschäftigung und konnten Geld in ihre Heimatländer überweisen. Die Spätaussiedler kamen ins Land ihrer Vorfahren zurück und bekamen gleich einen deutschen Pass in die Hand gedrückt. Die Geflüchteten aus den Jugoslawienkriegen fanden Sicherheit. Das Gleiche gilt für Menschen aus heutigen Krisen- und Kriegsgebieten. Während der Euro-Krise trieb es viele Südeuropäer nach Deutschland, aber die meisten gingen zurück, als sich die Lage in ihren Heimatländern wieder erholt hatte. Die Zuwanderer kamen also aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Viele von ihnen haben nur Arbeit in mäßig gut bezahlten Jobs gefunden. Sie in die Gesellschaft einzubinden, war lange kein erklärtes Ziel. Ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen waren begrenzt. Deshalb gibt es zum Teil erhebliche Defizite bei der Integration. Zugewanderte und deren Nachkommen sind im Schnitt schlechter qualifiziert, häufiger arbeitslos und öfter von Sozialleistungen abhängig als die alteingesessene Bevölkerung. Insgesamt gilt Deutschland nicht als Land, in dem Zuwanderer einfach so durchstarten können. Deswegen zählt das Land heute kaum zu den Sehnsuchtsorten für die Fachkräfte, die wir dringend brauchen.
Keine aktive Zuwanderungspolitik für Qualifizierte
Deutschland hat sich in der Vergangenheit kaum aktiv um qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland bemüht. Die Gastarbeiter sollten schließlich jene Jobs übernehmen, für die sich die Deutschen zu schade waren. Menschen auf der Flucht kommen nicht primär, um als IT-Fachkräfte zu arbeiten. Gewerkschaften und die SPD waren aus Furcht vor Billiglohnkonkurrenz immer skeptisch gegenüber Zuwanderung, getreu dem Motto: „Solange in Deutschland ein Arbeitsloser frei herumläuft, brauchen wir keine Kräfte von außen“. Die CDU hat sich noch gegen die Vorstellung gesträubt ein Zuwanderungsland zu sein, als fast 20 Prozent aller in Deutschland Lebenden einen Migrationshintergrund hatten. Kein Wunder, gelten wir nicht als Land mit einer guten Anwerbepolitik.
Deutschland hat lange von der Arbeitnehmer-Freizügigkeit innerhalb der EU profitiert. Jetzt ist das Potenzial aus EU-Ländern weitgehend erschöpft und der internationale Wettbewerb um Talente hat sich verschärft. Deutschland ist längst nicht das einzige Land, in dem die Babyboomer in Rente gehen und die Arbeitskräfte knapp werden. Wir hätten uns vor Jahren schon attraktiv für Kräfte aus Drittstaaten, also aus Nicht-EU-Staaten machen müssen. Eine erfolgreiche Zuwanderung lässt sich nicht auf Knopfdruck organisieren. Jetzt, wo der Fachkräftemangel zum zentralen Thema für den Wirtschaftsstandort geworden ist, sind wir spät dran.
Deshalb sind Länder, die früh auf eine direkte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gesetzt haben, Kanada, Australien oder die USA, im Vorteil. Dort wird außerdem die Weltsprache Englisch und nicht dieses schwierige Deutsch gesprochen. In den Ländern leben bereits viele erfolgreiche Zuwanderer, an denen sich Neuankömmlinge orientieren können. Zudem bekommen auch Menschen aus Nicht-EU-Ländern mit, dass es in manchen Regionen unseres Landes, vor allem in den östlichen Bundesländern, erhebliche Vorbehalte gegen Menschen aus anderen Kulturen gibt. Dabei ist dort der Bedarf an Fachkräften besonders hoch.
Lässt sich Deutschland als Einwanderungsland für Fachkräfte durch Gesetze attraktiver machen?
Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Ohne zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland kommt kein Spargel in den Supermarkt, brechen Pflege- und Gesundheitssystem zusammen, rollen weniger Autos vom Band und werden auf dem Bau keine Fundamente mehr geschüttet. Im Jahr 2022 konnten bundesweit 630.000 Stellen nicht besetzt werden, weil es schlicht und einfach kein Personal gab, meldet das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die staatliche Bankengruppe KfW bezeichnet den Mangel an Fachpersonal als „einen der größten Hemmschuhe für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland“.
Den Engpass vor Augen, hat schon die letzte Bundesregierung ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, das als eines der liberalsten der Welt galt. Aber es hat sich als wenig wirksam, kompliziert, mit Restriktionen belastet und zu bürokratisch erwiesen, weshalb die Ampelregierung jetzt versucht nachzubessern. Das ist dringend notwendig, denn im Jahr 2030, zum Höhepunkt der Babyboomer-Verrentung, werden sich etwa doppelt so viele Menschen aus dem Erwerbsleben verabschieden, wie gleichzeitig von unten in den Arbeitsmarkt hineinwachsen. Ob die neue Initiative diese Lücken schließen kann, ist fraglich.
Wichtig wäre eine klare Nachricht an die Welt: Wir suchen und brauchen Fachkräfte. Wir gewähren bei Erfolg eine rasche Einbürgerung. Wir haben eine Website, die auf einen Blick und nach einem einheitlichen Muster ersichtlich macht, welche Anforderungen gestellt werden, wo es Arbeit gibt und welches Gehalt gezahlt wird. Wir vermitteln geeignete Fachkräfte direkt an die suchenden Arbeitgeber. Nötig wäre eine Checkliste für potenzielle Bewerber aus Indien, Mexiko oder Senegal: „Welche Papiere und Qualifikationen brauche ich?“, „Wo kann ich die bekommen?“, „Woher bekomme ich eine Arbeitserlaubnis?“ und vor allem „Welche Vorbereitungen kann ich schon in meinem Heimatland erledigen, um eine Einwanderung zügig zu organisieren?“
„Work in Canada“ ist eine solche Website, die als Vorbild dienen kann. Sie kommt deutlich schneller zur Sache kommt als das teutonische Gegenstück „Make it in Germany“. Kanada hat eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Anwerbung von Arbeitskräften und das dortige Punktesystem gilt als eine Art Blaupause für das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Punkte gibt es jenseits des Atlantiks für Sprachkenntnisse, Ausbildung, Berufserfahrung, Alter (am besten zwischen 20 und 29 Jahren) und ein bereits vorliegendes Jobangebot. Ist eine festgelegte Punktzahl erreicht, öffnet sich die Grenze nach Kanada nach dem sogenannten Express Entry. Das klingt schon mal flotter als die „Chancenkarte“, mit der Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die neue Anwerbeinitiative verkaufen will.
Kanada nutzt sein Punktesystem seit Jahrzehnten und hat einen entsprechenden Vorsprung gegenüber Deutschland. Das Land wirbt, bei nicht einmal halb so vielen Einwohnern wie Deutschland, pro Jahr rund 350.000 Zuwanderer an, unabhängig von konjunkturellen Zyklen. 2023 sollen es sogar 465.000 werden. Zusätzlich immt Kanada pro Jahr auch ein festes Kontingent von Geflüchteten auf. Multikulturalismus ist seit 1988 in der Verfassung festgeschrieben und bedeutet, dass Zuwanderer möglichst schnell vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden sollen, mit allen Rechten und Pflichten, ohne dafür die Identität ihrer Herkunft aufgeben zu müssen. Kanada ist zudem stark um die Integration seiner neuen Bürger bemüht. Das zeigt sich unter anderem an der Tatsache, dass die zweite Generation der Zuwanderer im Schnitt besser qualifiziert ist als die alteingesessene Bevölkerung.
Mehr Chancen für Geflüchtete
Deutschland ist nach wie vor attraktiv für Menschen aus Ländern, in denen die Lebensbedingungen deutlich schlechter sind als bei uns. Die Hauptgründe für diese Form von Migration sind die Flucht vor Gewalt und ein massives Einkommensgefälle zwischen den Ländern. Die meisten dieser Menschen machen sich irregulär auf den Weg und versuchen in Deutschland beziehungsweise der EU Asyl zu bekommen. Hierzulande wurden 2022 knapp 250.000 Asylanträge gestellt. Bevor diese möglicherweise positiv beschieden werden, hängen die Menschen in endlosen Anerkennungsverfahren. Sie können in dieser Zeit oft keine Sprachkurse absolvieren oder eine Arbeit aufnehmen. Sind sie im Rahmen des Verfahrens irgendwann „geduldet“, sind Ausbildung und Job zwar erlaubt, aber bei Nichtanerkennung des Asylantrags droht die Abschiebung.
Geduldeten, die über Ausbildung und Arbeit auf gutem Weg zur Integration sind, sollte man den „Spurwechsel“ ermöglichen, sie also über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz aufnehmen. Die CDU lehnt dieses Modell seit langem ab, spricht von Fehlanreizen in der Migrationspolitik. Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, meint, der Spurwechsel sende „ein Signal in die Welt, dass quasi jeder bleiben kann, der es irgendwie geschafft hat“.
Doch diejenigen Asylsuchenden, die bereits im Büro sitzen oder an der Werkbank stehen, zeigen ja schon, dass sie gebraucht werden. Arbeitgeber lassen sie ungern wieder ziehen. Bis dato müssten die Geduldeten erst einmal ihren Asylantrag zurücknehmen, in ihr Herkunftsland zurückreisen, dort eine Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft beantragen und anschließend einen Visumantrag stellen, um dann auf legalen Weg nach Deutschland einzureisen. Das ist, gelinde gesagt, absurd.
03.06.2023
Platz da!
Die Energiewende benötigt Fläche – aber die ist eh schon knapp
Land ist eine begrenzte Ressource. Nicht nur, weil 38 Prozent der weltweiten Landflächen als Äcker und Weiden für die Ernährung von über acht Milliarden Menschen reserviert sind. Weil Straßen, Parkplätze, Wohnhäuser, Industrieanlagen und Gewerbegebiete immer mehr Platz beanspruchen. Sondern auch weil geschätzte 8,7 Milliarden Tier- und Pflanzenarten (womöglich sind es sogar bis zu 100 Milliarden) ihren eigenen, möglichst ungestörten Lebensraum benötigen. Schließlich bilden sie jenes hochvernetzte, globale Ökosystem, ohne das wir Menschen gar nicht existieren könnten. Der Ende 2021 verstorbene amerikanische Insektenforscher und Evolutionsbiologe Edward O. Wilson hat einmal gefordert, die halbe Erde unter Schutz zu stellen, also dem Einfluss des Menschen weitgehend entziehen, um zu verhindern, dass der Planet in das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte taumelt. Heute haben gerade einmal 8 Prozent der Meeresgebiete und 17 Prozent der Landflächen einen mehr der weniger gut funktionierenden Schutzstatus.
Doch jetzt erhöht sich der Druck auf das Land noch einmal: Der dringend notwendige Abschied von fossilen Brennstoffen erfordert eine Energiewende, um eine weitere Erwärmung des Erdklimas zu bremsen. Ohne zusätzliche Windkraftwerke und Solaranlagen in großer Zahl kann sie nicht gelingen. Der Flächenbedarf steigt also noch einmal an. Ein klassisches Dilemma: Um die Klimakatastrophe zu verhindern, werden Flächenfraß und Artensterben in Kauf genommen.
Hehre Ziele – aber schwer zu erreichen
Die EU hat sich zum Ziel gesetzt bis 2030 – also in schlappen sechseinhalb Jahren – die Kohlendioxid-Emissionen um 55 Prozent zu senken. Bis 2050 will das Vereinigte Europa klimaneutral werden. Dafür müssen bis 2030 zusätzliche rund 700 Gigawatt erneuerbarer Stromerzeugungskapazität installiert werden. Das entspricht in etwa der Leistung von 580 größeren Atomkraftwerksblöcken beziehungsweise einer Verdreifachung der Ausbaugeschwindigkeit Erneuerbarer im Vergleich zum Zeitraum 2014 bis 2022. Nach 2030 müsste der Ausbau weiter zügig vorangehen. Aber wo sollen die ganzen Wind- und Solaranlagen stehen?
Das Beratungsunternehmen McKinsey hat untersucht, welche Herausforderungen die Energiewende für die Landnutzung in der EU stellt. Allein in den Ländern Deutschland, Frankreich und Italien, wo etwa die Hälfte der neuen grünen EU-Stromquellen entstehen soll, wäre dafür eine Fläche so groß wie Belgien notwendig. Zudem muss dort verlässlich der Wind wehen beziehungsweise die Sonne scheinen. Es dürfen keine besonders geschützten Gebiete sein und der Abstand von Windturbinen zu Wohngebieten und kritischen Infrastrukturen wie Bahnlinien oder Flughäfen muss eingehalten werden.
In Deutschland kann aufgrund dieser Einschränkungen nach heutiger Regelung auf 82 Prozent der eigentlich für Windenergie geeigneten Flächen keine Turbine zum Laufen kommen. Wo großflächige Solarparks entstehen, treten sie in Konkurrenz zur Landwirtschaft, die auf Sonnenstrahlung ebenso angewiesen ist wie eine Photovoltaikzelle. Zwar gibt es die Idee der Agri-Photovoltaik, bei der Obstanbau oder Schafzucht auch unter den von Solarzellen teilbeschatteten Flächen möglich ist, doch diese Form der Stromerzeugung wird zwangsläufig ein Nischenprodukt bleiben. Die meisten Feldfrüchte brauchen in hiesigen Breiten die volle Besonnung und Mähdrescher werden kaum unter einem Solarpark zum Einsatz kommen.
Eigentlich war Flächensparen angesagt
Der Ausbau der Regenerativen gerät zudem auf Kollisionskurs mit anderen Umweltzielen der Bundesregierung. So ringt deren Nachhaltigkeitsstrategie seit ihrer Erstauflage im Jahr 2002 mit dem ausufernden Flächenverbrauch im Land. Damals verschlangen neues Bauland, Gewerbegebiete und Verkehrswege jeden Tag 120 Hektar. Sinn und Zweck der Nachhaltigkeitsstrategie waren es, diesen Flächenfraß bis 2020 radikal zurückzufahren – auf 30 Hektar pro Tag, immerhin noch eine Fläche von 42 Fußballfeldern.
Wie viele andere Umweltziele aus der Strategie wurde auch dieses verfehlt. De facto gingen auch 2020 noch jeden Tag 54 Hektar verloren, meist waren es vorherige Landwirtschaftsflächen. Das lag zum einen am mangelnden Willen von Kommunen sich an die Nachhaltigkeitsvorgaben zu halten. Zum anderen zeigt es, wie schwer es ist, übergeordnete Ziele wie Natur- und Klimaschutz in der Praxis umzusetzen – vor allem dann, wenn sie sich widersprechen: Die Energiewende, so notwendig sie ist, macht es praktisch unmöglich das Nachhaltigkeitsziel in Sachen Flächenverbrauch zu erreichen.
Immerhin gibt es Vorschläge, wie sich der Ausbau der regenerativen Energie einigermaßen schonend voranbringen ließe: Etwa für Solarenergie Flächen zu nutzen, die ohnehin schon zugebaut sind, wie Hausdächer, Parkplätze und Autobahnrandstreifen. Das Repowering von Windkraftwerken, also der Austausch alter Anlagen durch neue, leistungsstärkere, ohne dabei zusätzliche Flächen zu beanspruchen. Oder Bürgerwindparks, bei denen Kommunen wie auch Anwohner am Profit beteiligt werden. Damit lassen sich Widerstände und Proteste gegen die Anlagen minimieren, die auf der sogenannten Nimby-Mentalität beruhen. Das steht für „not in my backyard“ und beschreibt die generelle Zustimmung vieler Bürgerinnen und Bürger zu einer Energiewende nebst ihren technischen Anlagen – „aber bitte nicht in meinem Hinterhof“.
27.05.2023
Am Ende der Röhre
Weniger Primärschäden an der Umwelt anzurichten ist besser als Sekundärschäden zu beseitigen
Wer erinnert sich noch an das Waldsterben der 1980er Jahre? In den Hochlagen des Harz, im Schwarzwald und vor allem im Erzgebirge wurden die Nadelbäume braun und schütter, der Borkenkäfer gab ihnen den Rest und auf weiten Flächen ging der deutsche Forst zugrunde. Nach längerem Streit über die Ursachen des Desasters wurde klar, dass eine komplexe Wirkungskette zu dem Niedergang beigetragen hatte, die Hauptschuld aber beim Sauren Regen lag.
Was damals vom Himmel fiel, waren Tropfen, in denen sich säurebildendes Schwefeldioxid und Stickoxide angereichert hatten. Die Substanzen stammten aus den Abgasen von Kohlekraftwerken, Fabriken und Verbrennungsmotoren, also aus jenen fossilen Brennstoffen, mit denen die Industrienationen ihren wirtschaftlichen Erfolg befeuert hatten.
Die Verursacher stritten erst einmal jeden Zusammenhang zwischen den Emissionen und dem toten Wald ab. Sie bauten höhere Schornsteine als vermeintliche Problemlösung, doch die verschoben nur die giftige Fracht nach Skandinavien ‒ wo dann die Fische in den Seen starben. Bald darauf wurden die Emittenten gezwungen den Ausstoß von verbranntem Stickstoff und Schwefel massiv zu reduzieren. Hierzulande sorgte insbesondere die „Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ dafür, dass die Schlote Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen verpasst bekamen, die Neuwagen Katalysatoren. Dass auch die meisten Giftschleudern der ehemaligen DDR mit dem Ende derselben ihre Emissionen beendeten, war zwar durch den Zusammenbruch des politischen Systems bedingt, aus Sicht des Umweltschutzes aber überaus hilfreich. In der Folge profitierten auch Kulturdenkmäler wie der Kölner Dom oder die Lungen der Menschen von der saubereren Luft. Und der Wald erholte sich wieder einigermaßen, so dass Kritiker behaupteten, die ganze Aufregung um das Waldsterben sei Hysterie und völlig übertrieben gewesen.
Der Wald bleibt auf der Intensivstation
Das Problem schien gelöst. Und zwar mit technischen Mitteln. Im Ingenieurssprech: „mit einer dem eigentlichen Herstellungsprozess nachgeschalteten, additiven, ökologieorientierten Verfahrensinnovation“. Mit Filtern und Katalysatoren war es gelungen, die bei der Verbrennung von Kohle und Erdölprodukten anfallenden, unerwünschten Säurebildner weitgehend einzufangen beziehungsweise unschädlich zu machen. Das wurde als große Leistung des Umweltschutzes gefeiert.
Doch so ganz hat sich der deutsche Wald nie erholt. Mittlerweile, 40 Jahre nach dem ersten Exitus der Bäume, geht es dem Forst gesundheitlich schlechter als je zuvor. Der Waldzustandsbericht der Bundesregierung, der den durchschnittlichen Zustand von Fichte, Buche, Kiefer und Co. beschreibt, vermerkt deutliche Auflichtungen an jedem dritten Baum. Nur jeder fünfte macht einen gesunden Eindruck. Doch heute ist es weniger der Säureangriff, der für das Waldsterben 2.0 sorgt, sondern der Klimastress, also Hitze und Trockenheit. Hinzu kommt weiterhin der Stickstoffeintrag aus Quellen, aus denen er sich nicht herausfiltern lässt, vor allem aus dem Ackerbau und der Viehwirtschaft. Der Regen trägt die Stickstoffverbindungen in den Waldboden und überdüngt ihn. Dadurch wachsen die Bäume zwar schneller, werden aber anfälliger für Krankheiten. Forstschädlinge, die sich in warmen, trockenen Sommern prächtig vermehren, geben dem Wald dann den Rest. Die Fichte, die häufigste Baumart Deutschlands, für die 2022 ein neuer Absterbe-Rekord gemeldet wurde, dürfte auf Flächen unterhalb von 600 Höhenmetern keine Zukunft mehr haben.
Präventives Handeln wäre besser gewesen
Die Umweltschutzmaßnahmen vor vier Jahrzehnten konnten den Wald also doch nicht retten. Das Problem an dem vermeintlichen Erfolg war, dass es sich bei der Abgasnachbehandlung um eine sogenannte „End of the Pipe Technology“ handelte, eine Technik, die ganz am Ende des Nutzungsprozesses ansetzt. Nach dem Motto: Wir haben erkannt, dass beim Verfeuern von Kohle und Erdölprodukten ein paar eklige Nebenprodukte entstehen, die fischen wir aber am Ende des Produktionsprozesses, „am Ende der Röhre“, heraus und machen ansonsten munter weiter. Man hätte aber auch am Anfang der Röhre ansetzen und generell weniger fossile Brennstoffe einsetzen können ‒ nach dem damaligen Wissensstand in Sachen Klimawandel hätte man es sogar tun müssen. Man hätte schon in den 1980er Jahren eine Energiewende einleiten, in Energieeffizienz investieren, regenerative Versorgungsmöglichkeiten schneller erforschen und nutzen können, um sich unabhängig von Kohle, Öl und Erdgas (wie auch von despotischen und kriegstreibenden Lieferanten) zu machen. In diesem Fall wäre es ein Leichtes gewesen, noch vor 2050 klimaneutral zu werden und das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Umwelttechniken, die am Ende der Röhre ansetzen, sind weit verbreitet und sie beruhen auf einer menschlichen Grundeigenschaft: Der Homo sapiens ist nur wenig mit Vorsorgedenken ausgestattet, aber relativ erfinderisch darin, Methoden zu entwickeln, mit denen sich ein Schaden, der einmal angerichtet ist, wieder zusammenkehren lässt. Das ist zwar teuer und funktioniert angesichts weltumspannender Probleme immer schlechter, erfreut sich aber wachsender Beliebtheit.
So besteht eine dieser Methoden darin, Kunststoffmüll aus den Ozeanen herauszufischen. Das ist eine ziemliche Sysiphus-Arbeit. Sie vermag bei gewaltigem Aufwand nur einen unbedeutenden Bruchteil der mindestens 14 Millionen Tonnen Plastik zu bergen, die jedes Jahr in den Meeren landet. Weniger Müll in die Ozeane zu kippen wäre einfacher gewesen. Eine weitere tolle Erfindung besteht darin, Gletscher im Sommer mit Stoffbahnen aus Kunststoff abzudecken, um die schwindenden Eisströme vor der Erderwärmung zu schützen. Auch das ist weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal die Herstellung und das Ausbringen der Folien zusätzliche Kohlendioxid-Emissionen verursachen und damit die Eisschmelze eher beschleunigen als bremsen.
Wohin mit dem ganzen Kohlendioxid?
Die ultimative End of the Pipe Technology verbirgt sich hinter der Idee, das Treibhausgas Kohlendioxid, von dem die Menschheit 2022 über 35 Milliarden Tonnen in die Atmosphäre entlassen hat, wieder einzufangen, es chemisch zu nutzen, irgendwie unschädlich zu machen oder unterirdisch in geeigneten geologischen Formationen zu lagern, in der Hoffnung, dass es dort dauerhaft bleibt. Entgegen allen Vorsätzen zum Klimaschutz haben die CO2-Jahresemissionen 2022 einen neuen Rekordwert erreicht.
Weil die wachsende Menschheit nur schwer und viel zu langsam von den fossilen Brennstoffen lassen kann, scheint die CO2-Abscheidung und Speicherung mittlerweile der einzige Ausweg zu sein, den Klimawandel auch nur einigermaßen zu begrenzen. Ob sich auf diesem Weg die Emissionen wie angedacht bis 2050 auf Netto-Null reduzieren lassen, ist allerdings mehr als fraglich.
Offiziell läuft die Methode der CO2-Abscheidung und Speicherung unter der Bezeichnung „Carbon Capture, Utilization and Storage“ (CCUS). Capture, das Einfangen, bietet sich vor allem bei großen Emissionsquellen an, etwa bei Kohlekraftwerken, bei der Zement- und Ammoniakproduktion oder bei der Wasserstoffherstellung aus Erdgas. Die Abgase dieser Anlagen müssen dazu von anderen Gasen sowie Verunreinigungen befreit und unter Druck so weit heruntergekühlt werden, dass sich das CO2 verflüssigt. Anschließend kann das unerwünschte Klimagas in Pipelines (die noch gebaut werden müssen) oder besonderen Tankschiffen (die bisher Erdgas aufnehmen) dorthin transportiert werden, wo es in das Erdreich verpresst werden soll, etwa in leergepumpte Öl- oder Gasfelder. Derzeit sind etwa 15 CCUS-Knotenpunkte weltweit in der Erkundung. Das sind Orte, an denen verschiedene Unternehmen ihr CO2 abliefern können, um Kosten zu sparen und das Verfahren effizienter zu machen. Langfristig soll es einmal ein paar tausend dieser Sammelstellen geben.
Es ist offensichtlich, dass für das CCUS erst einmal eine größere Infrastruktur mit dem entsprechenden Rohstoffverbrauch aufgebaut werden muss und dass das Verfahren energieintensiv ist. Das gilt insbesondere dann, wenn das eingefangene CO2 nicht ins Erdreich entsorgt wird, sondern als sogenannter Rohstoff weiterverwendet werden soll. Denn aus dem Abgas lassen sich auf chemischem Weg wieder einfache Kohlenwasserstoffe herstellen und daraus Chemikalien, Kunststoffe oder synthetische Treibstoffe – quasi eine Umkehrung des ursprünglichen Verbrennungsprozesses. Aufgrund der thermodynamischen Gesetze muss allerdings für die Wiedergeburt der Kohlenwasserstoffe aus CO2 mehr Energie aufgewendet werden, als bei der Verbrennung frei wurde. Das Perpetuum mobile ist dummerweise noch nicht erfunden.
Damit eröffnet die End of the Pipe Technology CCUS zwar theoretisch eine Möglichkeit, CO2 von der Atmosphäre fernzuhalten, aber unter enormem Aufwand und zu hohen Kosten. Das Beratungsunternehmen McKinsey schätzt, dass sich die CO2-Einfang- und Lagerungskapazitäten bis 2050 ver120fachen müssten, damit die Welt dann pro Jahr 4,2 Milliarden Tonnen CO2 loswird. Die Investitionskosten lägen bei 130 Milliarden US-Dollar in jedem einzelnen Jahr bis zur Jahrhundertmitte. Nur so ließe sich das Null-Emissionsziel erreichen. Andere Analysen gehen sogar davon aus, dass die zweieinhalbfache Menge an CO2 unschädlich gemacht werden muss, bei entsprechender Kostensteigerung.
Den ganzen Aufwand könnte man sich allerdings auch schenken, wenn einfach keine Kohle, kein Öl und kein Erdgas mehr gefördert und verheizt würden. Das wäre mal ein vorausschauender Umweltschutz.
17.04.2023
Wenn der Klimaschutz Natur zerstört
Die Energiewende erfordert Unmengen von Rohstoffen, die oft in ökologisch wertvollen Gebieten der Entwicklungsländer gefördert werden
Die Idee ist bestechend: Wir hören Zug um Zug auf, Kohle, Öl und Erdgas zu verheizen und nutzen stattdessen jene Energiequellen, die umsonst und im Überfluss zur Verfügung stehen: Wind und Sonne helfen unsere Volkswirtschaften binnen weniger Jahrzehnte klimaneutral zu machen. Das bedeutet zwar eine Energierevolution, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Mithilfe von Windturbinen, Solaranlagen, Wasserstoff-Produktionsanlagen, Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen wird sie aber schon gelingen. Technisch ist alles machbar.
Doch leider ist diese Energiewende zunächst einmal alles andere als umweltfreundlich. All die technischen Wunderwerke werden schließlich nicht aus Knäckebrot gebaut, sondern erfordern gewaltige Mengen an Beton und Stahl, bei deren Herstellung bekanntlich das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) anfällt. Allein die Zementindustrie ist für rund acht Prozent der globalen CO2–Emissionen verantwortlich. Vor allem aber benötigt die energetische Transformation viele Metalle, die meist nur als Erze im Erdreich vorkommen und unter großem Energieaufwand geschürft und zu Reinmetallen raffiniert werden müssen.
In einem E-Auto sind sechsmal mehr so genannte kritische Metalle verbaut als in einem klassischen Verbrenner. Ein Windkraftwerk an Land zu errichten verschlingt neunmal mehr dieser Rohstoffe als der Bau eines herkömmlichen Gaskraftwerks. Der Abschied von der fossilen Ära bedeutet eine gewaltige Materialschlacht.
In Batterien für Elektro-Autos stecken Kobalt, Mangan, Nickel und Lithium. Die Permanentmagnete für Windturbinen und Elektromotoren benötigen seltene Erden, Elemente, die zwar nicht unbedingt selten, aber meist nur als Beimischung zu anderen Mineralien vorkommen und aufwändig zu isolieren sind. Gallium ist ein zentraler Bestandteil von Photovoltaikzellen. Platin und Palladium stecken in Katalysatoren, ohne die eine Wasserstoffsynthese nicht möglich ist. Molybdän, Selen oder Chrom sind in Brennstoffzellen notwendig, die in der Energiewende eine wichtige Rolle spielen können. Und ohne Kupfer fließt kein Strom durch die Leitungen.
Die Produktion kritischer Metalle habe sich im vergangenen Jahrzehnt bereits erheblich ausgeweitet, schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Aber das ist nichts im Vergleich zum künftigen Bedarf: Weltweit dürfte sich Studien zufolge die Nachfrage nach Kupfer von jährlich 25 Millionen Tonnen im Jahr 2020 bis 2050 auf 50 Millionen Tonnen verdoppeln. Die von Lithium und Kobalt dürfte sich fast verzwanzigfachen, der von Nickel verdreißigfachen. Der wachsende Bedarf wird die Preise steigen lassen – und die Rohstoffförderer beflügeln, immer neue Minen zu eröffnen.
Outsourcing von Umweltschäden
Die meisten dieser kritischen Metalle stammen aus Ländern mit lascheren Umwelt- und Sozialstandards als in Deutschland. Berg- und Tagebau bedeuten massive Eingriffe in die Umwelt. Es kommt zu Kahlschlag am Urwald, Straßen werden durch das Land geteert, Siedlungen für die Minenarbeiter hochgezogen. Wo der Wald fehlt, erodiert das Land. Die Auswaschungen der Erzförderung gelangen in die Gewässer und vergiften sie.
Der Import der begehrten Rohstoffe für den Klimaschutz hübscht zwar die heimische Energie- und Umweltbilanz auf, er belastet aber die der Exportländer. Auch weil der Abbau im Süden ungleich zerstörerischer ist, als wenn er in den Industrieländern mit ihren strengeren Vorschriften stattfinden würde. Benedikt Sobotka, der Vorstandschef des kasachischen Bergbaukonzerns Eurasian Resources Group, hält es deshalb für verlogen, wenn sich die Menschen hierzulande ein E-Auto kaufen und Solarzellen aufs Dach schrauben, die umweltgefährdenden Bergwerke und Metallschmelzen in Indonesien, China oder Bolivien dabei aber ausblenden.
Deutschland gehört zu den größten Importeuren kritischer Metalle. Nicht nur weil hierzulande die Energiewende vorangetrieben wird, sondern auch weil wir, nach China und den USA, das Land mit der weltweit drittgrößten Ausfuhr von Gütern sind, in denen diese Metalle verbaut sind. Unsere famose Exportbilanz und die damit verbundenen Wohlstandsgewinne bauen zu einem guten Teil auf der Einfuhr von Materialien, die anderswo Umweltschäden verursachen.
Besonders problematisch wird das Outsourcing, wenn der Bergbau in ökologisch wertvollen Gebieten stattfindet. Etwa im ecuadorianischen Tal des Flusses Intag. Es liegt in der Provinz Imbabura rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Quito zwischen dem tropischen Tiefland und den bis zu 5.000 Meter hohen Bergen der Kordilleren, jenem Faltengebirge, das sich von Alaska über die Rocky Mountains und die Anden bis Feuerland erstreckt.
Die extremen topografischen Unterschiede machen die Intag-Region zu einem Mosaik aus Ökosystemen, mit ausgedehnten, nebelverhangenen Bergregenwäldern und einzigartiger Flora und Fauna. Die tropischen Anden zählen zu den 36 weltweiten „Biodiversitäts-Hotspots“. Das sind Gebiete von großer, aber bedrohter Artenvielfalt. Hier finden sich viele endemische Spezies, also Tiere und Pflanzen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, beziehungsweise bald nicht mehr geben dürfte. Denn einige der seltenen Frösche, Schlangen oder Vögel könnten demnächst aus dem Archiv der Arten verschwinden, weil die Regierung von Ecuador immer neue Schürfrechte an nationale und internationale Bergbaukonzerne vergibt.
Kupfer unter dem Regenwald
Die Jahrmillionen dauernde geologischen Auffaltung des Andenzuges hat alle möglichen mineralischen Ablagerungen in die obere Erdkruste verschoben, darunter Gold, Silber und vor allem Erze von Kupfer. Sie blieben lange unangetastet, weil das Intag-Tal abgelegen und schwer zugänglich ist. Das aber hat sich mit dem Rohstoffhunger und dem Wunsch nach Klimaschutz und Energiewende geändert.
Derzeit plant die staatliche Minengesellschaft von Ecuador Enami gemeinsam mit dem nationalen chilenischen Kupferkonzern Codelco, dem weltweit größten seiner Art, mit der Llurimagua-Mine ein drei Milliarden US-Dollar schweres Projekt zum Abbau von Kupfer und Molybdän im Intag. Auf knapp 50 Quadratkilometern soll die Natur aufgerissen werden, eine Fläche, so groß wie die fränkische Stadt Coburg. Llurimagua befindet sich in der erweiterten Erkundungsphase, 2024 könnte der Abbau beginnen. Die Explorateure versprechen sich einen Ertrag von 210.000 Tonnen Kupfer im Jahr über gut ein Vierteljahrhundert. Dafür müsste allerdings die gigantische Menge von 3,8 Milliarden Tonnen Gestein ans Tageslicht geholt werden, weil das Kupfererz lediglich 0,44 Prozent des gesuchten Metalls enthält.
Doch seit April dieses Jahres steht das Projekt auf der Kippe. Denn Ecuadors Verfassung erkennt die Natur als Rechtssubjekt an. Das ist einmalig auf der Welt und bedeutet, dass Naturräume per se schützenswert sind. Menschen können, im Namen der Natur, gegen deren Zerstörung klagen. Ein Gericht hat nun das Projekt Llurimagua erst einmal gestoppt, weil die Regierung den von der Mine betroffenen indigenen Kommunen keine Informationen zur und kein Mitspracherecht bei der Vergabe der Konzession gewährt hat, wie es eigentlich vorgeschrieben ist.
Jetzt haben die Anwälte in dem Kampf David gegen den Goliath in Gestalt der Kupferkonzerne das Sagen. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Entweder gewinnen die Gegner des Projektes. Dann bleiben der Umwelt im Intag tiefe Narben erspart und die Energiewende in den Industriestaaten verzögert sich oder wird zumindest teurer. Oder Schaufelbagger und Dynamit rücken dem ökologisch einzigartigen Gebiet zu Leibe, das arme Ecuador erzielt wichtige Einnahmen und der reiche Norden steuert weiter in aller Ruhe seine von grünem Strom angetriebenen SUVs durch die Lande.
08.02.2023
Einfach nur blöde
Von der gefährlichen Lücke zwischen Wissen und Handeln im Klimaschutz
(und bei anderen Umweltthemen)
Die gute Nachricht zuerst: Das Wissen, welchen Effekt Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan oder Lachgas auf die Temperaturen der erdnahen Luftschichten haben und was ein vom Menschen verursachter Ausstoß dieser Gase für das Weltklima bedeutet, ist so groß wie nie zuvor. Es gibt kein Erkenntnisproblem. Auch das Wissen, wie die Menschheit den damit verursachten Klimawandel zumindest soweit bändigen könnte, dass sich der Anstieg der globalen Mitteltemperaturen auf 1,5 bis 2 Grad begrenzen ließe, ist vorhanden. Noch einmal: kein Erkenntnisproblem.
Immerhin spricht es für einen gewissen Realitätssinn, dass die Mehrheit der Menschheit sich Umfragen zufolge der Gefahren des menschengemachten Klimawandels bewusst ist. Was bisher jedoch fehlt, sind angemessene Reaktionen, um ihn zu begrenzen und irreversible Folgen für Menschen und Ökosysteme zu vermeiden. Die Wissenschaft kennt diese Art von Bewusstseinsspaltung als Knowing Doing Gap. Damit sind Zweifel am kumulativen Gesamtverstand der Menschheit angebracht. Immerhin steuern wir vom Holozän, einem Zeitalter mit ökologisch weitgehend stabilen Verhältnissen, unter denen die menschliche Zivilisation überhaupt erst möglich wurde, in ein neues Zeitalter, das von hoher Instabilität gezeichnet ist. Im Anthropozän wird menschliches Überleben nicht mehr wie gewohnt möglich sein.
Von der Psychologie der Untätigkeit
Warum aber, muss sich ein jeder nüchtern denkende Homo sapiens fragen, sind die Menschen so bescheuert, dass sie nicht in der Lage sind von der Erkenntnis zum Handeln zu kommen. Warum steuern sie sehenden Auges in den Untergang?
Die Frage ist nicht so komisch, wie sie klingt. Sie beschreibt das Grunddilemma unserer Spezies: Einerseits sind wir von archaischen Trieben gesteuert, die uns zwingen Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser oder Sexualität zu befriedigen. Auch leiden wir, evolutionär bedingt, an einer Gier nach mehr und sehnen uns nach Anerkennung, was bei modernen Menschen schon einmal dazu führen kann, sich ein tonnenschweres SUV oder ein Ticket für einen Weltraumflug zu kaufen. Andererseits besitzen wir ein in der Natur einzigartiges Gehirn, das theoretisch in der Lage ist, uns ein auf dem verfügbaren Wissen aufbauendes Handeln zu ermöglichen. Ein solches Handeln könnte man als vernunftbasiert bezeichnen. Immerhin ist die Vernunft eine Eigenschaft, über die nur wir Menschen verfügen. Allerdings wusste schon Platon, dass die Vernunft stets im Wettstreit mit den zwei weiteren „Seelenteilen“ steht, der Begierde und dem Mut, und dabei häufig schlechte Karten hat. Anders ausgedrückt: Der Vernunft stehen immer die Gefühle gegenüber. Und die haben oft das letzte Wort.
Sicher ist, dass es eine ganze Reihe von Faktoren gibt, die uns davon abhalten vernünftig zu handeln. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von der Psychologie der Untätigkeit. Wie ist sie zu erklären?
Zunächst einmal ist unser Gehirn nicht primär dafür gebaut, unser Verhalten vernünftig im Sinne des Klimaschutzes zu steuern. Es hat sich im Laufe der Evolution als Anpassung an die jeweiligen Lebensbedingungen zu jenem leistungsfähigen Organ entwickelt, das den Homo sapiens zum Dominator der Ökosphäre gemacht hat. Auf diesem Weg waren kurzfristige Erfolge und impulsive Entscheidungen wichtiger (und damit genetisch erfolgreicher) als das Nachdenken über langfristige Folgen des Handelns. Der schnelle Gewinn und die akute Gefahrenabwehr haben unseren urmenschlichen Vorfahren ein Überleben gesichert. Sie prägen uns bis heute.
Dummerweise sind diese Reaktionsweisen denkbar ungeeignet, um auf unsichtbare und nicht unmittelbar bedrohliche Probleme zu reagieren, wie den Klimawandel, das Artensterben oder neue Krankheitserreger, von denen wir lediglich wissen, dass sie einmal um sich greifen werden, aber nicht, wann und wo und mit welchen Folgen. Zudem liegen Ursache und Wirkung dieser Phänomene räumlich wie auch zeitlich weit auseinander. Auch wenn eindeutig belegbar ist, dass wir Menschen die Ursache dieser Probleme sind, tun wir uns schwer damit, sie gar nicht erst entstehen zu lassen, also vorsorglich zu handeln.
Die Macht der Gewohnheit
Wie stark wir uns immer wieder von kurzfristigem (Lust-)Gewinn steuern lassen, kann ein(e) jede(r) an sich selbst testen: Wir steigen ins Flugzeug, auch wenn wir die Klimafolgen kennen. Wir schieben den Rinderbraten in den Ofen, obwohl das Fleisch weder der eigenen Gesundheit noch dem Klima gut tut. Wir fahren Auto, auch wenn Bahn oder Rad uns umweltfreundlicher ans Ziel bringen würden. Wir tun all das, weil es einfach und möglich ist. Weil wir es immer schon getan haben. Die Macht der Gewohnheit ist schlecht für die Umwelt.
Interessanterweise sind Ressourcenverbrauch und Klimaschäden bei jenen sozialen Gruppen am höchsten, die am meisten Umweltbewusstsein und die beste Bildung aufweisen. Häufig sind das die Wählerinnen und Wähler grüner Parteien. Diese Personen denken zwar umweltverantwortlich und glauben auch so zu handeln, etwa, wenn sie ein E-Auto fahren oder Bio-Lebensmittel kaufen. Sie können sich aber aufgrund ihres überdurchschnittlichen Einkommens mehr Produkte aller Art oder Dienstleistungen wie Urlaubsreisen leisten als Ärmere. Gerade für besser Verdienende bedeutet Konsumverzicht weniger Komfort und häufig Spaßverlust.
Vermeintlich Umweltbewusste erliegen dabei gerne dem sogenannten Single Action Bias: Sie überschätzen einzelne Aktionen in ihrer Wirkung und betreiben so eine Art Greenwashing für das eigene Gewissen. Sie verzichten auch mal auf Fleisch, unterschreiben eine Petition zum Verbot von Plastikstrohhalmen, verabscheuen Wegwerfbecher, kaufen Recycling-Klopapier und haben erst einmal genug für die Umwelt getan.
Viele Unternehmen nutzen den Single Action Bias, auf den Verbraucher gerne reinfallen, in ihren Werbestrategien: Der Autohersteller, der sein SUV mit den „veganen Ledersitzen“ anpreist. Der Discounter, der „klimaneutrale“ Sneaker verkauft, die zum Teil aus recycelten PET-Flaschen bestehen. Der Touristikanbieter, der CO2-neutrale Flüge anbietet, weil er Emissionen kompensiert, etwa durch Baumpflanzungen, von denen kein Mensch weiß, wieviel CO2 sie einmal aufnehmen werden und ob sie die nächste Abholzung oder den nächsten Waldbrand überstehen. Derartige Angebote sind eine Art Ablasshandel dafür, dass die Ablasszahler mit dem Kauf eines vermeintlich umweltfreundlichen Produktes nichts an ihrem Lebensstil verändern müssen. Wenn sie wirklich umweltfreundlich handeln wollten, müssten sie auf SUV, Sneakers und Flugreise verzichten.
Ein anderer Grund für das Nichthandeln ist die so genannte Verantwortungsdiffusion: Deutschland, so das Argument, sei lediglich für zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Was also bringt es, wenn wir weniger heizen, konsumieren, Auto fahren? Sollen doch erstmal die großen Emittenten in den USA, China oder Katar etwas tun. Erst mal die anderen und dann ich. Und weil die anderen nicht auf die Bremse treten, muss ich auch nichts tun.
Wer so argumentiert, denkt allerdings in zweifacher Hinsicht falsch: Erstens sind zwei Prozent der aktuellen weltweiten Emissionen eine ganze Menge, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir Deutschen nur ein Prozent der Weltbevölkerung stellen. Damit sind wir doppelt so klimaschädlich wie der Rest der Welt. Zweitens ist Deutschland für 5,7 Prozent der kumulierten Emissionslast verantwortlich. Das sind die Emissionen, die über die Jahre entstanden sind, die heute in der Atmosphäre wabern und de facto den Klimawandel verursachen. Hierzulande jede Tonne CO2 einzusparen ist also dringend geboten.
Ignorieren, verdrängen, leugnen
George Marshall, der Chef der britischen Organisation Climate Outreach, meint, unser Gehirn sei darauf programmiert, große Menschheitsprobleme wie den Klimawandel schlichtweg zu ignorieren. Die Aufgaben seien zu groß und zu komplex. Die Erkenntnis, Mitverursacher des Problems zu sein, lähme die Menschen und führe zur kompletten Verdrängung. Sie reicht bestenfalls für ein schlechtes Gewissen. Menschen haben nur begrenzte Kapazitäten sich über multiple Krisen Sorgen zu machen. Dass wir mittlerweile alles über die Folgen des Klimawandels wissen, hilft da wenig. Im Gegenteil: Noch eine Studie zum Abschmelzen der Polkappen oder noch eine Prognose über die nächste Dürreperiode verursachen nur Ohnmachtsgefühle.
Tatsächlich sind die Herausforderungen enorm: Um dem Klimawandel Einhalt zu gebieten, reicht es nicht, wenn wir den Ölbrenner im Keller durch eine Wärmepumpe ersetzen oder das Privatauto abschaffen. Klimaschutz funktioniert nur, wenn wir – und zwar weltweit – so gut wie alles verändern: Unsere Siedlungsstrukturen, unsere Ernährung, unsere Mobilität, unsere Landwirtschaft, unseren Alltagskonsum, unser Wirtschaftsweise. Die Menschheit müsste auf dem Weg zur Klimaneutralität in kürzester Zeit eine technisch-gesellschaftliche Transformation bewältigen, die sie noch nie in der Geschichte auch nur annähernd geleistet hat. Dazu wäre ein kompletter Systemwechsel nötig, von dem wir allerdings nicht wissen, wie er konkret auszusehen hätte, wie er zu organisieren und vor allem politisch umzusetzen wäre.
Deshalb ist die Verdrängung auch auf politischer Ebene verbreitet. Bisher hat sich in Deutschland keine Partei getraut, den Menschen zu sagen, was es für sie konkret bedeuten würde, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Zwar machen sich alle Bundestags-Parteien, mit Ausnahme der AfD, mehr oder weniger für den Klimaschutz stark. Sie kommen aber über Absichtsphrasen wie grünen Wasserstoff, das Ende des Verbrennungsmotors oder eine CO2-freie Zementindustrie kaum hinaus. Diese technischen Lösungen liegen jedoch irgendwo in der Zukunft und sind zudem nicht CO2-frei, sondern bestenfalls CO2-arm. Maßnahmen, die eine sofortige Wirkung entfalten würden, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen oder eine Leistungs- und Gewichtsobergrenze für PKW, scheuen jedoch alle Parteien.
Stattdessen verschanzen sie sich hinter Absichtserklärungen, wie dem 1,5-Grad-Ziel auf der UN-Klimakonferenz in Paris oder hinter der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die klare Vorgaben in Sachen Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen oder Flächenverbrauch macht. Ziele vorzugeben ist allerdings einfacher, als sie zu erreichen. Trotz des Vertrags von Paris laufen die von der Staatengemeinschaft angekündigten, aber bei weitem nicht eingelösten Klimaschutzbemühungen auf einen Temperaturanstieg von etwa 2,5 Grad hinaus. Auch die Kernziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie werden allesamt verfehlt, obwohl das Zieldatum bereits einmal verschoben wurde. Es scheint, die Ziele seien einzig dazu da, die Wählerschaft ruhig zu stellen: „Wir haben verstanden, wir tun was.“ So geht Verdrängen auf politischer Ebene.
Eine besondere Form des Verdrängens ist das Leugnen. Jeder Mensch kennt das. Wenn man ein Problem abstreitet, ist es erst einmal verschwunden. Und wenn es ein Problem gar nicht gibt, muss man auch nichts ändern. Wir bauen uns die Welt nun mal gerne so, wie sie uns gefällt. Glauben ist einfacher als Wissen und Handeln. Das gilt beispielsweise für mehr als die die Hälfte der Evangelikalen in den USA, die immerhin 25 Prozent der Gesamtbevölkerung und die wichtigsten Stammwähler der republikanischen Partei stellen. Diese Gruppe geht davon aus, dass Christus noch vor dem Jahr 2050 auf die Erde zurückkehrt. Der Heiland findet den Planeten zwar in totalem Chaos vor (das ist ja der Grund für seine Rückkehr), wird dann aber alles richten. Warum also jetzt etwas gegen den Klimawandel tun?
Gier vor Vernunft
Kriminell wird es, wenn große Unternehmen selbst verursachte Umweltschäden wider besseres Wissen leugnen. Etwa der amerikanische Mineralölkonzern Exxon (heute Exxon Mobile), dem bereits in den 1970er Jahren eigene wissenschaftliche Ergebnisse über den Effekt der Verbrennung fossiler Reserven auf globale Erwärmung vorlagen, der diesen Zusammenhang aber jahrzehntelang öffentlich abstritt. Die Exxon-Untersuchungen, die erst jüngst im Detail bekannt wurden, konnten die Klimafolgen sogar besser vorhersagen als die US-Raumfahrtbehörde Nasa, die damals eine der führenden Expertengruppen der Klimaforschung stellte. Der Exxon-Forscher James Black sagte eine Warmzeit voraus, die die Menschheit noch nicht erlebt hat.
James Hansen, Direktor des Goddard Institutes für Weltraumwissenschaften der Nasa, hatte sich 1988 weit aus dem Fenster gelehnt und vor dem amerikanischen Kongress zu Protokoll gegeben, dass die globale Erwärmung „mit 99-prozentiger Sicherheit“ auf das Konto der Menschen gehe. Hansen wurde daraufhin der Panikmache bezichtigt und von vielen Seiten massiv kritisiert, unter anderem von jenem Konzern, der es besser hätte wissen müssen. Der 2021 verstorbene niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen hat den Einfluss von Konzernen wie Exxon Mobile einmal als technisch-ökonomische Macht beschrieben, die nicht von Vernunft, sondern von Machthunger, Gier und Gewinninteressen geleitet wird. Als ob es noch eines Beweises bedurft hätte, hat der texanische Ölkonzern das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 23 Milliarden Dollar abgeschlossen ‒ das Jahr, an dem die globalen Treibhausgasemissionen einen neuen Rekordwert erreicht haben.
Auch die beste Technik wird uns nicht retten
Eine weitere Form des Verdrängens ist der alleinige Glaube an technische Lösungen. Schließlich sollte den Ingenieuren doch eine Antwort auf die drängenden Probleme wie den Klimawandel einfallen. Liefern Windturbinen und Solarzellen nicht emissionsfreie Elektrizität? Brauchen LED-Lampen nicht ungleich weniger Strom als die alten Glühbirnen? Lassen sich heutzutage nicht Häuser bauen, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen?
Tatsächlich sind alle drei Fragen mit „Ja“ zu beantworten. Doch dummerweise haben technische Neuerungen in der Regel einen unliebsamen Nebeneffekt, der sich Rebound oder „Rückschlag“ nennt. Denn was sich technisch durchsetzt, wird meist in großer Stückzahl produziert, dadurch billiger und häufiger gekauft. Mehr Effizienz führt praktisch immer zu stärkerer Nutzung. Das wiederum bedeutet, bei allen Einsparungen, Mehrkonsum und Mehrverbrauch von Rohstoffen aller Art.
Bestes Beispiel sind Autos, deren Motoren zwar immer effizienter werden, gleichzeitig aber größer, leistungsstärker und schwerer, mit dem Erfolg, dass Energieverbrauch und Emissionen im Verkehrssektor seit Jahren eher steigen als sinken. Oder Fernsehgeräte, die immer häufiger innovationsbedingt ausgetauscht werden und langsam das Format von Plakatwänden erreichen. Oder LED-Lampen, die deutlich weniger Strom fressen als ihre glühenden Vorgänger, aber gegen Jahresende als Lichterketten auf Balkonen und in Vorgärten erscheinen, die mit jedem Jahr ein paar Kilometer länger werden. Eine andere Form von Rebound sind die Schneekanonen gegen die wärmeren Winter oder die Klimaanlagen gegen die immer heißeren Sommertemperaturen. Letztere sind für immerhin zwölf Prozent der weltweiten Gesamtemissionen an CO2 verantwortlich.
So wichtig Effizienz und technische Neuerungen sind: Ohne Suffizienz, also Genügsamkeit, Verzicht oder Bescheidenheit ist Klimaschutz nicht möglich. Aber Suffizienz – siehe oben – also bestimmte Dinge gar nicht erst zu konsumieren, bedeutet für viele Menschen Spaßverzicht. Genau deshalb ist Klimaschutz so schwer. Weil der Spaß stärker ist als die Vernunft.
16.01.2022
Graue Welt von morgen
Weltweit altern die Gesellschaften. Segen oder Fluch?
Dass wir alle jeden Tag etwas älter werden, ist eine ziemliche Binsenwahrheit. Dass aber ganze Gesellschaften altern, ist keineswegs selbstverständlich. In vormodernen Zeiten, bis ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, konnten die Menschen im weltweiten Schnitt damit rechnen, gerade mal schätzungsweise 30 Jahre alt zu werden. Zudem wurden praktisch überall mehr Kinder geboren werden als ältere Menschen starben. Das hielt die Gesellschaften jung.
Heute liegt die durchschnittliche Lebenserwartung global betrachtet bei über 72 Jahren. Über die Hälfte aller Frauen der Welt bekommt weniger als 2,1 Kinder. Damit bläht sich der obere Teil der Bevölkerungspyramide (die langsam aufhört eine wirkliche „Pyramide“ zu sein) immer weiter auf, während das untere Ende langsam vor sich hin schrumpft. Das ist die Alterung der Weltgesellschaft. Und eine komplett neue Erfahrung für die Menschheit.
Bis in die Neuzeit waren die über 64-Jährigen eine unbedeutende Minderheit. 1950 machten sie immerhin schon 5 Prozent der Weltbevölkerung aus. Heute sind es gut 9 Prozent und bis 2050 dürfte sich ihr Anteil nahezu verdoppeln. Rund 1,6 Milliarden Menschen dürften dann 65 Jahre oder älter sein.
Immer besseres – und längeres Leben
In Deutschland, einem Vorreiter im demografischen Wandel, hat sich die mittlere Lebenserwartung seit dem Jahr 1900 von 45 Jahren auf gut 82 Jahre verlängert. Zu Vor-Corona-Zeiten gewannen die Menschen zwischen Rostock und dem Bodensee pro Jahrzehnt rund drei Jahre Lebenszeit hinzu. Man könnte auch sagen, dass sie mit jedem Morgen, an dem sie das Tageslicht erblickten, sechs Stunden Lebenszeit dazugewonnen haben. Kein Wunder, dass hierzulande die sogenannten Hochbetagten, die über 79-Jährigen, bis 2060 einen Bevölkerungsanteil von voraussichtlich 13 Prozent ausmachen werden. 1950 stellten sie gerade mal ein Prozent.
Die Lebenserwartung ist vermutlich der beste Querschnittsindikator für das Wohlergehen der Menschen. Sie leben länger, weil sie weniger verschleißende Arbeitsbedingungen erdulden müssen, weil sie bessere Ernährung, medizinische Versorgung, Hygiene und Wohnsituation genießen, und weil sie besser gebildet sind. Dadurch sind sie produktiver, erleben mehr Wohlstand, was wiederum die Lebenserwartung weiter steigen, die Kinderzahlen sinken und das Bevölkerungswachstum ausklingen lässt. Mit anderen Worten: Der demografische Wandel findet statt, weil es uns so gut geht. Er ist das Beste, was der Menschheit passieren kann.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Wandel in der Bevölkerungsstruktur ist ein zweischneidiges Schwert, wie eine neue Studie des McKinsey Health Institute deutlich macht. Denn mit Alterung und Nachwuchsschwund schrumpft der Anteil der Menschen im typischen Erwerbsalter. In allen früh entwickelten Staaten und bald auch in den Schwellenländern wird die Zahl der arbeitenden Menschen, also jener, die ordentlich Steuern zahlen und im Wesentlichen die Sozialkassen finanzieren, zurückgehen, während die Ruheständler, also die Leistungsempfänger, immer mehr werden. In den wenigsten Ländern der Welt sind die Renten- und Gesundheitssysteme auf diese Unwucht eingestellt, in Deutschland schon lange nicht.
Hinzu kommt, dass die gewonnenen Lebensjahre keineswegs bedeuten, dass wir entsprechend länger fit und munter bleiben. Weltweit genießen die Menschen gegenüber 1960 rund 20 zusätzliche Jahre. Aber die Hälfte davon verbringen sie in mehr oder weniger schlechter Verfassung, sind auf medizinische Betreuung und/oder Pflege angewiesen. Das gilt vor allem für degenerative Erkrankungen des Nervensystems wie Alzheimer oder andere Formen der Demenz, die mit dem Alter zunehmen und an denen weltweit bis 2050 mindestens 150 Millionen Menschen leiden dürften. Bereits im Jahr 2020 haben demenzielle Erkrankungen rund um den Globus Kosten in Höhe von geschätzten 1,3 Billionen US-Dollar verursacht.
Billig wird die Alterung nicht
Allein daran wird deutlich, dass die Alterung mit hohen gesellschaftlichen Kosten verbunden ist. In der öffentlichen Diskussion um diese Kosten ist in Deutschland meist von der Finanzierung des Rentensystems die Rede. Dass diesem – ohne massive Reformen – das Geld ausgeht, dürfte angesichts einer steigenden Zahl von Rentenempfängern bei gleichzeitig weniger Beitragszahlern klar sein. Eine mögliche Reform, nämlich das Renteneintrittsalter über die bisher anvisierte Grenze von 67 Jahren hinaus weiter zu erhöhen, würde das System zwar noch nicht sanieren, aber immerhin entlasten.
Die eigentliche Kostenlawine droht im Gesundheitssystem. Denn vergleichbare Reformen sind hier nicht möglich, weil das Eintreten einer altersbedingten Krankheit sich nicht einfach durch einen Gesetzesakt nach oben verschieben lässt. Auch steigen die Krankheitskosten pro Kopf, für eine medizinische Heilbehandlung wie auch für Rehabilitations- und Pflegemaßnahmen, mit fortschreitendem Alter überproportional an. Zudem treiben immer neue und meist teurere Diagnose- und Behandlungsmethoden die Kosten der Gesundheitsdienste weiter in die Höhe.
Fitter alt werden schont die Sozialkassen
Um die kaum zu finanzierenden Sozialsysteme zu entlasten, empfiehlt die McKinsey-Studie eine klare Strategie: Wenn die Menschen schon älter werden, sollen sie dabei wenigstens so lange wie möglich gesund und produktiv bleiben. „Healthy ageing“ heißt das gerne benutzte Zauberwort, und das bedeutet, nicht nur Jahre an das Leben dranzuhängen, sondern diese Jahre auch mit Leben zu füllen. Und das geht am besten mit Prävention, also mit Vorsorge, um Schlimmeres zu verhindern. Sie hat den Vorteil, dass sie so gut wie nichts kostet.
Es ist aus zahllosen Studien bestens bekannt, was die Menschen länger gesund leben lässt: Bildung, soziale Kontakte, gesunde, ausgewogene Ernährung, nicht rauchen, keine Drogen, Bewegung und gute Gesundheitssysteme, die ihrerseits alles tun, um die Prävention zu fördern. Den größten Effekt hat Vorsorge, wenn sie früh im Leben beginnt, idealerweise im Kindesalter. Bildung ist zentral unter den gesundheitsfördernden Faktoren, denn Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss haben besseren Zugang zu dem Wissen darüber, welche Verhaltensweisen der Gesundheit zuträglich sind. Sie sind auch eher motiviert, dieses Wissen vorbeugend umzusetzen und können Risikofaktoren in der Regel besser
beherrschen als gering Gebildete. Prävention nach diesen Vorgaben könnte Studien zufolge die Zahl der durch Einschränkungen oder Behinderungen geprägten Lebensjahre im Alter fast um ein Drittel reduzieren.
Das wäre schön für die Betroffenen und vermiede Kosten – nicht nur für die Gesundheits-, sondern auch für die Rentensysteme. Denn nur gesunde und körperlich fitte Menschen sind in der Lage, ein höheres Renteneintrittsalter auch in Beschäftigung umzusetzen. Und je länger die Menschen beruflich aktiv sind, desto mehr profitieren die Staatsfinanzen und der Wohlstand der Gesamtbevölkerung. In Großbritannien beispielsweise ließ sich ermitteln, dass eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit um ein Jahr das Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent steigern würde.
Auch nach dem offiziellen Rentenalter können und sollten die meisten Menschen, so sie denn körperlich und geistig dazu in der Lage sind, wichtige Leistungen für die Gesellschaft erbringen: als Ehrenamtliche, als Unterstützer für ihre Kinder und Enkel oder als Berater auf Basis ihrer vorherigen Berufserfahrung. Diese Leistungen sind sie den jüngeren Generationen schuldig. Denn niemand kann erwarten, dass eine kleiner werdende Schar von Erwerbstätigen ohne Gegenleistung eine immer größer werdende Gruppe von Ruheständlern 20, 30 oder noch mehr Jahre finanziell versorgt.
Das allerdings müsste auch die Politik begreifen, die bislang in der Frage der Generationengerechtigkeit ihr Fähnchen stets in den demoskopischen Wind gehängt hat: Denn an der Wahlurne haben die Älteren die Mehrheit. Und die wird aufgrund des demografischen Wandels über Jahre immer größer.
12.12.2022
Boomer umziehen!
Die Jungen suchen Wohnraum, die Älteren besetzen ihn
Dass die Babyboomer, die kopfstärkste Kohorte im Altersaufbau von Deutschlands Bevölkerung, einen guten Teil des Wohlstandes in Deutschland erwirtschaftet haben, dass sie jetzt dabei sind, sich in den Ruhestand zu verabschieden und große Lücken im Arbeitsmarkt reißen und dass sie Renten- und Gesundheitssysteme unter großen Stress setzen werden, all das dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Neu in der Diskussion ist, dass sie auch noch den Wohnungsmarkt blockieren.
Denn die Babyboomer leben in Häusern und Wohnungen, die in aller Regel zu groß für sie geworden sind. Kinder, wenn vorhanden, sind längst ausgezogen. Aber wie die meisten Menschen wünschen sich auch die Boomer möglichst lange in dem angestammten Zuhause zu verbleiben, selbstbestimmt und eigenständig in vertrauter Umgebung zu altern. 96 Prozent der über 64-Jährigen in Deutschland sind zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Sie fühlen sich wohl in ihren zu großen Wohnungen, auch wenn sie eigentlich mit weniger Platz zurechtkämen, was zudem deutlich umweltfreundlicher wäre.
Die Babyboomer, genau gesagt die Geburtsjahrgänge 1955 bis 1970, stellen derzeit rund 30 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Sie sind die reichste und am besten qualifizierte Altersgruppe, die das Land je gesehen hat. Sie leben auch länger als alle Vorgängergenerationen. Vor allem aber haben sie vom Häuslebauboom der Republik profitiert: Nach dem letzten Deutschen Alterssurvey wohnen sie zu rund 60 Prozent im Eigentum.
Mehr Generationengerechtigkeit wagen
Das ist schön und gut, aber leider etwas unfair der jüngeren Generation gegenüber, die eigentlich in dem Alter ist, in dem man eine Familie gründen kann und will. Dafür braucht sie bezahlbaren, ausreichend großen Wohnraum. Und der ist knapp. Er wird nach heutigem Stand der Dinge erst wieder frei, wenn die Boomer in ein Pflegeheim umziehen müssen oder ganz auf ihre letzte Reise gehen, also in etwa 20, 30 Jahren. Das alles steht in der jüngst erschienenen Studie „Ageing in Place“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der Körber-Stiftung.
Wie aber löst man das Dilemma auf? Die Forscher machen dazu Vorschläge: Kommunen sollten vor dem Hintergrund des Wohnungsmangels und der zunehmenden Zersiedlung der Stadtumlandgebiete Anreize für eine Umverteilung des Wohnraums schaffen, nach dem Motto „Ältere raus – Junge rein“, und zwar zum Nutzen beider: Die jungen Familien bekommen mehr Platz. Und die Alten können auf eine Wohnung hoffen, die ihren Bedürfnissen besser entspricht. Das wäre nicht nur alters-, sondern auch generationengerecht.
Denn auch die heute noch fitten Babyboomer müssen damit rechnen, dass sie irgendwann auf Unterstützung oder Pflege angewiesen sind, dass im höheren Alter ihre Sehfähigkeit abnimmt, dass Arthrose oder chronische Erkrankungen ihre Bewegungsfreiheit einschränken. Dann brauchen sie ein barrierearmes oder -freies Umfeld, was die allermeisten ihrer heutigen Wohnungen und Häuser gar nicht bieten. Und oft auch die Umgebung nicht, in der sie leben.
Sie könnten dann beispielsweise aus den Vororten, die oft als reine Schlafsiedlungen geplant waren, näher an die Innenstadt ziehen, wo sich Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote besser, oft sogar fußläufig erreichen lassen. Funktionierende Ortszentren bieten älteren Menschen ein deutlich besseres Lebensumfeld als die suburbanen Einfamilienhausgebiete.
Wohnungstausch attraktiver machen
Noch stehen diesem konzertierten Umzug ein paar Hindernisse im Weg. Städte und Gemeinden können attraktive Wohnungen für Ältere nur anbieten, wenn diese im kommunalen Besitz sind. Der Immobilienmarkt ist im Wesentlichen privatwirtschaftlich organisiert. Dennoch können Kommunen handeln: Sie können barrierefreie Um- und Neubauten vorantreiben, indem sie beraten und helfen. Zum Beispiel, indem sie Pflegestützpunkte vor Ort einbinden, bestehende Wohnberatungsstellen unterstützen oder sogar ein eigenes städtisches Büro einrichten. Zudem können sie Bauland oder Sanierungsgebiete ankaufen und bevorzugt an Investoren oder Baugruppen mit alters- und generationengerechten Konzepten weiterreichen.
Zudem müsste es für die Boomer attraktiver werden ihre bestehenden Wohnungen aufzugeben oder an jüngere zu vermieten. Wenn sie zur Miete wohnen, ziehen sie schon deshalb ungerne aus, weil die Bestandsmieten meist günstiger sind als das, was eine andere, kleinere und barrierefreie Wohnung kosten würde. Jüngere zahlen im Schnitt mehr pro Quadratmeter als Ältere. Babyboomer, die ihr zu groß gewordenes Eigenheim oder die Eigentumswohnung vermieten und in eine kleinere Wohnung umziehen wollen, zahlen auf die Mieteinnahmen Steuern, können die Kosten für die neue Behausung aber nicht absetzen. Hier müsste sich der Gesetzgeber neue Lösungen einfallen lassen.
Vor allem sollten die Kommune ihre Bürgerinnen und Bürger im Babyboomeralter informieren und beraten. Über die Herausforderungen des Älterwerdens, aber auch über die Angebote in Sachen Wohnen, Freizeit und Mobilität, über Gesundheit, Pflege und Organisationen, die Unterstützung anbieten. Die Stadt Zürich beispielsweise macht so etwas schon länger. Sie gibt über die Website „Zürich im Alter“ eine Übersicht über das städtische, private und gemeinnützige Wohnangebot in Zürich. Interessierte können sich für alle städtischen Wohnmöglichkeiten, von der altengerechten Wohnung bis zum Pflegeplatz, zentral anmelden. Fachpersonal von „Zürich im Alter“ zeigt Möglichkeiten, wie sich auch im Alter eine selbstbestimmte Alltagsbewältigung in der gewohnten Umgebung bestmöglich gewährleisten lässt.
05.12.2022
Wie schief ist das denn?
Das Land der Fußball-WM hat die größte Bevölkerungsunwucht der Welt
Bekanntlich findet derzeit in Katar, dem in einer lebensfeindlichen Wüste gelegenen Emirat am Persischen Golf, das Gipfeltreffen der weltbesten Fußballmannschaften statt. Dass die deutschen Kicker sich früh aus dem Geschehen zurückgezogen haben, mag wenig überraschen. Ebenso wenig, dass auch die Katarer ihr Spielgeschehen schon nach fünf Stunden eingestellt haben.
Erstaunlich ist eher, dass die Gastgeber überhaupt eine Mannschaft zusammenbekommen haben. Denn es gibt gerade einmal etwa 23.000 männliche Katarer zwischen 20 und 34 Jahren, also in dem Alter, in dem man sich üblicherweise das Trikot einer Nationalmannschaft überstreift.
Katar ist das mit Abstand bevölkerungsärmste Land, das je eine Fußball-WM ausgerichtet hat. Noch 1950 lebten dort gerade mal 50.000 Menschen, als nomadisierende Beduinen oder Seefahrer, perfekt angepasst an die harschen Lebensbedingungen einer trockenen und heißen Region. Heute sind es rund 300.000, jedenfalls, wenn man jene zählt, die das Privileg haben, einen katarischen Pass zu besitzen und von großzügigen staatlichen Leistungen zu profitieren. Tatsächlich aber leben in dem Emirat fast drei Millionen Menschen. 88 Prozent der Bevölkerung sind Fremdarbeiter aus anderen Ländern. Sie besitzen deutlich weniger Rechte als die Minderheit der angestammten Katarer.
Wegen der Zuwanderung wächst die Bevölkerung des Emirates so schnell wie sonst nur in ganz armen Ländern. Ein kleiner Teil der Zugewanderten, häufig solche aus westlichen Ländern und aus Ostasien, arbeitet im Hochlohnsektor, als Ingenieure, Ärzte oder Manager. Die Mehrheit, rund 800.000 der angeworbenen Ausländer, die vor allem aus Indien, Bangladesch, den Philippinen, Ägypten und Sri Lanka stammen, schuftet auf den zahllosen Baustellen. Weitere sind als Putzkräfte und Wachmänner angestellt.
Nirgendwo auf der Welt ist der Männerüberschuss größer
Katar ist dank seiner Erdölvorkommen und des größten Erdgasfeldes der Welt unvorstellbar reich. Es kann sich nicht nur acht aus dem Boden gestampfte Fußballstadien leisten, die nach der Weltmeisterschaft leer stehen oder abgerissen werden, sondern auch den im Meer aufgeschütteten Hamad International Airport mit überlangen Landepisten, die Doha Metro oder die künstliche Insel „The Pearl“ mit Luxushotels, Shopping Malls und Villen.
Die Arbeitskräfte, die all dies hochgezogen haben und die auch noch Lusail City bauen sollen, eine im Bau befindliche Retortenstadt auf 21 Quadratkilometern Fläche für 450.000 Bewohner, sind überwiegend männlich und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Eben solche Männer, die man überall auf Baustellen findet. Sie arbeiten aber nicht nur, sondern sorgen auch dafür, dass Katar die größte Bevölkerungsunwucht der Welt hat: In dem Emirat kommen auf eine Frau 3,4 Männer. Das Geschlechterungleichgewicht sorgt für eine gewaltige Beule in der Bevölkerungspyramide.
Von Pyramide keine Spur
In den meisten Ländern herrscht in der Bevölkerung ein einigermaßen ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Nicht so in Katar. Weil fast 90 Prozent der Bewohner Ausländer sind, die zum Arbeiten angeworben wurden, und weil die meisten Jobs im Bausektor angeboten werden, herrscht ein gewaltiger Überschuss an Männern. Wenn sie keine Arbeit mehr haben, müssen sie das Land verlassen. Deshalb sind in Katar fast 83 Prozent der Gesamtbevölkerung im Erwerbsalter – das ist Weltrekord.
Was bedeutet das für Katar – über die Frage der Menschenrechte hinaus? Mit dieser Unwucht lässt sich kaum ein funktionierender Staat machen. Sie steht eher für ein Apartheid-ähnliches System, für eine Gesellschaft, in der ein Großteil der Bevölkerung als Dienstleister malocht und der Rest in Saus und Braus lebt. Tatsächlich streicht das wohlhabendste Prozent der Bevölkerung 23,6 Prozent des nationalen Einkommens ein. Für die ärmere Hälfte bleiben gerade mal 2,1 Prozent des Wohlstands.
Katar lebt erst seit wenigen Jahrzehnten in der Phase des rohstoffgetriebenen Booms. Die Frage ist, wie das Land weiterexistieren kann, wenn die Welt sich löst von ihrer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Glaubt man den angekündigten Klimaschutzbemühungen im Pariser Abkommen, müsste das schon sehr bald der Fall sein.
Das Emirat will sein Geld bis dahin mit Handel, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, medizinischen Luxusbehandlungen und Forschung verdienen. Dann bräuchte das Land allerdings auch einen anderen Bevölkerungsaufbau und vor allem andere Qualifikationen der Mehrheit seiner Bewohner.
24.11.2022
Putins demografisches Harakiri
Russland verliert Hunderttausende junger Männer – und damit seine Zukunft
Das flächenmäßig größte Land der Erde ist ziemlich dünn besiedelt. Gerade einmal 8,5 Menschen leben im Schnitt auf einem Quadratkilometer in dem Riesengebiet zwischen St. Petersburg und Wladiwostok. In Deutschland teilen sich 240 Menschen die gleiche Fläche. Im Reich der Zaren und Möchtegern-Zaren dürfte es künftig noch einsamer werden. Aufgrund niedriger Geburtenziffern und einer hohen Sterblichkeit vor allem unter Männern begann die Bevölkerung schon von 1994 an zu schrumpfen. Sie wuchs dann zwar wieder leicht von 2009 bis 2019, folgt seither aber wieder einem Abwärtstrend.
Bevölkerungsprojektionen gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung beschleunigt fortsetzt und Russland bis 2050 rund acht Millionen Einwohner verlieren dürfte. Nur China und Japan haben weltweit mit noch größeren zahlenmäßigen Verlusten zu rechnen. In den kommenden Jahren werden in Russland die Sterbefälle aufgrund der gealterten Bevölkerung deutlich zunehmen und die Geburten abnehmen. Allerdings sind diese Projektionen viel zu optimistisch, denn sie stammen aus der Zeit vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Seither hat sich die demografische Lage der Atommacht noch einmal stark verschlechtert.
Gleich nach Beginn des Überfalls auf das Nachbarland haben sich geschätzte 300.000 Personen ins Ausland abgesetzt, vor allem junge, gut qualifizierte Menschen, die in ihrer Heimat keine Chance mehr sahen ihre Fähigkeiten sinnstiftend einzubringen. Weitere 200.000 folgten bis Mitte August. Rund 400.000 Männer haben sich zusätzlich aus Russland verabschiedet, als ihnen über die Mobilmachung die Einberufung in den Militärdienst und der Einsatz an der Front drohte. Nach Schätzungen amerikanischer Militärkreise sind zudem über 100.000 Männer im Krieg gefallen oder wurden schwer verletzt. Das macht in der Summe einen Verlust von rund einer Million Menschen binnen neun Monaten für ein Land, das während der Corona-Pandemie bereits etwa 400.000 zusätzliche Tote zu beklagen hatte.
Keine Stabilität in Sicht
Es ist nicht zu erwarten, dass Russland der demografischen Abwärtsspirale entkommen kann. Denn künftige Geburten können die demografischen Lücken nicht wieder füllen. Dafür fehlen schlicht und einfach die potenziellen Eltern. Die Zahl der Frauen in dem Alter, in dem sie Kinder bekommen können, ist im vergangenen Jahrzehnt um ein Drittel zurückgegangen. Das ist eine Spätfolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der damit verbundenen Wirtschaftskrise. Damals waren die Geburtenziffern auf ein historisches Tief abgesackt. Zum Höhepunkt der Krise im Jahr 1999 lag die Fertilitätsrate nur noch bei 1,2 Kindern je Frau. 2,1 Kinder wären nötig, um mittelfristig eine Bevölkerung zu stabilisieren.
Landesweit fehlt es überdies an Männern, um Familien zu gründen. Das ist kein neues Phänomen für Russland, denn schon der Zweite Weltkrieg hatte die Zahl der Männer dezimiert. Über die Epoche der Sowjetunion und danach starben überproportional viele Männer vor ihrer Zeit – durch Unfälle, Gewalteinwirkungen und vor allem durch Alkoholmissbrauch. In kaum einem anderen Land der Welt liegt die Lebenserwartung der Geschlechter weiter auseinander als in Russland. Männer sterben im Schnitt 10 Jahre früher als Frauen. Mit nur 66 Jahren liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von russischen Männern fünf Jahre unter der von Bangladeschern.
Selbst die Soldaten, die aus dem Kampfzonen zurück nach Russland kommen, sind nicht die idealen Familiengründer. Viele sind verletzt, haben mit Traumata zu kämpfen und greifen zu Wodka, dem traditionellen nationalen Beruhigungsmittel. Und wie schon nach den russischen Feldzügen gegen Afghanistan und gegen Tadschikistan dokumentiert, tragen sie häufig ihre kriegsbedingten Gewalterfahrungen in den Alltag und werden kriminell.
Menschenklau gegen eigene Bevölkerungsverluste
Ein Grund Putins für den Überfall auf das Nachbarland, der schon 2014 mit der Annexion der Krim begonnen hatte, dürfte gewesen sein, dass er Russlands schrumpfende Bevölkerungszahl mit den knapp 44 Millionen Bewohnern der Ukraine auffrischen wollte. Nach seiner Vorstellung sind Russen und Ukrainer ohnehin „ein Volk“ und er der eine auserwählte Führer. Bereits die Einverleibung der Krim brachte der russischen Einwohnerstatistik ein Plus von 2,5 Millionen. Bekanntlich läuft die weitere Übernehme des ukrainischen „Brudervolkes“ nicht gerade nach Plan. Aber immerhin hat Russland aus den vorübergehend besetzten Gebieten Abertausende Menschen deportiert und mit russischen Pässen versehen, es hat Kinder verschleppt und zur Adoption freigegeben.
Es ist bekannt, dass Putin über den schleichenden demografischen Abstieg seines Landes zutiefst frustriert ist. Lag die 1991 untergegangene Sowjetunion mit ihren 287 Millionen Einwohnern nach China und Indien noch auf Platz drei der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, vor allem aber vor dem großen Konkurrenten USA, so ist das heutige Russland mit seinen 145 Millionen Menschen auf Platz neun abgerutscht – hinter Länder wie Pakistan, Nigeria oder Bangladesch. Bis 2050 dürfte Russland auf Platz 14 oder 15 durchgereicht sein, selbst das ostafrikanische Tansania könnte dann mehr Einwohner zählen. Schon heute fehlen dem Land Arbeitskräfte, aber auch Menschen, die das Riesenreich mit seinen 22.400 Kilometern Landesgrenzen militärisch absichern könnten.
Das sind schlechte Aussichten für einen Mann mit imperialen Großmachtsfantasien. Putins Antwort auf die russische Bevölkerungskrise war denn auch eine pronatalistische Politik. So ließ er einst den „Tag der Empfängnis“ ausrufen. Er war arbeitsfrei und mit der Aufforderung verbunden, den Nachmittag zum Kopulieren zu nutzen. Auch gab es Sommerfrischeangebote für junge Erwachsene, bei denen sie in Zelten übernachten konnten – allerdings ohne Kondome. Der Mutterschaftsurlaub wurde verlängert und es gab Babyprämien für Mütter, die mehr als ein Kind bekamen. Bis zu umgerechnet 12.000 US-Dollar konnten die Familien einstreichen, was speziell in den entlegenen Landesteilen eine nennenswerte Summe war. Noch 2012 proklamierte Putin, „der Staat, die Gesellschaft, die Kirchen, das Bildungssystem und die Kultur“ sollten sich zusammentun, um „starke, glückliche Familien mit vielen Kindern“ zu erzeugen.
Tatsächlich stieg die Geburtenziffer wieder an, allerdings nur vorübergehend. Für Experten wie den Moskauer Demografen Sergei Zakharow beruhte der vorübergehende kleine Babyboom auf einem klaren Mitnahmeeffekt: Viele Familien zogen das Kinderkriegen lediglich vor, um an die Prämie zu kommen. Auf lange Sicht aber bekamen sie nicht mehr Nachwuchs. Wieder einmal war Russland mit seinen planwirtschaftlichen Vorgaben gescheitert.
Noch schlimmer getroffen: die Ukraine
Während Russland wenigstens versucht mit viel Aufwand und wenig Erfolg seine Bevölkerung aufzufrischen, sind solche Bestrebungen im Nachbarland Ukraine weitgehend ausgeblieben. Politische und wirtschaftliche Verwerfungen und ein mittlerweile achtjähriger Krieg um die Gebiete Luhansk und Donezk haben die demografischen Probleme an den Rand gedrängt. Dabei ist die Lage noch schwieriger als in Russland.
Die Geburtenziffer liegt seit dem Jahr 1963 fast durchgängig unter dem bestanderhaltenden Wert von 2,1 Kinder je Frau, derzeit nur noch bei 1,2 Kindern, einem der niedrigsten Werte weltweit. Um die Lebenserwartung der Männer steht es nicht viel besser als in Russland. Auf eine Geburt kommen in der Ukraine derzeit mehr als zwei Sterbefälle. Die Abwanderung ist seit vielen Jahren aufgrund der prekären Wirtschaftslage hoch. Millionen von in der Ukraine geborenen Menschen leben in Russland, Kanada, Polen und den USA. Von den 52 Millionen Einwohnern zum Ende der Sowjetunion sind heute nach offiziellen Angaben noch 41 Millionen übrig, auch weil die Bewohner der Krim nicht mitgezählt sind. Wie viele es in Wirklichkeit sind, lässt sich schwer ermitteln, weil unklar ist, wie viele der rund 15 Millionen vor dem Krieg Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Knapp 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind europaweit als Geflüchtete registriert. Damit hätte das Land, das flächenmäßig immerhin 1,7-mal so groß ist wie Deutschland, nur noch 33 Millionen Einwohner. Kein Land der Welt hat in der jüngeren Vergangenheit relativ gesehen mehr Menschen verloren.
Einzig ein Nachkriegs-Babyboom in der Ukraine könnte die demografische Krise wieder etwas abfedern. So etwas gab es nach Konflikten immer wieder, wenn die Menschen nach der Phase des Leids endlich wieder hoffnungsvoll nach vorne blicken können. Wenn sie ihre Zukunft mit einer Familiengründung aufhellen wollen und aufgeschobene Kinderwünsche in die Tat umsetzen. Anwachsen wird die Bevölkerung dadurch aber dennoch nicht.
Das flächenmäßig größte Land der Erde ist ziemlich dünn besiedelt. Gerade einmal 8,5 Menschen leben im Schnitt auf einem Quadratkilometer in dem Riesengebiet zwischen St. Petersburg und Wladiwostok. In Deutschland teilen sich 240 Menschen die gleiche Fläche. Im Reich der Zaren und Möchtegern-Zaren dürfte es künftig noch einsamer werden. Aufgrund niedriger Geburtenziffern und einer hohen Sterblichkeit vor allem unter Männern begann die Bevölkerung schon von 1994 an zu schrumpfen. Sie wuchs dann zwar wieder leicht von 2009 bis 2019, folgt seither aber wieder einem Abwärtstrend.
Bevölkerungsprojektionen gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung beschleunigt fortsetzt und Russland bis 2050 rund acht Millionen Einwohner verlieren dürfte. Nur China und Japan haben weltweit mit noch größeren zahlenmäßigen Verlusten zu rechnen. In den kommenden Jahren werden in Russland die Sterbefälle aufgrund der gealterten Bevölkerung deutlich zunehmen und die Geburten abnehmen. Allerdings sind diese Projektionen viel zu optimistisch, denn sie stammen aus der Zeit vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Seither hat sich die demografische Lage der Atommacht noch einmal stark verschlechtert.
Gleich nach Beginn des Überfalls auf das Nachbarland haben sich geschätzte 300.000 Personen ins Ausland abgesetzt, vor allem junge, gut qualifizierte Menschen, die in ihrer Heimat keine Chance mehr sahen ihre Fähigkeiten sinnstiftend einzubringen. Weitere 200.000 folgten bis Mitte August. Rund 400.000 Männer haben sich zusätzlich aus Russland verabschiedet, als ihnen über die Mobilmachung die Einberufung in den Militärdienst und der Einsatz an der Front drohte. Nach Schätzungen amerikanischer Militärkreise sind zudem über 100.000 Männer im Krieg gefallen oder wurden schwer verletzt. Das macht in der Summe einen Verlust von rund einer Million Menschen binnen neun Monaten für ein Land, das während der Corona-Pandemie bereits etwa 400.000 zusätzliche Tote zu beklagen hatte.
Keine Stabilität in Sicht
Es ist nicht zu erwarten, dass Russland der demografischen Abwärtsspirale entkommen kann. Denn künftige Geburten können die demografischen Lücken nicht wieder füllen. Dafür fehlen schlicht und einfach die potenziellen Eltern. Die Zahl der Frauen in dem Alter, in dem sie Kinder bekommen können, ist im vergangenen Jahrzehnt um ein Drittel zurückgegangen. Das ist eine Spätfolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der damit verbundenen Wirtschaftskrise. Damals waren die Geburtenziffern auf ein historisches Tief abgesackt. Zum Höhepunkt der Krise im Jahr 1999 lag die Fertilitätsrate nur noch bei 1,2 Kindern je Frau. 2,1 Kinder wären nötig, um mittelfristig eine Bevölkerung zu stabilisieren.
Landesweit fehlt es überdies an Männern, um Familien zu gründen. Das ist kein neues Phänomen für Russland, denn schon der Zweite Weltkrieg hatte die Zahl der Männer dezimiert. Über die Epoche der Sowjetunion und danach starben überproportional viele Männer vor ihrer Zeit – durch Unfälle, Gewalteinwirkungen und vor allem durch Alkoholmissbrauch. In kaum einem anderen Land der Welt liegt die Lebenserwartung der Geschlechter weiter auseinander als in Russland. Männer sterben im Schnitt 10 Jahre früher als Frauen. Mit nur 66 Jahren liegt die durchschnittliche Lebenserwartung von russischen Männern fünf Jahre unter der von Bangladeschern.
Selbst die Soldaten, die aus dem Kampfzonen zurück nach Russland kommen, sind nicht die idealen Familiengründer. Viele sind verletzt, haben mit Traumata zu kämpfen und greifen zu Wodka, dem traditionellen nationalen Beruhigungsmittel. Und wie schon nach den russischen Feldzügen gegen Afghanistan und gegen Tadschikistan dokumentiert, tragen sie häufig ihre kriegsbedingten Gewalterfahrungen in den Alltag und werden kriminell.
Menschenklau gegen eigene Bevölkerungsverluste
Ein Grund Putins für den Überfall auf das Nachbarland, der schon 2014 mit der Annexion der Krim begonnen hatte, dürfte gewesen sein, dass er Russlands schrumpfende Bevölkerungszahl mit den knapp 44 Millionen Bewohnern der Ukraine auffrischen wollte. Nach seiner Vorstellung sind Russen und Ukrainer ohnehin „ein Volk“ und er der eine auserwählte Führer. Bereits die Einverleibung der Krim brachte der russischen Einwohnerstatistik ein Plus von 2,5 Millionen. Bekanntlich läuft die weitere Übernehme des ukrainischen „Brudervolkes“ nicht gerade nach Plan. Aber immerhin hat Russland aus den vorübergehend besetzten Gebieten Abertausende Menschen deportiert und mit russischen Pässen versehen, es hat Kinder verschleppt und zur Adoption freigegeben.
Es ist bekannt, dass Putin über den schleichenden demografischen Abstieg seines Landes zutiefst frustriert ist. Lag die 1991 untergegangene Sowjetunion mit ihren 287 Millionen Einwohnern nach China und Indien noch auf Platz drei der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, vor allem aber vor dem großen Konkurrenten USA, so ist das heutige Russland mit seinen 145 Millionen Menschen auf Platz neun abgerutscht – hinter Länder wie Pakistan, Nigeria oder Bangladesch. Bis 2050 dürfte Russland auf Platz 14 oder 15 durchgereicht sein, selbst das ostafrikanische Tansania könnte dann mehr Einwohner zählen. Schon heute fehlen dem Land Arbeitskräfte, aber auch Menschen, die das Riesenreich mit seinen 22.400 Kilometern Landesgrenzen militärisch absichern könnten.
Das sind schlechte Aussichten für einen Mann mit imperialen Großmachtsfantasien. Putins Antwort auf die russische Bevölkerungskrise war denn auch eine pronatalistische Politik. So ließ er einst den „Tag der Empfängnis“ ausrufen. Er war arbeitsfrei und mit der Aufforderung verbunden, den Nachmittag zum Kopulieren zu nutzen. Auch gab es Sommerfrischeangebote für junge Erwachsene, bei denen sie in Zelten übernachten konnten – allerdings ohne Kondome. Der Mutterschaftsurlaub wurde verlängert und es gab Babyprämien für Mütter, die mehr als ein Kind bekamen. Bis zu umgerechnet 12.000 US-Dollar konnten die Familien einstreichen, was speziell in den entlegenen Landesteilen eine nennenswerte Summe war. Noch 2012 proklamierte Putin, „der Staat, die Gesellschaft, die Kirchen, das Bildungssystem und die Kultur“ sollten sich zusammentun, um „starke, glückliche Familien mit vielen Kindern“ zu erzeugen.
Tatsächlich stieg die Geburtenziffer wieder an, allerdings nur vorübergehend. Für Experten wie den Moskauer Demografen Sergei Zakharow beruhte der vorübergehende kleine Babyboom auf einem klaren Mitnahmeeffekt: Viele Familien zogen das Kinderkriegen lediglich vor, um an die Prämie zu kommen. Auf lange Sicht aber bekamen sie nicht mehr Nachwuchs. Wieder einmal war Russland mit seinen planwirtschaftlichen Vorgaben gescheitert.
Noch schlimmer getroffen: die Ukraine
Während Russland wenigstens versucht mit viel Aufwand und wenig Erfolg seine Bevölkerung aufzufrischen, sind solche Bestrebungen im Nachbarland Ukraine weitgehend ausgeblieben. Politische und wirtschaftliche Verwerfungen und ein mittlerweile achtjähriger Krieg um die Gebiete Luhansk und Donezk haben die demografischen Probleme an den Rand gedrängt. Dabei ist die Lage noch schwieriger als in Russland.
Die Geburtenziffer liegt seit dem Jahr 1963 fast durchgängig unter dem bestanderhaltenden Wert von 2,1 Kinder je Frau, derzeit nur noch bei 1,2 Kindern, einem der niedrigsten Werte weltweit. Um die Lebenserwartung der Männer steht es nicht viel besser als in Russland. Auf eine Geburt kommen in der Ukraine derzeit mehr als zwei Sterbefälle. Die Abwanderung ist seit vielen Jahren aufgrund der prekären Wirtschaftslage hoch. Millionen von in der Ukraine geborenen Menschen leben in Russland, Kanada, Polen und den USA. Von den 52 Millionen Einwohnern zum Ende der Sowjetunion sind heute nach offiziellen Angaben noch 41 Millionen übrig, auch weil die Bewohner der Krim nicht mitgezählt sind. Wie viele es in Wirklichkeit sind, lässt sich schwer ermitteln, weil unklar ist, wie viele der rund 15 Millionen vor dem Krieg Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Knapp 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind europaweit als Geflüchtete registriert. Damit hätte das Land, das flächenmäßig immerhin 1,7-mal so groß ist wie Deutschland, nur noch 33 Millionen Einwohner. Kein Land der Welt hat in der jüngeren Vergangenheit relativ gesehen mehr Menschen verloren.
Einzig ein Nachkriegs-Babyboom in der Ukraine könnte die demografische Krise wieder etwas abfedern. So etwas gab es nach Konflikten immer wieder, wenn die Menschen nach der Phase des Leids endlich wieder hoffnungsvoll nach vorne blicken können. Wenn sie ihre Zukunft mit einer Familiengründung aufhellen wollen und aufgeschobene Kinderwünsche in die Tat umsetzen. Anwachsen wird die Bevölkerung dadurch aber dennoch nicht.
22.09.2022
Fläche wird ein knappes Gut
Trotz hehrer Ziele schafft es Deutschland nicht, die Zubetonierung der Landschaft zu stoppen. Warum eigentlich?
Es klingt wie eines der ungelösten Rätsel der Menschheitsgeschichte: Warum beansprucht Deutschlands Bevölkerung immer mehr Fläche, obwohl die Einwohnerzahl des Landes seit rund 30 Jahren kaum mehr gewachsen ist? Tatsächlich brauchen die aktuell gut 83 Millionen Menschen stetig mehr Platz für Straßen und Parkplätze, für Bürogebäude und einen Gewerbebrei aus Einkaufszentren, Logistikhallen und Freizeitstätten, für Einfamilienhäuser mit ästhetisch begrenzter Halbwertszeit und für eintönige Schottervorgärten, in denen die Artenvielfalt gegen Null tendiert.
In den vergangenen Jahren fraß sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche zwischen Rügen und dem Bodensee um durchschnittlich 54 Hektar in die Landschaft – und zwar pro Tag. Das entspricht einer täglichen Fläche von 75 Fußballfeldern oder 200 Quadratkilometern im Jahr. Damit hat die Bevölkerung ihre Flächeninanspruchnahme in den letzten drei Jahrzehnten um 30 Prozent vergrößert. Der Platz für Wohnen, Arbeiten und Mobilität ging im Wesentlichen zu Lasten der Agrarflächen, denn der Wald steht in Deutschland unter besonderem Schutz. „Flächenverbrauch“ bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass Böden komplett unter Asphalt oder Beton verschwinden. Auch wenn ungenutzte Flächen in Parkanlagen, Sportstätten, Spielplätze oder Friedhöfe umgewandelt werden, gelten sie als „verbraucht“.
Während es zu früheren Zeit noch offizielles Staatsziel war, vor allem ländliche Gebiete zu „erschließen“ und dafür Straßen- und Eigenheimbau üppig zu fördern, ist mittlerweile klar, dass freie Flächen und natürliche Böden begrenzte, nicht nachwachsende Güter sind, die es entsprechend zu schützen gilt. Doch dabei herrscht ein massiver Interessenkonflikt zwischen Landwirtschaft, Umweltschutz, Häuslebauern und Wirtschaft: Einerseits dient der Ackerbau der Ernährungssicherung, liefert nachwachsende Rohstoffe und ist auf intakte, fruchtbare Böden angewiesen. Für den Arten-, Natur- und Klimaschutz sind möglichst viele ungestörte, unzerschnittene und verkehrsarme Naturräume notwendig. Andererseits weisen Kommunen immer neues Bauland aus, um Einwohner und Steuerzahler anzulocken. Und Unternehmen benötigen Straßen und Gewerbeflächen, unter anderem für Wind- und Solarkraftwerke, mit denen die Energiewende bewältigt und der Klimawandel eingedämmt werden sollen. Spätestens hier beißt sich die Katze in den Schwanz, denn der anhaltende Flächenverbrauch führt zu immer mehr versiegelten Flächen. Die speichern die Sommerhitze und behindern das Versickern von Niederschlägen, begünstigen also Hochwasser und machen immer verletzlicher gegen die Folgen der Erderwärmung.
Problem erkannt – Ziele gesetzt – aber nichts erreicht
Die Bundesregierung hat diesen Interessenkonflikt bereits im Jahr 2002 erkannt und damals, noch unter dem Kanzler Gerhard Schröder und dem grünen Umweltminister Jürgen Trittin, ihre erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Titel „Perspektiven für Deutschland“ verabschiedet. Darin stand geschrieben, dass sich der tägliche Flächenverbrauch von damals über 120 Hektar bis 2020 auf 30 Hektar reduzieren sollte, also auf ein Viertel des ursprünglichen Wertes.
Doch wie häufig bei politischen Absichtserklärungen war die Nachhaltigkeitsstrategie alles andere als eine wirkliche Strategie. Eine solche nämlich müsste deutlich machen, mit welchen Eingriffen und Maßnahmen die gesetzten Ziele unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel und Möglichkeiten zu erreichen sind. Sie müsste die Aufgaben klar verteilen, Regeln und Vorgaben für bestimmte Zeitabschnitte aufstellen und zwischenzeitlich evaluieren, ob die Ziele auch erreicht werden, um dann gegebenenfalls nachzujustieren.
Nichts davon hat die Nachhaltigkeitsstrategie geleistet. Sie war nicht viel mehr als eine nett gemeinte Aufforderung den Flächenfraß zu bremsen. Aus ihr ging keinerlei Verbindlichkeit hervor, es gab bei Nichterreichen der Ziele keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Es war nicht einmal klar, an wen sie sich richtete, an Kommunen, die Bundesländer oder an die Bundesregierung? Nachhaltigkeit blieb ein freiwilliges Konzept. Als Folge dieser Wünsch-dir-was-Politik lag der tägliche Flächenverbrauch im Zieljahr 2020 um 80 Prozent über dem zuvor als notwendig anerkannten Zielwert. Nicht viel besser sah es bei weiteren Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategie aus, etwa beim Primärenergieverbrauch, beim Schutz der Artenvielfalt oder der Schadstoffbelastung der Luft. All diese Ziele wurden eindeutig verfehlt.
Als Reaktion auf diesen Flop hat die Bundesregierung ihre Nachhaltigkeitsstrategie 2016 „überarbeitet“, im Klartext: verwässert. Nach dem Motto: Wenn wir es nicht schaffen, den Flächenverbrauch bis 2020 nicht auf 30 Hektar pro Tag zu senken, dann machen wir das eben bis 2030. Das Umweltbundesamt hat die Latte gleich noch höher gelegt und in seinem „integrierten Umweltprogramm“ angekündigt, den Flächenfraß zu diesem Zeitpunkt auf 20 Hektar pro Tag senken zu wollen. Das wäre auch notwendig, denn nach der Ressourcenstrategie der Europäischen Union und dem Klimaschutzplan der Bundesregierung müsste bis Mitte des Jahrhunderts der Übergang zu einer Flächenkreislaufwirtschaft erreicht sein. Es dürften unterm Strich also überhaupt keine neuen Flächen mehr beansprucht werden.
Wie das klappen soll, bleibt freilich im Dunkeln. Tatsächlich liegt der Flächenverbrauch noch bei 54 Hektar pro Tag, der Rückgang stockt und derzeit ist sogar wieder eine leicht steigende Tendenz zu beobachten. Besonders viele Böden gehen in Sachsen, Thüringen und Bayern verloren, obwohl sich die Landesregierung in letzterem Bundesland besonders ehrgeizige Ziele gesetzt hat. Der hohe Flächenverbrauch bedeutet zudem ein Mehr an Treibhausgasen, denn wo Häuser, Gewerbe- und Industrieanlagen entstehen, kommen massenweise Rohstoffe und Energie zum Einsatz, zudem müssen auch Straßen her, die wiederum zusätzlichen Verkehr nach sich ziehen.
Vom Wunschdenken zu wirklichen Handeln
Wie aber wäre der Flächenfraß zu stoppen? Zum einen müssen sich Nachhaltigkeitsziele an klare Adressaten richten und verbindlich sein. Das heißt, der Flächenverbrauch muss dort begrenzt werden, wo er stattfindet – auf der Ebene der Kommunen. Für die Städte und Gemeinden bedeutet das: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Statt immer wieder neue Wohn- und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese auszuweisen und unter hohem Kosten- und Ressourcenaufwand zu erschließen während Ortskerne veröden, müssten Kommunen verpflichtet werden, zunächst Baulücken und Leerstände im Innenbereich zu nutzen. Sie müssten die Möglichkeit bekommen, aufgegebene und nicht mehr bewohnte Bauten, so genannte „Schrottimmobilen“, die Ortsbilder verschandeln und mitunter eine Gefahr für Leib und Leben darstellen, zu enteignen und abreißen zu lassen.
So könnten bereits „verbrauchte“ Flächen wiederverwendet werden. Auf ihnen ließen sich attraktiver und gleichzeitig bezahlbarer Wohnraum und Kleingewerbeflächen schaffen. Familien könnten in die Dorf- und Stadtzentren gelockt werden, wo sie von kurzen Wegen dank verdichteter Bebauung profitieren. Immer neue, gesichtslose Einfamilienhaussiedlungen mit blauglänzenden Dachziegeln, Thujahecken, Toskanasäulen und Gärten im Handtuchformat würden obsolet.
Flächen zum Handelsgut machen
Zum anderen sollten neue ökonomische Anreize gesetzt werden, um Flächen zu sparen. So erfahren manche wirtschaftlich erfolgreichen Städte Zuwanderung, sie wachsen und müssen notgedrungen Wohnungen und Verkehrsinfrastruktur bauen. Sie können die Vorgaben des Flächensparens kaum erfüllen. Aber andere Kommunen verlieren Einwohner, sie benötigen keinerlei neue Flächen oder sie können bereits ausgewiesene, aber nicht in Anspruch genommene Wohn- und Gewerbegebiete aus der Planung nehmen. Sie könnten sogar ungenutzte Gebäude und Industriebrachen zurückbauen und dem Naturhaushalt zurückgeben. Bisher hat eine solche Kommune allerdings keinerlei finanziellen Vorteile, wenn sie flächensparsam handelt oder überbautes Land wieder entsiegelt.
Deshalb wäre es klug, einen Ausgleich zwischen den Kommunen, die Flächen benötigen, und solchen, die welche übrighaben, zu ermöglichen. Dazu müssten der Flächenverbrauch für alle Städte und Gemeinden entsprechend ihrer Größe und den Nachhaltigkeitszielen gedeckelt und handelbare Verbrauchszertifikate eingeführt werden. Das entspricht dem erprobten Prinzip des „cap and trade“ beim CO2-Emissionshandel, bei dem alle Treibhausgasemittenten eine begrenzte Zahl an Verschmutzungsrechten bekommen und weitere Rechte nur erhalten können, wenn sie diese einem anderen Emittenten abkaufen, der so umweltschonend arbeitet, dass er seine eigenen Rechte gar nicht vollständig in Anspruch nehmen muss.
Boomende Kommunen müssten sich also über einen Flächenhandel Verbrauchsrechte sichern und sie den schrumpfenden oder nachhaltig orientierten Kommunen abkaufen. Weil der Flächenverbrauch über die Jahre kontinuierlich gegen Null gesenkt werden soll, sich also die Gesamtmenge an handelbaren Flächenzertifikaten reduziert, wird dieses Geschäft für die sparsamen Kommunen immer attraktiver. Frankfurt oder München müssten eine Menge Geld hinlegen, um über Bebauungspläne neues Baurecht zu schaffen, die Uckermark oder die Südwestpfalz würden von dem ökologisch-ökonomischen Lastenausgleich profitieren. Weil die Zertifikate immer teurer werden, würde überwiegend dort gebaut, wo es auch einen ökonomischen Nutzen erbringt. Umgekehrt erhielten gerade Gemeinden in Schrumpfregionen, die notorisch unter Geldmangel leiden, eine neue Einnahmequelle. Das eingenommene Geld könnten sie an anderer Stelle einsetzen und ihre Attraktivität erhöhen, etwa einen Kindergarten renovieren oder das Schwimmbad subventionieren. Flächensparen wird so steuerbar – und zum Geschäftsmodell.
09.07.2022
Achtmilliarden-Grenze erreicht
Die Menschheit wächst seit Jahrzehnten in unverändertem Umfang
Beim Weltbevölkerungstag am 11. Juli ist es wie mit Weihnachten – das Datum steht, die Nachricht ist immer die Gleiche, aber früher war mehr Lametta: Auch in diesem Jahr gibt es wieder die immer gleiche Meldung, dass sich die Zahl der Menschen um rund 80 Millionen vermehrt hat. Gleichzeitig ist die Wachstumsrate der Menschheit weiter zurückgegangen.
Der jährliche Zuwachs liegt mittlerweile „nur noch“ bei gut einem Prozent. Aber weil wir als Weltgemeinschaft in diesem Jahr die Achtmilliarden-Grenze überschreiten werden, kommen immer noch so viele Weltbürgerinnen und Weltbürger hinzu wie Anfang der 1970er Jahre: Damals lag die Wachstumsrate noch bei rund zwei Prozent, es waren aber lediglich vier Milliarden Menschen zu zählen. Die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen schätzt in ihrer mittleren (aber nicht zwingend wahrscheinlichsten) Variante, dass es noch eine Weile in diesem Tempo weitergehen dürfte, bevor dieses sich langsam reduziert. Bis 2050 wären wir demnach 9,7 und bis Ende des laufenden Jahrhunderts 10,9 Milliarden.
Die Corona-Pandemie hat bis dato nach offiziellen Zahlen fast 6,5 Millionen Opfer gefordert (mit Dunkelziffer dürfte die Zahl zwei- bis dreimal so hoch sein). Ob dies das Wachstum verlangsamt hat, ist wegen mangelnder Daten bislang nicht zu sagen. Womöglich hat es sich sogar wieder beschleunigt. Denn unter den Verstorbenen waren viele, die ohnehin über kurz oder lang aus dem Leben geschieden wären. Zusätzlich haben sich angesichts der Seuche die Lebensbedingungen in den am wenigsten entwickelten Ländern zum Teil massiv verschlechtert: Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen, Mittel zur Familienplanung waren vielerorts nicht mehr wie zuvor verfügbar, Mädchen wurden aus reiner Not in jungen Jahren von ihren Familien verheiratet. Dadurch stieg die Zahl der Schwangerschaften vor allem in Afrika, Süd- und Westasien.
Haben wir ein Bevölkerungsproblem?
Die auch nicht gerade neue Frage ist, ob dieses Wachstum ein Problem ist. Immerhin spielt es sich auf einem begrenzten Planeten ab, der weder über unerschöpfliche Agrarflächen noch über ausreichende Aufnahmekapazitäten für all jene Abfallstoffe verfügt, die das Milliardenvolk hinterlässt.
Klar sei das ein Problem, befand der britische Pastor und Nationalökonom Thomas R. Malthus schon 1798 (damals gab es noch nicht einmal eine Milliarde Menschen): Denn die Zahl der Erdenbewohner wachse schneller als die Möglichkeit, ausreichend Nahrung zu produzieren. Malthus Sorge wurde rasch widerlegt und 1927 konnte die globale Landwirtschaft bereits zwei Milliarden Menschen ernähren, 1960 sogar drei Milliarden. Doch in den 1960er Jahren schürten dann einige Wissenschaftler, allen voran der amerikanische Biologe Paul R. Ehrlich, die Furcht vor einer „Bevölkerungsbombe“ und sagten den Hungertod von Hunderten Millionen voraus.
Doch seither ist die Menschheit munter weitergewachsen. Die globale Nahrungsmittelproduktion hat sich seit 1970 etwa verdreifacht. Die Kindersterblichkeit ist massiv zurückgegangen und die Lebenserwartung ist überall gestiegen, in den armen Ländern sogar stärker als in den reichen. Angesichts dieser Daten kommt man nicht umhin zu sagen, dass es den Menschen heute besser geht als vor 20, 30 oder 50 Jahren – trotz oder gar wegen des Bevölkerungswachstums.
Deshalb gab und gibt es immer auch Personen und Institutionen, die in dem Menschen-Mehr einen großen Gewinn gesehen haben oder immer noch sehen. So gehen viele Ökonomen davon aus, dass die Gleichung „mehr Menschen = mehr Konsumenten, mehr Produzenten und mehr Innovationskräfte“ zu immer mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand führen muss. Ein extremer Vertreter dieser pronatalistischen Theorie war der 1998 verstorbene US-Ökonomieprofessor Julian L. Simon. Er vertrat die Auffassung, die Menschheit könne noch über Jahrtausende im gleichen Stil weiterwachsen und müsste dabei weder Hunger noch einen Mangel an irgendetwas erfahren. Für Simon gab es keinen überzeugenden Grund, „warum der Trend zu einem besseren Leben nicht endlos weitergehen sollte“. Denn für jede erschöpfte Ressource gebe es einen besseren und billigeren Ersatz. Schließlich habe der Mensch einst Plastik erfunden, als das Elfenbein für die Billardkugeln knapp wurde. Der Erfindergeist könne jedes Versorgungsproblem lösen, solange das Bevölkerungswachstum dafür sorge, dass die Summe der menschlichen Gehirne immer größer werde.
Kein Wunder, dass Simon, der an der Universität von Maryland lehrte, große Hoffnungen in die katholische Kirche als Gegnerin der Geburtenkontrolle setzte. Sie sei die einzige Institution, „die sich der Idee verschrieben hat, dass mehr Leben etwas Gutes ist“. Der Vollständigkeit halber sollte man erwähnen, dass die männlichen Verantwortlichen in Rom nicht wirklich wissen, wovon sie reden, denn sie haben wenig praktische Erfahrung damit, wie es ist, in einem armen Land als Frau einen Haufen Kinder zur Welt und die Familie über die Runden zu bringen.
Wo viele Menschen vor allem Probleme mit sich bringen
Angesichts der sich verschärfenden multidimensionalen globalen Krisen hat sich die Begeisterung über den Zugewinn an neuen Seelen vielerorts gelegt. Bevölkerungswachstum bedeutet gerade für stark die betroffenen Länder keinerlei ökonomische Vorteile. Vielmehr ist dort die Arbeitslosigkeit gerade unter den kopfstarken jüngeren Erwerbsfähigen extrem hoch. Die am stärksten wachsenden Länder zeichnen sich gerade nicht durch geniale Erfindungen aus, mit denen sich Versorgungsprobleme lösen ließen. Perspektivlosigkeit und Armut bedeuten dort nicht nur anhaltend hohe Geburtenziffern, sondern erhöhen die Gefahr von sozialen Konflikten, politischen Unruhen bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen.
Viele Indikatoren weisen darauf hin, dass es zumindest einen Zusammenhang zwischen hohem Bevölkerungswachstum und sozialen, wirtschaftlichen sowie politischen Krisen gibt, auch wenn ersteres nie die einzige Erklärung für eine krisenhafte Entwicklung liefern kann. So weisen sämtliche Länder, die im Index der fragilen Staaten des US-amerikanischen Fund for Peace in die Kategorien „großer“ und „sehr großer Alarm“ fallen, Geburtenziffern von 3,6 bis 6,9 Kindern je Frau auf: Syrien, Afghanistan, Somalia, Jemen, Sudan, Südsudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik und Demokratische Republik Kongo. Im Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen finden sich ganz am Ende fast ausschließlich Länder, in denen die Zahl der Menschen jährlich um bis zu 3,7 Prozent wächst, also fast viermal so stark wie die Weltbevölkerung insgesamt. Ähnliche Zahlen gelten für den Welthungerindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Überall wo die Lebenserwartung niedrig, die Kindersterblichkeit hoch liegen und Frauen wenig Rechte haben, weisen Geburtenziffern und Bevölkerungswachstum tendenziell hohe bis sehr hohe Werte auf.
Mehr Menschen bedeuten für diese Länder mit Sicherheit mehr Probleme. Nur verbesserte Gesundheitssysteme, Bildung, vor allem für Mädchen und Frauen, sowie ausreichend Arbeitsplätze, die den Menschen eine Perspektive bieten, können die Geburtenziffern senken und dem Kreislauf aus Armut und weiterem Bevölkerungswachstum ein Ende bereiten. So ähnlich hatte es Thomas R. Malthus schon vor 244 Jahren in seinem „Essay on the Principle of Population“ geschrieben. Es gilt heute umso mehr. Soviel bis zum nächsten Weltbevölkerungstag am 11. Juli 2023.
Beim Weltbevölkerungstag am 11. Juli ist es wie mit Weihnachten – das Datum steht, die Nachricht ist immer die Gleiche, aber früher war mehr Lametta: Auch in diesem Jahr gibt es wieder die immer gleiche Meldung, dass sich die Zahl der Menschen um rund 80 Millionen vermehrt hat. Gleichzeitig ist die Wachstumsrate der Menschheit weiter zurückgegangen.
Der jährliche Zuwachs liegt mittlerweile „nur noch“ bei gut einem Prozent. Aber weil wir als Weltgemeinschaft in diesem Jahr die Achtmilliarden-Grenze überschreiten werden, kommen immer noch so viele Weltbürgerinnen und Weltbürger hinzu wie Anfang der 1970er Jahre: Damals lag die Wachstumsrate noch bei rund zwei Prozent, es waren aber lediglich vier Milliarden Menschen zu zählen. Die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen schätzt in ihrer mittleren (aber nicht zwingend wahrscheinlichsten) Variante, dass es noch eine Weile in diesem Tempo weitergehen dürfte, bevor dieses sich langsam reduziert. Bis 2050 wären wir demnach 9,7 und bis Ende des laufenden Jahrhunderts 10,9 Milliarden.
Die Corona-Pandemie hat bis dato nach offiziellen Zahlen fast 6,5 Millionen Opfer gefordert (mit Dunkelziffer dürfte die Zahl zwei- bis dreimal so hoch sein). Ob dies das Wachstum verlangsamt hat, ist wegen mangelnder Daten bislang nicht zu sagen. Womöglich hat es sich sogar wieder beschleunigt. Denn unter den Verstorbenen waren viele, die ohnehin über kurz oder lang aus dem Leben geschieden wären. Zusätzlich haben sich angesichts der Seuche die Lebensbedingungen in den am wenigsten entwickelten Ländern zum Teil massiv verschlechtert: Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen, Mittel zur Familienplanung waren vielerorts nicht mehr wie zuvor verfügbar, Mädchen wurden aus reiner Not in jungen Jahren von ihren Familien verheiratet. Dadurch stieg die Zahl der Schwangerschaften vor allem in Afrika, Süd- und Westasien.
Haben wir ein Bevölkerungsproblem?
Die auch nicht gerade neue Frage ist, ob dieses Wachstum ein Problem ist. Immerhin spielt es sich auf einem begrenzten Planeten ab, der weder über unerschöpfliche Agrarflächen noch über ausreichende Aufnahmekapazitäten für all jene Abfallstoffe verfügt, die das Milliardenvolk hinterlässt.
Klar sei das ein Problem, befand der britische Pastor und Nationalökonom Thomas R. Malthus schon 1798 (damals gab es noch nicht einmal eine Milliarde Menschen): Denn die Zahl der Erdenbewohner wachse schneller als die Möglichkeit, ausreichend Nahrung zu produzieren. Malthus Sorge wurde rasch widerlegt und 1927 konnte die globale Landwirtschaft bereits zwei Milliarden Menschen ernähren, 1960 sogar drei Milliarden. Doch in den 1960er Jahren schürten dann einige Wissenschaftler, allen voran der amerikanische Biologe Paul R. Ehrlich, die Furcht vor einer „Bevölkerungsbombe“ und sagten den Hungertod von Hunderten Millionen voraus.
Doch seither ist die Menschheit munter weitergewachsen. Die globale Nahrungsmittelproduktion hat sich seit 1970 etwa verdreifacht. Die Kindersterblichkeit ist massiv zurückgegangen und die Lebenserwartung ist überall gestiegen, in den armen Ländern sogar stärker als in den reichen. Angesichts dieser Daten kommt man nicht umhin zu sagen, dass es den Menschen heute besser geht als vor 20, 30 oder 50 Jahren – trotz oder gar wegen des Bevölkerungswachstums.
Deshalb gab und gibt es immer auch Personen und Institutionen, die in dem Menschen-Mehr einen großen Gewinn gesehen haben oder immer noch sehen. So gehen viele Ökonomen davon aus, dass die Gleichung „mehr Menschen = mehr Konsumenten, mehr Produzenten und mehr Innovationskräfte“ zu immer mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand führen muss. Ein extremer Vertreter dieser pronatalistischen Theorie war der 1998 verstorbene US-Ökonomieprofessor Julian L. Simon. Er vertrat die Auffassung, die Menschheit könne noch über Jahrtausende im gleichen Stil weiterwachsen und müsste dabei weder Hunger noch einen Mangel an irgendetwas erfahren. Für Simon gab es keinen überzeugenden Grund, „warum der Trend zu einem besseren Leben nicht endlos weitergehen sollte“. Denn für jede erschöpfte Ressource gebe es einen besseren und billigeren Ersatz. Schließlich habe der Mensch einst Plastik erfunden, als das Elfenbein für die Billardkugeln knapp wurde. Der Erfindergeist könne jedes Versorgungsproblem lösen, solange das Bevölkerungswachstum dafür sorge, dass die Summe der menschlichen Gehirne immer größer werde.
Kein Wunder, dass Simon, der an der Universität von Maryland lehrte, große Hoffnungen in die katholische Kirche als Gegnerin der Geburtenkontrolle setzte. Sie sei die einzige Institution, „die sich der Idee verschrieben hat, dass mehr Leben etwas Gutes ist“. Der Vollständigkeit halber sollte man erwähnen, dass die männlichen Verantwortlichen in Rom nicht wirklich wissen, wovon sie reden, denn sie haben wenig praktische Erfahrung damit, wie es ist, in einem armen Land als Frau einen Haufen Kinder zur Welt und die Familie über die Runden zu bringen.
Wo viele Menschen vor allem Probleme mit sich bringen
Angesichts der sich verschärfenden multidimensionalen globalen Krisen hat sich die Begeisterung über den Zugewinn an neuen Seelen vielerorts gelegt. Bevölkerungswachstum bedeutet gerade für stark die betroffenen Länder keinerlei ökonomische Vorteile. Vielmehr ist dort die Arbeitslosigkeit gerade unter den kopfstarken jüngeren Erwerbsfähigen extrem hoch. Die am stärksten wachsenden Länder zeichnen sich gerade nicht durch geniale Erfindungen aus, mit denen sich Versorgungsprobleme lösen ließen. Perspektivlosigkeit und Armut bedeuten dort nicht nur anhaltend hohe Geburtenziffern, sondern erhöhen die Gefahr von sozialen Konflikten, politischen Unruhen bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen.
Viele Indikatoren weisen darauf hin, dass es zumindest einen Zusammenhang zwischen hohem Bevölkerungswachstum und sozialen, wirtschaftlichen sowie politischen Krisen gibt, auch wenn ersteres nie die einzige Erklärung für eine krisenhafte Entwicklung liefern kann. So weisen sämtliche Länder, die im Index der fragilen Staaten des US-amerikanischen Fund for Peace in die Kategorien „großer“ und „sehr großer Alarm“ fallen, Geburtenziffern von 3,6 bis 6,9 Kindern je Frau auf: Syrien, Afghanistan, Somalia, Jemen, Sudan, Südsudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik und Demokratische Republik Kongo. Im Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen finden sich ganz am Ende fast ausschließlich Länder, in denen die Zahl der Menschen jährlich um bis zu 3,7 Prozent wächst, also fast viermal so stark wie die Weltbevölkerung insgesamt. Ähnliche Zahlen gelten für den Welthungerindex der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Überall wo die Lebenserwartung niedrig, die Kindersterblichkeit hoch liegen und Frauen wenig Rechte haben, weisen Geburtenziffern und Bevölkerungswachstum tendenziell hohe bis sehr hohe Werte auf.
Mehr Menschen bedeuten für diese Länder mit Sicherheit mehr Probleme. Nur verbesserte Gesundheitssysteme, Bildung, vor allem für Mädchen und Frauen, sowie ausreichend Arbeitsplätze, die den Menschen eine Perspektive bieten, können die Geburtenziffern senken und dem Kreislauf aus Armut und weiterem Bevölkerungswachstum ein Ende bereiten. So ähnlich hatte es Thomas R. Malthus schon vor 244 Jahren in seinem „Essay on the Principle of Population“ geschrieben. Es gilt heute umso mehr. Soviel bis zum nächsten Weltbevölkerungstag am 11. Juli 2023.
04.06.2022
Und wer macht eigentlich morgen die Arbeit?
Der Fachkräftemangel kommt alles andere als überraschend
Jede moderne Gesellschaft braucht Menschen, die arbeiten, sich um die Volkswirtschaft verdient machen und Steuern zahlen. Deshalb sollten Politik und Unternehmen stets ein Auge auf die demografische Entwicklung der Gesamtbevölkerung und ihrer Belegschaften haben. Nur so erhalten sie ein einigermaßen zuverlässiges Bild darüber, wie viele Personen über die nächsten 10, 20 oder 30 Jahre als potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Demografische Vorhersagen sind so ziemlich das Zuverlässigste, was die amtliche Statistik zu bieten hat.
Insofern ist es bemerkenswert, wie wenig sich Arbeitgeber und Verwaltung in der Vergangenheit für die Bevölkerungszusammensetzung interessiert haben. Immerhin liegen die Kinderzahlen in Deutschland schon für ein halbes Jahrhundert so niedrig, dass jede Nachwuchsgeneration die ihrer Eltern nur zu etwa zwei Drittel ersetzen kann. Die Bevölkerung zwischen Rügen und dem Bodensee wäre seit 1972 in jedem Jahr geschrumpft, hätte es keine Zuwanderung gegeben. Seit fünf Jahrzehnten ist im Prinzip bekannt, dass zeitversetzt zum Rückgang der Geburtenziffern stark besetzte Kohorten von Personen im Erwerbsalter von deutlich dünner besetzten ersetzt werden und gleichzeitig die Zahl der Ruheständler wächst. Und zwar nicht irgendwann, sondern exakt vorausberechenbar.
Vorausschauende Planung gehört jedoch nicht zu den herausragenden Eigenschaften der Menschen, was sich generell beim Umgang mit Entwicklungen zeigt, die eine lange Vorlaufzeit haben, vom Klimawandel bis zum Artenschwund. Eine adäquate Antwort auf den demografischen Wandel wurde zudem dadurch gestört, dass er sich lange Jahre überaus positiv auf das Wirtschaftsgeschehen auswirkte. Denn weniger Nachwuchs bedeutet einerseits weniger Kosten für Familien und den Staat. Andererseits sind die stark besetzten Jahrgänge der Babyboomer, die sich wie eine Beule in der Bevölkerungspyramide nach oben schieben, relativ gut gebildet, haben meist einträgliche Jobs und sind verlässliche Zahler von Steuern und Sozialbeiträgen. Sie sind, neben den Zuwanderern, der Hauptgrund dafür, dass Deutschland in den vergangenen Jahren Rekordbeschäftigungszahlen wie auch Rekordsteuereinnahmen verbuchen konnte.
Bye, bye Babyboomer
Mittlerweile aber haben die ersten Jahrgänge der Babyboomer das Ruhestandsalter erreicht. Im Jahr 2030, zum Höhepunkt der Babyboomer-Verrentung, werden sich doppelt so viele Menschen aus dem Erwerbsleben verabschieden, wie gleichzeitig von unten in den Arbeitsmarkt hineinwachsen. Bis 2035 werden die bevölkerungsreichsten Kohorten, die Deutschland je hatte, nahezu komplett aus dem Arbeitsleben ausscheiden, mit Ausnahme jener, die aus eigenem Antrieb länger arbeiten wollen oder müssen, weil sie das Geld brauchen. Es schrumpft also die demografische Mitte der Bevölkerung, und damit jene Gruppe, die im Wesentlichen für den Wohlstand der Gesellschaft sorgt. Der Personalmangel in praktisch allen Wirtschaftsbereichen kommt mit Sicherheit, aber sicher nicht überraschend.
Nahezu flächendeckend fehlen Fachkräfte schon heute in der Bauwirtschaft, bei Berufskraftfahrern, im Erziehungsbereich sowie in allen Gesundheits- und Pflegeberufen. Im Handwerk bleiben fast 40 Prozent der angebotenen Stellen für Auszubildende unbesetzt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) beziffert den aktuellen Mangel im Mint-Bereich, also in den industrierelevanten Kernfächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik auf 320.000 Fachkräfte – Tendenz steigend. In Sachen Digitalisierung, wo Deutschland einen gewissen Nachholbedarf hat, dürfte es kaum so rasch vorangehen wie nötig, ebenso beim energetischen Umbau des Wohnungsbestandes und der Umstellung auf eine kohlenstofffreie Energieversorgung. Besonders betroffen ist die öffentliche Verwaltung, die bei den Gehältern für die heißbegehrten IT-Experten kaum mit den privaten Unternehmen mithalten kann. Und wo die Verwaltung nicht endlich digitalisiert wird, hinken Planungsprozesse, Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben und Unternehmensansiedlung noch stärker hinterher als ohnehin schon. Beschleunigung sieht anders aus.
Wie immer können wirtschaftsstarke Branchen und Regionen über gute Gehälter besser auf den Mangel reagieren. Das aber geht zwangsläufig auf Kosten anderer. Besonders negativ betroffen sind Gebiete im Osten Deutschlands, vor allem dort, wo sich in der Vergangenheit junge Menschen auf der Suche nach Ausbildung und Beschäftigung auf den Weg nach Westen oder in die ostdeutschen Großstädte gemacht haben und es entsprechend heute an jungen Familien und Nachwuchs fehlt. Mancherorts in den neuen Bundesländern wird bis 2035 ein Drittel des Arbeitskräfteangebots verloren gehen. Dort sind viele kleine und mittlere Unternehmen gefährdet, schlicht und einfach, weil sie keine Auszubildenden und Arbeitskräfte mehr finden. Aber auch erfolgreiche Betriebe in Südwestfalen, dem Oldenburger Münsterland oder auf der Schwäbischen Alb, darunter viele verborgene Weltmarktführer, die sogenannten Hidden Champions, haben immer mehr mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen.
In absoluten Zahlen werden interessanterweise die wirtschaftsstarken Regionen im Süden Deutschlands am meisten Arbeitskräfte verlieren, denn dort sind überproportional viele Babyboomer beschäftigt. Viele von ihnen wurden in der Vergangenheit mit guten Jobangeboten aus anderen Teilen Deutschlands angelockt. Diese Gebiete haben mit einer massiven Verrentungswelle zu rechnen. Bayerische Landkreise wie Freising oder Erding, die zu den wohlhabendsten der Republik gehören, müssen bis 2035 mit einem Anstieg der Ruheständler um etwa 50 Prozent rechnen.
Potenziale zum Teil ausgeschöpft
Wie sich dem Mangel an Arbeitskräften begegnen lässt, wird seit langem diskutiert: Mehr Frauen ins Berufsleben, gezielte Anwerbung von Zuwanderern und länger arbeiten. In diesen Bereichen ist seither Einiges geschehen, so dass die Möglichkeiten dadurch mehr Personen für den Arbeitsmarkt zu gewinnen teilweise schon ausgeschöpft sind. Bleibt ein letzter Bereich, bei dem es in Deutschland kaum vorangeht: die Bildung. Seit Jahren erreichen zwischen sechs und sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler eines Abschlussjahrgangs nicht einmal den Hauptschulabschluss. Männer häufiger als Frauen. Mindestens noch einmal so viele Jugendliche gelten als „nicht ausbildungsfähig oder -willig“, weil sie trotz Schulabschlusszertifikat kaum lesen, schreiben und rechnen können oder psychisch nicht in der Lage sind einen Acht-Stundentag durchzuhalten. Diese jungen Menschen werden mit geringen Chancen in ihre Berufskarriere entlassen, sie gehen der Volkswirtschaft verloren, vielen droht die Arbeitslosigkeit, auch wenn es überall an Arbeitskräften mangelt.
Im Bereich Bildung wären somit noch ungeahnte Schätze für den Arbeitsmarkt zu heben. Doch dafür wären zusätzliche und motivierte und motivierende Lehrkräfte nötig. An denen aber fehlt es auch. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht, weil Schulpolitik Ländersache ist und die Verantwortlichen ungern ihre eigenen Defizite auf den Tisch legen. Eltern berichten allerdings häufig von Unterrichtsausfall oder dass in bestimmten Fächern gar nicht unterrichtet wird. Immerhin schätzt die Kultusministerkonferenz, dass landesweit bis 2030 rund 14.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen werden, besonders hoch ist der Bedarf an Berufsschulen. Aber auch diese Zahl könnte schöngerechnet sein, denn Studien von Bildungswissenschaftlern kommen auf einen Fehlbestand von bis zu 80.000 Kräften. Berücksichtigt man die geplanten politischen Reformvorhaben wie Ganztagsschule, Inklusion und die Unterstützung von Kindern in heiklen sozialen Lagen sowie die steigende Zahl von Flüchtlingskindern, die erst noch die deutsche Sprache lernen müssen, dann ist die Lehrerlücke noch einmal deutlich größer.
Ein Grund für den Lehrkräftemangel findet sich wiederum in der Demografie: Einerseits kamen in Deutschland zwischen 2010 und 2020 trotz insgesamt niedriger Geburtenziffern etwas mehr Kinder zur Welt, weil es vergleichsweise viele Menschen im Familiengründungsalter gab. Es waren die Enkel der geburtenstarken Babyboomer, die für diesen Echoeffekt in den Geburtskliniken gesorgt hatten. Zudem sorgten gewisse Erfolge der Familienpolitik dafür, dass sich junge Menschen wieder etwas häufiger für Nachwuchs entschieden. Andererseits hat auch die Altersstruktur des Lehrpersonals ihre typische Babyboomer-Beule. Und das bedeutet auch hier eine massive Verrentungswelle bis 2035.
Das Beruhigende an der Demografie ist, dass auch diese Entwicklungen mit großem Vorlauf zu erwarten waren. Demografische Prognosen sind im Grund nichts anderes als buchhalterische Fortschreibungen, nach dem Prinzip: Wer heute 30 Jahre alt ist, zählt in 20 Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 50 Jahre
24.03.2022
Die Jungen müssen uns retten
Aber werden sie es tun?
Landläufiger Meinung nach interessieren und engagieren sich die jungen Menschen tendenziell mehr für Umweltfragen als die Generation ihrer Eltern und Großeltern. So dürfte das Durchschnittsalter jener, die sich aus Protest gegen eine irrlichternde Klimapolitik auf Autobahnen festkleben, bei gut 20 Jahren liegen. Greta Thunberg, die Begründerin der Bewegung „Fridays for Future“, ist 19 Jahre alt.
Der Aktivismus der Jugend ist verständlich, schließlich wächst die „Generation Greta“ in einer multidimensionalen Umweltkrise auf. Sie wird deren Folgen weitaus länger und heftiger ertragen müssen als die Generation der Babyboomer, die ihr den Schlamassel eingebrockt hat, die derzeit ins Rentenalter hineinwächst und auch noch erwartet, dass die ihr verbleibenden Ruhestandsjahre von den Jüngeren finanziert werden. Der gute alte Spruch, dass es „unsere Kinder einmal besser haben sollen als wir“, wirkt angesichts dieser intergenerationellen Schieflage reichlich deplatziert.
Doch stimmt es überhaupt, dass die junge Generation umweltbewusster denkt und handelt als die ihrer Eltern und Großeltern? Das ist schwer zu sagen. Zwar ist der kumulierte Umweltschaden der Älteren mit Sicherheit größer, denn sie hatten schlicht und einfach mehr Zeit, über ihre Verhältnisse zu leben, also mehr Ressourcen zu verbrauchen und mehr Schadstoffe zu hinterlassen, als die Umwelt nachliefern respektive vertragen kann. Ältere sitzen auch häufiger im SUV auf dem Weg zur Arbeit, während junge Menschen eher mit dem Fahrrad oder im öffentlichen Nahverkehr zur Schule fahren. Aber niemand weiß, wie sich der ökologische Rucksack der heute Jungen über ihre Lebenszeit füllen wird.
Studien, die auf Befragungen zum Umweltbewusstein und -verhalten der Generationen beruhen, geben keine klare Antwort auf die Frage, ob sich nun die Jungen oder die Alten im Sinne der Nachhaltigkeit besser verhalten. So geht aus einer Untersuchung des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2019 hervor, dass Jugendliche zwischen 14 und 22 Jahren zwar recht gut Bescheid wissen um die Folgen des fossilen Energieverbrauchs, über das Bienensterben oder den Einfluss des Fleischkonsums auf den Klimawandel. Wenn es aber darum geht, wie jeder Einzelne den Energieverbrauch im Haushalt reduzieren kann, also um das „handlungsrelevante Umweltwissen“, dann sieht es mit dem Umweltbewusstsein der Jüngeren schon schlechter aus.
Eine Studie des Heidelberger Sinus-Instituts zeigt ein ähnliches Bild: Fast die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland würde zugunsten des Klimas auf das neuste Handy verzichten. Aber nur rund ein Fünftel achtet beim Einkaufen von Lebensmitteln tatsächlich auf Regionalität und Saisonalität oder sagt aus Klimaschutzgründen Nein zu Fast Food, Lieferessen und Coffee-to-go. Ohnehin ist die Generation Greta eine heterogene Gruppe, einerseits mit jungen Menschen, die sich bewusst vegan ernähren und auf Flugreisen verzichten und andererseits mit Gleichaltrigen, die auf Burger stehen, Billigklamotten shoppen, bis der Arzt kommt, stundenlang am Handy hängen, streamen, posten, whatsappen, instagrammen und gamen, was das Zeug hält und damit die klimaschädlichen Server in den Rechenzentren heiß laufen lassen. Vor allem Jugendliche aus sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen mit geringem Bildungsabschluss haben mit Umweltschutz wenig am Hut. Dafür verfügen besser gebildete junge Menschen über mehr Geld. Und Geld bedeutet Konsum, also Rohstoff- und Energieverbrauch.
Die Vorstellung von alten Umweltschweinen und jungen Klimaschützern ist falsch
Eine Untersuchung der Versicherungsgesellschaft Aviva in Großbritannien offenbart, dass sich Jugendliche zwar eher als Ältere besorgt und betroffen zeigen, wenn es um den Zustand der Umwelt geht – sie fühlen sich schlecht, wenn sie auf den Zustand der Welt blicken. Im Alltag allerdings verhalten sich die Mitglieder der Generation 55+ in nahezu allen umweltrelevanten Bereichen verantwortungsvoller als die 16- bis 24-Jährigen: Sie trennen den Müll besser, vermeiden häufiger Plastik, drehen eher die Heizung im Winter runter, kaufen weniger Klamotten und verzichten eher auf Flüge. Nur bei der veganen Ernährung liegen die Jungen vorne. Dass die Älteren besser dastehen, mag daran liegen, dass sie sich eher bewusst sind, welchen ökologischen Schaden sie zeit ihres Lebens bereits angerichtet haben. Und daran, dass sie häufig Eltern und Großeltern sind und sich verantwortlich dafür fühlen, wie sie ihren Kindern und Enkeln den Planeten hinterlassen, ein Denken, das junge Menschen noch gar nicht entwickeln können. Über alle Altersgruppen hinweg glauben die Befragten mehrheitlich (zu 78 Prozent), dass sie eine persönliche Verantwortung haben, die Klimakrise zu bekämpfen. Wenn es aber darum geht, wirklich etwas gegen Klimawandel und Naturverbrauch zu tun, ist nur eine Minderheit bereit sich einzuschränken. Da geht es den Älteren wie den Jüngeren.
Vorsicht vor Fatalismus und Radikalismus
Trotzdem wird es zwangsläufig vor allem die Aufgabe der Jüngeren sein, die Umweltherausforderungen der Zukunft zu lösen. Sie müssen die dringend nötigen neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle für ein Wohlergehen der Menschen ohne Umweltschäden mit Leben füllen. Das seit Jahren wachsende Bewusstsein für mehr Klimaschutz bei Älteren wie Jüngeren ist ein erstes positives Zeichen, es reicht aber bei Weitem nicht. Aus Bewusstsein müssen Taten und politische Konzepte werden, die gegen vielerlei Widerstände durchzusetzen sind. Das ist ein mühsames und langwieriges Geschäft, während die Zeit drängt: Der Klimawandel und die anderen Umweltprobleme schaukeln sich immer weiter auf, verstärken sich zum Teil gegenseitig und kommen sogenannten Kipppunkten näher. Das sind abrupte Systemveränderungen, die auch durch massive Umweltschutzmaßnehmen nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
In dieser Situation neigen junge Menschen mitunter zu Radikalismus oder Fatalismus. Sie versuchen mit gewaltsamen Protesten das zu durchzusetzen, was die Politik nicht hinbekommen hat, erreichen dabei aber in der Regel nur das Gegenteil. Oder sie resignieren, weil es sich angeblich nicht mehr lohnt etwas gegen Klimawandel und Co. zu unternehmen. Tatsächlich zeigt eine Studie des Londoner King’s College und des New Scientist, dass die Jüngeren eher zum Öko-Fatalismus neigen als die Älteren: Ein Drittel der 18- bis 25-Jährigen glaubt, dass sich nicht mehr lohnt, den Klimawandel mit Verhaltensänderungen zu bekämpfen, weil die Sache eh gelaufen ist. Bei der Generation der Babyboomer hat nur ein Fünftel die Hoffnung total aufgegeben.
Vielleicht sollten sich alle Generationen zusammentun, Radikalismus und Fatalismus über Bord werfen und gegen Pragmatismus eintauschen. Das Wissen um die Umweltprobleme und deren Lösung liegt auf dem Tisch. Jetzt ist die Zeit zu handeln – und zwar schnell.
09.03.2022
Atommacht auf Schrumpfkurs
Der demografische Wandel bedroht Russland mehr als die Nato
146 Millionen sind eine ganze Menge Menschen. Ungefähr so viele leben in Frankreich und Deutschland zusammen. Oder in Russland. Schaut man sich allerdings die Wirtschaftskraft der drei Staaten an, dann kommen die beiden EU-Länder zusammen auf über das Vierfache des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von Russland. Die Russen erwirtschaften also nur ein Viertel an Werten in Form von Gütern und Dienstleistungen. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass ein großer Teil der Wertschöpfung durch das Herumpumpen von Erdöl und Erdgas oder das Abbaggern von Kohle und Erzen zustande kommt, dann bringen die 146 Millionen Bewohner Russlands im Sinne einer modernen Volkswirtschaft ziemlich wenig auf die Waage. Selbst der ehemalige Marionettenpräsident Dmitri Medwedew hat die Rohstoffökonomie einmal als „primitiv“ bezeichnet.
Das Land, das sich gerne als Supermacht sieht, mag über das größte Atomwaffenarsenal der Welt und die neuntgrößte Bevölkerung verfügen, ist aber global gesehen kein wirklich großer Player. Jedenfalls nicht mehr so wie früher. Im Jahr 2000 stellte Russland (als Unionsrepublik der UdSSR) noch die sechstgrößte Bevölkerung der Welt, 1950 sogar die viertgrößte. Und die Sowjetunion, die nach ihrem Ende im Jahr 1991 in 15 unabhängige Nachfolgestaaten zerfiel, stand mit 293 Millionen Einwohnern sogar auf Platz drei der bevölkerungsreichsten Länder, nach China und Indien, aber vor allem vor dem Erzfeind USA mit 250 Millionen. Über die ganze Phase des Kalten Krieges konnte die Sowjetunion die Vereinigten Staaten demografisch in Schatten stellen.
Heute haben die USA fast 200 Millionen Einwohner mehr als Russland, wobei die Amerikanerinnen und Amerikaner pro Kopf volkswirtschaftlich dreimal produktiver sind. Diese Zahlen muss der ehemalige US-Präsident Barak Obama vor Augen gehabt haben, als er die Russen einmal etwas abfällig als „Regionalmacht“ bezeichnete.
Für Russlands Präsidenten Wladimir Putin muss das die größte anzunehmende Kränkung gewesen sein. Aber auch die demografische Degradierung seines Reiches dürfte zu der kaum mehr zu übersehenden Schwermut des Präsidenten beitragen, der, und darin liegt die große Gefahr, seine „unterschwellige Unsicherheit mit übertriebener Gegenwehr“ kompensiere, wie der US-Psychologe Jerrold Post, der langjährige Leiter des „Zentrums für die Analyse von Persönlichkeit und politischem Verhalten“ des Geheimdienstes CIA einmal geschrieben hat.
Wo Menschenleben und Humanvermögen wenig gelten
Natürlich misst sich der Einfluss oder die Macht eines Staates und seiner Wirtschaft nicht an der Zahl der Menschen, die dort leben. Ansonsten könnte die Schweiz mit ihren 8,6 Millionen Eidgenossen kein BIP ausweisen, das fast doppelt so hoch ist wie das von Nigeria, wo sich 215 Millionen Menschen tummeln.
Der Schlüssel zum Erfolg in Informations- und Wissensgesellschaften ist das Humankapital, das sich im Wesentlichen aus dem Bildungs- und dem Gesundheitszustand der Bevölkerung zusammensetzt. Gesunde und qualifizierte Bürger tragen am meisten zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand bei. Dafür muss eine Regierung ein gutes Bildungssystem bereithalten, das möglichst vielen Mitgliedern der Gesellschaft zugutekommt, sie muss in medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention investieren und den Menschen die Freiheiten geben sich wirtschaftlich und gesellschaftlich zu entfalten.
Von diesen Bedingungen ist Russland meilenweit entfernt. Es behandelt das Humankapital, die Potenziale seiner Bürgerinnen und Bürger geradezu liederlich: Ein großer Teil der intellektuellen Elite ist entweder mundtot gemacht oder sitzt im Gefängnis. Wer kann, setzt sich ins Ausland ab. Die Oligarchen, die nicht unbedingt zu dieser Elite zählen, verschieben ihre Milliarden dorthin, weshalb es in Russland an Investitionen fehlt, um die Wirtschaft zu modernisieren. Die gut ausgebildete, urbane Mittelschicht erlebt seit Jahren einen Braindrain. Vor allem Wissenschaftler, Finanz- und Technologieexperten wandern ab, ein Trend, der sich durch den Ukrainekrieg und die verhängten Sanktionen beschleunigen würde, wären da nicht die geschlossenen Botschaften und die gestrichenen Flugverbindungen ins westliche Ausland.
Als Gründe für ihre Abwanderung nennen die Migranten vor allem die autoritäre Politik des Kremls, Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Korruption. Seit Putin an der Macht ist, haben über zwei Millionen Fachkräfte das Land verlassen, heißt es in der Studie „The Putin Exodus“ der Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council. Ziel sind die westlichen Demokratien, in denen es sich freier arbeiten lässt. Während die Sowjetunion, die vergleichsweise viel Geld in die Forschung gesteckt hat, bekannt war für ihre guten Naturwissenschaftler und öfter mal Nobelpreise abräumen konnte, gehen die Auszeichnungen für russische Wissenschaftler mittlerweile eher an Personen, die im niederländischen, britischen oder US-amerikanischen Exil forschen.
Gerade junge Menschen, das zeigen Umfragen, würden Russland in Scharen verlassen, wenn sie könnten. Die Verdienstmöglichkeiten sind schlecht, vor allem wenn die richtigen Beziehungen fehlen. Die Miete in großen Städten wie Moskau oder St. Petersburg frisst die Hälfte des Einkommens. Ein weiterer Grund, Russland hinter sich zu lassen, ist der Wehrdienst. Männer zwischen 18 und 28 Jahren werden für ein Jahr eingezogen, wenn sie sich nicht mit Schmiergeld freikaufen oder einen Studienplatz vorweisen können, wofür ebenfalls Geld notwendig ist. Das ist der Grund dafür, dass die meisten Rekruten aus armen Familien stammen, schlecht ernährt und wenig gebildet sind und oftmals Alkohol- oder Drogenprobleme haben. Nach einem halben Jahr Ausbildung können die Soldaten in Kriegsgebiete entsandt werden. Kommen sie verletzt zurück, ist das Militär nicht mehr zuständig, die Invaliden können sehen, wie sie über die Runden kommen.
Generell gilt ein Menschenleben wenig in der Truppe. In den Kasernen gilt eine brutale Hackordnung, Dienstältere schikanieren und verprügeln regelmäßig die Untergebenen. „Dedowtschina“ heißt die Quälerei im militärischen Fachjargon. Geschätzte 3.000 Rekruten gehen jedes Jahr an den Misshandlungen zugrunde. Und im Kriegseinsatz, wie derzeit in der Ukraine, werden die jungen Soldaten weitgehend unvorbereitet auf das, was sie erwartet, als Kanonenfutter verheizt. Wie viele Russen in den Kämpfen ihr Leben lassen lässt sich nicht überprüfen, es dürften aber auf alle Fälle deutlich mehr sein als die 498 Gefallenen, die von der russischen Regierung bis zur ersten Märzwoche 2022 bestätigt sind.
Russische Lebenserwartung von Männern auf dem Niveau eines Entwicklungslandes
Ob sich mit diesem Humanverschleiß dauerhaft ein russischer Staat machen lässt, ist eine andere Frage. Denn das Land liegt ohnehin schon seit Jahren auf demografischem Schrumpfkurs. Die Ursachen dafür sind vielfältig und liegen zum Teil lange zurück. Hunger, Krieg, Vertreibung, Zwangsarbeit und Völkermord haben die Bevölkerung immer wieder dezimiert, zu Zarenzeiten, unter Stalin und durch den Zweiten Weltkrieg. Die kopfstarke Nachkriegsgeneration ist bereits im Rentenalter und die Kohorte der jungen Erwachsenen, die eigentlich für Innovation und Aufbruch stehen sollte, ist massiv ausgedünnt, weil sie in der extrem kinderarmen Zeit der Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geboren ist. Die Zahl der Menschen im Erwerbsalter sinkt kontinuierlich. Bis 2030 dürften es gegenüber heute rund sieben Millionen weniger sein.
Vor allem in der Post-Sowjetzeit durchlief das neu entstandene Russland eine schwere sozioökonomische Krise. Ähnlich wie in der ehemaligen DDR waren ganze Industriestrukturen zusammengebrochen, ländliche Gebiete, die einst zwangsbesiedelt waren, liefen leer. Armut, exzessiver Alkoholkonsum, Unfälle, Gewaltverbrechen, Selbstmorde, Tuberkulose und Aids forderten ihren Zoll. Vor allem Männer, die Probleme am liebsten mit Wodka lösen, waren die Verlierer des Wandels. Ihre Lebenserwartung sank 1994 auf gut 57,6 Jahre, so früh starben sie nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Frauen hatten immerhin 14 Jahre mehr vom Leben.
Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas verbessert und russische Männer können damit rechnen immerhin 66 Jahre alt zu werden. Damit verbringen sie im Schnitt gerade mal vier Jahre im Rentenalter, das derzeit für Männer mit 62 Jahren beginnt. Russland zahlt zwar nur mickrige Altersbezüge, mit denen die Alten kaum über die Runden kommen, aber das Rentensystem steht vergleichsweise gut da, weil die Menschen so früh versterben. Wie schlecht es um die Gesundheit der Russen und die medizinische Versorgung in der vermeintlichen Supermacht steht, zeigt der Vergleich mit dem armen Entwicklungsland Bangladesch: Dort können Männer im Schnitt mit 71 Jahren Lebenserwartung rechnen.
Wenig Lust auf Kinder
Die Umbrüche haben auch den Wunsch junger Menschen gebremst, eine Familie zu gründen. Innerhalb eines Jahrzehnts sackte die Geburtenziffer von über 2,0 auf 1,2 Kinder je Frau ab. 2,1 Kinder wären nötig, um langfristig eine stabile Bevölkerung zu halten. Im Jahr 2000, während der Rubelkrise, kamen in Russland nur noch 1,2 Millionen Kinder zur Welt, während 2,2 Millionen Menschen starben. Die Zeichen standen eindeutig auf Einwohnerschwund und damit verbunden auf einen möglichen Kontrollverlust über das flächenmäßig größte Land der Erde. 2006 sah Wladimir Putin in der demografischen Krise das drängendste Problem Russlands. In der Folge erhöhte er die finanzielle Unterstützung von Familien. Für ein zweites Kind gab es fortan ein sogenanntes Mutterschaftskapital von umgerechnet 8.000 Euro. Gleichzeitig begann Russlands Wirtschaft wieder zu wachsen und die Menschen konnten wieder mit mehr Zuversicht nach vorne blicken.
Anschließend stieg die Geburtenziffer auf fast 1,8 Kinder je Frau, fiel bald danach aber wieder ab, auf heute 1,5. Auch Putin musste lernen, dass sich mit Geld allein keine Kinder kaufen lassen, denn wie überall auf der Welt haben Prämien fürs Kinderkriegen meist nur einen Einmaleffekt: Die Menschen ziehen ohnehin geplante Geburten einfach vor und nehmen das Geld mit, weil sie nicht wissen, wie lange das Regierungsversprechen anhält. Unterm Strich bekommen sie aber nicht unbedingt mehr Kinder. Auch wenn Putin am liebsten Mutterkreuze an Russinnen mit großer Kinderschar verleihen würde, wird er den Abwärtstrend nicht aufhalten können. Denn derzeit kommen jene jungen Menschen ins Familiengründungsalter, von denen es wegen des Geburteneinbruchs Anfang des Jahrhunderts nur wenige gibt. Dass diese Menschen jetzt noch in einem Krieg verschlissen werden, gleicht einem demografischen Harakiri.
Auf dem absteigenden Ast
Russlands Bevölkerung wäre längst um mehr als 15 Millionen geschrumpft, hätte die russische Föderation nicht Millionen Menschen aus anderen Ex-Sowjetstaaten angelockt, in denen die wirtschaftliche Lage noch schlechter ist als in Russland. Vor allem auf Russischstämmige hat es Putin abgesehen. Es kommen aber auch Millionen von nichtrussischen Arbeitsmigranten aus dem Südkaukasus, Zentralasien und der Ukraine, die eher gelitten als willkommen sind. Ohne sie würde die russische Wirtschaft aber nicht funktionieren. Heute hat Russland mit 146 Millionen Einwohnern wieder drei Millionen mehr als während des Tiefststandes von 2008 – aber auch nur, weil der Kreml zwei Millionen Krimbewohner auf dem eigenen Konto verbucht, obwohl die Halbinsel völkerrechtlich zur Ukraine gehört. Womöglich plant Putin mit der Eroberung der Ukraine oder anderer Gebiete den Status Russlands als demografischer Scheinriese aufrecht zu erhalten. Die Vereinten Nationen allerdings gehen in ihren Projektionen davon aus, dass sich die Bevölkerung zwischen Kaliningrad und Wladiwostok bis 2050 um zehn Millionen reduziert. Das Riesenland hätte dann weniger Einwohner als Äthiopien, die Demokratische Republik Kongo oder die Philippinen.
Alles in allem ist es angesichts der demografischen Lage Russlands so ziemlich das Dümmste, einen menschenzehrenden Krieg gegen einen Nachbarstaat anzuzetteln. Wie viele Menschen dies- und jenseits der Grenze ihn nicht überleben werden, lässt sich heute nicht beziffern. Aber er wird die wirtschaftliche Lage Russlands mit Sicherheit nicht verbessern. Es steht eher zu befürchten, dass die Russen abermals durch eine schwere Krise gehen müssen, in deren Folge Lebenserwartung und die Geburtenziffern wieder sinken. Die verhängten Sanktionen gegen Russland werden diesen Niedergang beschleunigen, meint eine Studie des Münchner Ifo-Instituts, denn sie lähmen die Wirtschaftskraft und schädigen das Gesundheitssystem. Hans-Werner Sinn, der ehemalige Leiter des Ifo-Instituts, hält als Folge von Putins Kriegstreiberei sogar einen Staatsbankrott für möglich.
Aber bevor jetzt Schadenfreude aufkommt: Das Leid tragen die geschundenen Menschen in der Ukraine und auch diejenigen auf russischer Seite, die in den Krieg ziehen mussten, ohne vorher gefragt zu werden.
17.02.2022
Not bringt Bäume um
Tropenwald- und Artenschutz ist nur mit integrierter Entwicklung möglich
Im vergangenen Jahrzehnt gingen nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 53 Millionen Hektar der tropischen Wälder verloren, eine Fläche so groß wie Neuseeland. Brandgerodet, abgesägt oder durch „ganz normale“ Waldbrände zerstört. Solche Feuer gab es zwar immer schon, aber sie werden durch den menschengemachten Klimawandel immer häufiger.
Immerhin sind die jährlichen Waldverluste nur noch ein Drittel so hoch wie in den 1980er Jahren. Damals, zu den Spitzenzeiten der Waldvernichtung, mussten die Bäume vor allem im brasilianischen Amazonasgebiet neuen Weide- und Agrarflächen weichen. Hätte sich der Kahlschlag in dem Tempo fortgesetzt, wäre vom größten und vielfältigsten Regenwald der Welt heute kaum noch etwas übrig.
Aber nur auf den ersten Blick ist das eine gute Nachricht. Denn das Artensterben, das mit dem gebremsten aber anhaltenden Waldverlust einhergeht, hat sich keinesfalls verlangsamt, sondern beschleunigt. Noch nie in der menschlichen Geschichte haben mehr Tier- und Pflanzenarten das Zeitliche gesegnet als in der jüngsten Vergangenheit. Die genaue Zahl der ausgelöschten Arten ist zwar unbekannt, denn viele von ihnen verschwinden von der evolutionären Bühne, bevor irgendein Taxonom sie hätte katalogisieren können. Es gilt aber als sicher, dass der heutige Artentod 100- bis 1000-mal schneller abläuft als unter natürlichen Bedingungen, also wenn der Mensch nicht seine Finger im Spiel hätte. Die Umwandlung von Wald in Ackerland gilt als größte Bedrohung für die Biodiversität, aber auch Umweltgifte, Überfischung und Bejagung, Klimawandel und invasive Arten tragen massiv zu dem Artensterben bei.
Besonders hoch waren beziehungsweise sind die Waldverluste in armen Weltregionen, in denen die Bevölkerung in der jüngeren Vergangenheit stark gewachsen ist oder immer noch wächst. Die Frage ist, ob es zwischen beiden Phänomenen einen Zusammenhang gibt, dass also ein Mehr an Menschen weniger an Wald bedeutet.
Arme Bauern sind die Feinde des Waldes
Eine Untersuchung des Thünen-Instituts für Waldwirtschaft ist dieser Frage jetzt in zwölf Waldgebieten in Sambia, Ecuador und den Philippinen nachgegangen und konnte zumindest für diese Regionen eindeutig zeigen, dass Bevölkerungswachstum massiv zu Lasten des Waldes geht. Denn der Wald bringt den Menschen vordergründig wenig – man kann ihn nicht essen. Sie zerstören ihn deshalb zugunsten anderer Nutzungsformen, vor allem um darauf Landwirtschaft zu betreiben und um Holzkohle herzustellen. Ähnlich haben es die Europäer im Mittelalter gemacht.
Diese Entwicklung lässt sich mit der sogenannten Forest-Transition-Theorie beschreiben. Sie besagt, dass die Waldbewohner in armen Ländern, in denen meistens auch ein starkes Bevölkerungswachstum herrscht, ihre Einkommenslage in der Regel nur auf Kosten des Waldes verbessern können. Werden sie dadurch ein wenig wohlhabender, geht es den Bäumen noch mehr an den Kragen. Erst wenn die betroffenen Regionen ein noch höheres Wohlstandsniveau erreicht haben, kann der Wald wieder in die Komfortzone wachsen. Dann nämlich wandern viele Landbewohner in die urbanen Zentren ab, weil es dort bessere und mehr Jobs gibt. Und mit steigendem Wohlstand erhöht sich das Umweltbewusstsein. Wirtschaftliche Entwicklung lässt zudem die Geburtenziffern sinken und der Bevölkerungsdruck sinkt. Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die Waldflächen wieder zunehmen, auch wenn sie dann nicht mehr ihre ursprüngliche Artenvielfalt zurückgewinnen können.
Nach diesem Muster breitet sich der Wald in reichen und auch in einigen Schwellenländern wieder aus. Und das, obwohl dort immer mehr Flächen unter Straßen, Häusern, Gewerbe- und Industrieanlagen versiegelt werden. Deutschland bietet ein gutes Beispiel für die u-förmige Entwicklung der Bewaldung über die Jahrhunderte in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand: Zu Zeiten der Römer war die Fläche der heutigen Bundesrepublik weitgehend von Bäumen bestanden. Nach den mittelalterlichen Wüstungen galt das nicht einmal mehr für 20 Prozent des Landes. Heute sind wieder 32 Prozent der Republik bewaldet, obwohl dort wesentlich mehr Menschen leben, Tendenz leicht steigend. Fast in allen Ländern Europas dehnt sich der Wald aus, aber auch in Nordamerika, selbst in China und Indien. Das Gegenteil ist in Südamerika, Zentralafrika, Myanmar und Indonesien der Fall. Dort stehen die am stärksten bedrohten Regenwaldgebiete der Erde.
Lehren für den Naturschutz
Um den Wald dort zu bewahren, wo er besonders gefährdet ist, also in den wenig entwickelten Ländern, nützt es wenig, ihn einfach unter Schutz zu stellen. Denn dieser Status steht dort meist nur auf dem Papier und er lässt sich kaum kontrollieren. Die Not treibt die Bauern, die meist nur Subsistenzlandwirtschaft mit sehr geringen Flächenerträgen betreiben, immer weiter in die Waldgebiete. Kleinbauern mögen aus Sicht mancher westlicher Nichtregierungsorganisationen den nostalgischen Charme von Selbstversorgung und Nachhaltigkeit haben, in Wirklichkeit sind sie große Waldzerstörer. In diesem Punkt unterscheiden sie sich kaum von großen Agrarkonzernen, die auf tropischen Rodungen Soja oder Palmöl anbauen oder sie zu Weideland für die Rinderzucht umfunktionieren.
Nötig wären Entwicklungsprogramme, welche die Subsistenzbauern aus der Falle von Armut und hohen Kinderzahlen befreien können. Die Menschen brauchen Zugang zu Bildung sowie Jobs und Einkommensmöglichkeiten, die nicht davon abhängen, dass immer neue Waldflächen für die Landwirtschaft urbar gemacht werden. Dafür muss der Ackerbau produktiver werden, damit er auf weniger Fläche mehr abwirft. Das sollte mittels einer „nachhaltigen Intensivierung“ geschehen, damit dabei nicht neue Umweltschäden entstehen. Und es sind nachgelagerte Wertschöpfungsketten aufzubauen, in denen landwirtschaftliche Primärprodukte zu markttauglichen Lebensmitteln veredelt werden. Mit derartiger Weiterverarbeitung lässt sich bis zu zehnmal mehr Geld verdienen als mit dem reinen Ackerbau.
Integriert umsetzen
Generell lässt sich Artenschutz am besten betreiben, wenn verschiedene Entwicklungsziele wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung, Trinkwasserversorgung oder Klimaschutz gebündelt verfolgt werden, also mit integrierten Programmen. Weil mittlerweile fast überall auf der Welt Menschen leben, ergibt es wenig Sinn Ökosysteme zu schützen oder zu renaturieren, nur um der Natur einen Gefallen zu tun. Vielmehr geht es darum, den Menschen eine Existenz zu sichern und gleichzeitig den Schaden an der Umwelt zu minimieren, damit der Klimawandel gebremst wird, sich der Wasserhaushalt verbessert und die Tier- und Pflanzenvielfalt eine Chance hat.
Das geht aus einem Policy Brief des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalysen (IIASA) in Laxenburg bei Wien hervor. Die Wissenschaftler haben in verschiedenen Szenarien untersucht, wie sich Biodiversität am effizientesten erhalten lässt. Eine Extremvariante geht dabei davon aus, dass bis Mitte des Jahrhunderts 40 Prozent der globalen Landfläche komplett unter Schutz gestellt sowie fünf Millionen Quadratkilometer degradiertes Land regeneriert würden, letzteres entspräche der Fläche von Indien und Iran zusammengerechnet. Auf den verbliebenen Agrarflächen müsste dann aber eine hochproduktive Landwirtschaft ohne große Rücksicht auf die Umwelt betrieben werden, so wie es vielerorts in der EU, in Nordamerika oder Brasilien üblich ist. Unter diesen Bedingungen könnte das Artensterben zwar nicht gestoppt, aber immerhin gebremst werden. Allerdings zu hohen Kosten für die Menschen. Denn eine so große Fläche unter Schutz zu stellen würde die landwirtschaftlichen Möglichkeiten massiv begrenzen und die Welt in eine Ernährungskrise stürzen. Die knapp zehn Milliarden Menschen, die es bis 2050 geben dürfte, ließen sich so kaum ernähren, vor allem im armen Teil der Welt, wo die Preissteigerungen für Agrargüter einen verheerenden Effekt hätten.
Wesentlich mehr Erfolg verspricht ein Szenario, bei dem 60 Prozent der globalen Landfläche nachhaltig bewirtschaftet, acht bis elf Prozent der Fläche renaturiert und der Rest unter Schutz gestellt werden. Zusätzlich wären flankierende Maßnahmen notwendig: Die Handelsbedingungen müssten verbessert werden. Es müsste verhindert werden, dass ein erheblicher Teil der Lebensmittel auf dem Weg zu den Verbrauchern vergammelt. Und die Menschen müssten ihren Fleischkonsum reduzieren.
Diese Variante einer integrierten Entwicklung könnte eine Ernährungssicherung ohne steigende Lebensmittelpreise garantieren und die Artenvielfalt besser schützen als das extreme Konzept. Der Wasserbedarf wäre geringer, weniger Stickstoffdünger käme zum Einsatz, das Grundwasser würde weniger belastet und die Menschen würden sich gesünder ernähren. Auch für den Klimaschutz wäre dies die bessere Variante: Die Treibhausgasemissionen aus der Land- und Forstwirtschaft würden um 30 Prozent sinken.
In jedem Fall aber bleibt es eine enorme Herausforderung, eine wachsende Menschheit auf einem begrenzten Planeten zu vorsorgen, ohne dass sie dabei ihre Umwelt und damit ihre eigenen Lebensgrundlagen ruiniert.
13.01.2022
Wie viele werden kommen?
Die starke Flüchtlingszuwanderung von 2015/16 scheint Vergangenheit – das ist vermutlich ein Irrtum
Im Jahr 2016 gab die Mehrheit der Deutschen in einer regelmäßigen Befragung der R+V-Versicherung zu Protokoll, dass ihre größten Sorgen der Terrorismus, Spannungen durch den Zuzug von Ausländern und eine Überforderung der Gesellschaft durch Geflüchtete seien. 2018 fürchteten sie sich vor allem vor den Folgen der Politik eines erratisch agierenden US-Präsidenten Donald Trump. Und 2021 stand die Sorge vor Steuererhöhungen und Leistungskürzungen wegen der Corona-Pandemie im Vordergrund. Zugewanderte und Geflüchtete hatten zumindest einen Teil ihres Bedrohungspotenzials verloren.
2021 kamen allerdings weit weniger neue Migranten nach Deutschland als noch während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16, weil viele Grenzen coronabedingt weitgehend geschlossen waren. Aber die Zuwanderung dürfte bald schon wieder zunehmen, denn die Zahl der Menschen, denen es deutlich schlechter geht als jenen in Deutschland und die gute Gründe haben, ihr Land Richtung Europa zu verlassen, ist über die Jahre deutlich gewachsen.
In Zahlen kaum zu fassen
Doch wie sich die künftige Migration konkret entwickeln wird und wie viele Menschen sich aus welchen Überlegungen auch immer auf den Weg bis nach Europa machen werden, lässt sich schwer vorhersagen. Zu vielfältig sind die Gründe, die Menschen dazu bewegen ihre Heimat aufzugeben. Diese wandern aus wirtschaftlicher Not, wegen politischer Verfolgung, weil sie sich anderswo höhere Einkommen versprechen oder um ihren Kindern bessere Bildungschancen zu ermöglichen. Hinzu kommt als neuer Schlüsselfaktor der Klimawandel, der bis 2050 über 200 Millionen Menschen ihre Existenzgrundlage rauben dürfte, wie Mo Hamza, ein Experte für Risikoabschätzung von der schwedischen Lund Universität meint. Zudem würden die Migrationsmotive werden immer komplexer.
Weg wollen die Menschen vor allem aus afrikanischen Ländern. Dort ist der Migrationswunsch weltweit am größten, wie das amerikanische Markt- und Meinungsforschungsinstitut Gallup in ausgedehnten Befragungen herausgefunden hat. Die jüngsten Daten stammen zwar aus dem Jahr 2018, aber schon damals antworteten gut 60 Prozent der Erwachsenen in den Ländern südlich der Sahara auf die Frage „Würden Sie dauerhaft in ein anderes Land ziehen, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten?“ mit „Ja“. Weil die Bevölkerung in diesem Teil der Welt stark wächst und der Klimawandel die Probleme in Landwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei verschärfen dürfte, wird sich der Migrationsdruck in Zukunft mit Sicherheit weiter erhöhen. Am Ende macht sich allerdings nur ein Bruchteil der Personen mit Abwanderungsgedanken tatsächlich auf den Weg, denn zwischen dem Wunsch und einer wirklichen Migration sind zahllose Hürden aufgebaut: Viele haben gar nicht die Mittel oder die notwendigen Netzwerke eine solche Reise zu organisieren und zu finanzieren. Und wenn sie aufbrechen, dann ist das Ziel in der Regel ein afrikanisches Nachbarland und nicht das ferne Europa.
Von umweltbedingter und deshalb unfreiwilliger Migration bedroht sind vor allem Menschen in armen, ländlichen Regionen der wenig entwickelten Länder, die sich kaum an veränderte Klimabedingungen anpassen können. Das Flüchtlingskommissariat der Vereinen Nationen UNHCR schreibt, dass schon heute 90 Prozent der weltweiten Flüchtlinge aus Gebieten stammen, die extrem anfällig für die Folgen des Klimawandels und die daraus resultierenden sozialen und politischen Konflikte sind. Diese Menschen gelten in der Regel als „intern Vertriebene“, sie landen meist in den städtischen Ballungszentren ihrer eigenen Länder.
Krisenzonen Mena und Horn von Afrika
Die für Europa wichtigsten Klimawandel- und Migrationshotspots der nahen Zukunft dürften Nordafrika und der Nahe Osten sein. Die überwiegend arabisch geprägte Mena-Region (Kürzel für: Middle East/North Africa) ist das trockenste und wasserärmste Gebiet der Welt und hat über die nächsten Jahrzehnte mit steigenden Temperaturen und einen Rückgang der Niederschläge zu rechnen. In einigen Ländern wird über die Hälfte des Wassers aus fossilen Quellen gefördert, die sich über Jahrtausende nicht natürlich regenerieren. Die Landwirtschaft in der Mena-Region verbraucht nach Analysen der Weltbank schon heute 85 Prozent des verfügbaren Wassers. Sie produziert dennoch viel zu wenig Nahrungsmittel, weshalb die Region über die Hälfte ihres Getreidebedarfs einführen muss. Die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels bedeuten eine stärkere Verdunstungsrate auf den Agrarflächen sowie Ernteverluste, während die Nachfrage nach Lebensmitteln wegen des Bevölkerungswachstums steigt. Die ohnehin schon gefährlich hohe Arbeitslosigkeit dürfte sich erhöhen, denn 35 Prozent aller Jobs hängen an der Landwirtschaft. Mena wird nach Weltbank-Prognosen die weltweit stärksten wirtschaftlichen Verluste durch den Klimawandel erleiden. Vielen Menschen wird keine andere Wahl bleiben, als abzuwandern.
Eine andere Krisenregion in Sachen Klimawandel und Migration ist das Horn von Afrika mit den Ländern Äthiopien, Eritrea, Dschibuti und Somalia. Dort müssen über 140 Millionen Menschen ernährt werden und weil es kaum künstliche Bewässerung gibt, sind die Bauern und Viehhirten auf verlässliche natürliche Regenfälle angewiesen. 2017 und 2018 aber hatte die Region mit einer ungewöhnlichen Hitzewelle und Dürreperiode zu kämpfen. 2019 sorgten dann übermäßige Regenfälle für Überflutungen und Erdrutsche, vernichteten Ernten, ließen die Ackerböden erodieren und bereiteten den Boden für eine verheerende Heuschreckenvermehrung. Zwölf Millionen Menschen waren vom Hunger bedroht und die ohnehin schon vorherrschenden ethnischen Konflikte verstärkten sich. Die Internationale Organisation für Migration IOM bilanzierte 2020 am Horn von Afrika rund 6,5 Millionen intern Vertriebene und 3,5 Millionen Flüchtlinge, die zum Teil auch aus angrenzenden Ländern wie Sudan und Kenia stammten, wo ähnliche klimatische Anomalien vorherrschten. Natürlich werden auch die beobachteten Wanderungen am Horn von Afrika von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, aber eine Studie von IOM und der amerikanischen Harvard Humanitarian Initiative konnte jüngst einen eindeutigen statistischen Zusammenhang zwischen den klimatischen Extremen und den Migrationsbewegungen nachweisen.
Wo Klimawandel und enormes Bevölkerungswachstum kollidieren
Das nächste potenzielle Herkunftsgebiet für Klimaflüchtlinge liegt direkt unterhalb des Horns von Afrika, in der ostafrikanischen Region rund um den Victoriasee mit den Ländern Kenia, Tansania, Uganda, Burundi und Ruanda. Obwohl das Gebiet über gute Böden verfügt und dort eigentlich ein relativ gemäßigtes Klima vorherrscht, ist es von einer Verschiebung der Niederschlagszonen und von Dürrewellen bedroht. Damit sind Millionen von Kleinbauern in ihrer Existenz gefährdet. Die Küsten haben steigende Meerespegel und heftigere Sturmfluten zu erwarten. Gleichzeitig dürfte sich die Bevölkerung der fünf Länder bis Mitte des Jahrhunderts annähernd verdoppeln. Entsprechend erwartet eine Studie der Weltbank ab 2030 größere Migrationsströme, wenn es bis dahin keine entscheidenden Klimaschutzerfolge und Entwicklungsbemühungen gibt. Bis 2050 sei mit 38,5 Millionen Klimavertriebenen zu rechnen, das wären über zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Am schlimmsten betroffen wären Uganda und Tansania – nicht zufällig jene Länder, in denen die Bevölkerung am stärksten wächst.
Die Menschen würden dann aus trockeneren Zonen in die höher gelegenen und feuchteren Lagen am Victoriasee umsiedeln. Dort herrscht aber schon heute eine hohe Bevölkerungsdichte, etwa im tansanischen Mwanza am Südufer des Sees. Die mittlerweile zweitgrößte Stadt des Landes bietet mittlerweile 1,2 Millionen ein Zuhause, im Jahr 2000 waren es gerade einmal etwas mehr als 300.000. Die Versorgungslage mit den nötigen Infrastrukturen ist desaströs, die Slumgebiete weiten sich immer mehr aus und Armut ist weit verbreitet. Der Victoriasee, dessen Fische eine wichtige Ernährungsgrundlage für die Anwohner bedeuten, steht vor dem ökologischen Kollaps.
Europa ist indirekt betroffen
Die künftigen Klimavertriebenen Afrikas werden es armutsbedingt kaum bis nach Europa schaffen. Doch wenn es durch die Binnenmigration zu einem zusätzlichen Druck auf die ohnehin stark wachsenden Städte des Kontinents kommt, ist in den dortigen Armutsvierteln mit Verteilungskonflikten, politischen Unruhen bis hin zu bewaffneten Konflikten und insgesamt mit wankenden Regierungen zu rechnen. Umweltschäden verstärken somit andere Migrationsursachen und veranlassen jene Stadtbewohner, die es sich erlauben können, eine Auswanderung zu organisieren.
Nach diesem Muster dürften sich etwa der Bürgerkrieg und die millionenfache Flucht aus Syrien entwickelt haben: Die Levante hatte von 2006 bis 2011 eine ungewöhnliche Dürreperiode erlebt, die zu deutlichen Ernteeinbußen und einer inflationären Steigerung der Nahrungsmittelpreise führte. 1,5 Millionen Landbewohner verloren allein in Syrien ihre Existenzgrundlage und taten das, was auch Klimavertriebene in Afrika tun werden: Sie zogen in die Städte. In den syrischen Städten hatten aber bereits 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Irak Zuflucht gesucht. Die Konfliktursachen in den Zentren überlagerten sich, 2011 kam es zu Demonstrationen gegen die Lebensmittelpreise und gegen die Regierung. Das Assad-Regime schlug mit aller Härte zurück, es formierte sich Widerstand und bis zum Bürgerkrieg, dem IS-Terror und der massenhaften Flucht war es nur noch ein kurzer Weg.
Pulverfass Sahel
Es braucht wenig Fantasie, um diese Entwicklung nicht auch auf die afrikanische Sahelregion zu projizieren, ein weiteres Gebiet mit hohem Migrationspotenzial, das nicht allzu weit von Europa entfernt liegt. Starkes Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Übernutzung der Böden und der Wasserreserven destabilisieren derzeit praktisch alle Länder der Region. Vielerorts kommt es zu tödlichen Konflikten zwischen sesshaften Bauern und nomadisierenden Landbewohnern, die kein Weideland mehr für ihr Vieh finden. Kriminelle Banden und Terrororganisationen breiten sich aus, denen die Regierungen weitgehend machtlos gegenüberstehen.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR vermeldet für die Sahelzone rund drei Millionen Menschen auf der Flucht vor Gewalt, beziehungsweise vor den zahlreichen Ursachen, die letztlich zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führen. UNHCR sieht keinerlei Hoffnung auf Frieden und Stabilität für die Region. Dies sei der Grund dafür, dass sich wieder mehr Menschen auf die extrem gefährliche Reise durch die Sahara und über das Meer bis nach Europa machen.
Was tun?
Es ist klar, dass sich Klima- und Migrationsprobleme, die sich über Jahrzehnte ohne wirksame Gegenmaßnahmen aufgetürmt haben, nicht handstreichartig lösen lassen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass sie sich noch über viele Jahre verschärfen werden, selbst wenn es endlich zu abgestimmten, internationalen Anstrengungen kommen sollte, beide Herausforderungen zu bekämpfen. Deshalb gehören vor allem folgende Maßnahmen auf die Agenda der Weltgemeinschaft:
- Die reichen und deshalb besonders klimaschädigenden Industrieländer und die aufstrebenden Schwellenländer müssen ihre Treibhausgasemissionen dringend reduzieren und bis spätestens 2050 auf Netto-Null-Emissionen kommen. Nur mit sofortigen, radikalen und zunächst vermutlich unpopulären Maßnahmen lässt sich dieses Ziel erreichen.
- Das müssen die reichen Länder auch tun, um dem armen Teil der Welt dringend notwendige Entwicklungsschritte zu erlauben, die ohne neuen Energie- und Rohstoffverbrauch nebst den unvermeidlichen Emissionen gar nicht möglich sind. Diese Schäden sind vorübergehend zu akzeptieren, denn ohne Entwicklung gibt es kein Ende des Bevölkerungswachstums. Hält es an, werden alle Versuche die armen Länder zu stabilisieren ins Leere laufen.
- Weil sich der Klimawandel auf mittlere Sicht gar nicht stoppen lässt (aber umso mehr akut bekämpft werden muss), brauchen jene Länder, die am stärksten unter den Folgen leiden werden, Unterstützung dabei, möglichst umweltfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen und sich an die Klimaveränderungen anzupassen. Wichtig sind vor allem neue Jobs im Industrie- und Dienstleistungssektor, die nicht durch den Klimawandel gefährdet sind.
- In Ländern mit starkem Bevölkerungswachstum und bereits deutlich spürbaren Umweltveränderungen ist Abwanderung unvermeidlich. Sie sollte deshalb so gesteuert werden, dass dabei für alle Beteiligten ein Nutzen entsteht. Weit entwickelte Länder brauchen aus demografischen Gründen vermehrt Zuwanderung und auch in den betroffenen Regionen können Migranten jenseits ihrer Heimatländer zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Migranten bringen in der Regel neue Ideen mit und haben per se ein entwicklungspolitisches Potenzial, denn sie wollen ihr eigenes Leben aus eigener Kraft verbessern. Migration muss deshalb Teil der Entwicklungsplanung werden.
- Sekundärfolgen des Klimawandels wie Bodenerosion, Waldverluste oder Übernutzung von Wasserreserven sind mit angepassten Landwirtschaftsmethoden zu minimieren. Gute Ideen und funktionierende Pilotprojekte wie die Züchtung von angepasstem Saatgut, Präzisionsackerbau oder Minimalbewässerung sind möglichst rasch in die Breite zu tragen. Die entsprechenden Länder sollten sich dabei des Prinzips des „Leapfroggings“ bedienen. So lautet der Fachbegriff für den Sprung zu technischen und sozialen Errungenschaften, die Menschen das Leben leichter machen, wobei ineffiziente, umweltschädliche und kostspielige Zwischenstufen der Entwicklung möglichst ausgelassen werden.
- Klimaforscher und Agrarexpertinnen müssen Frühwarnsysteme für kleinräumige Umweltveränderungen entwickeln, damit sich die betroffenen Bevölkerungen und Verwaltungen frühzeitig auf entsprechende Veränderungen einstellen und gegebenenfalls anpassen können.
14.12.2021
Demografische Schieflagen
Zu viel, zu wenig, zu alt, zu jung?
Gibt es so etwas wie eine ideale Bevölkerungsgröße, eine idealen Bevölkerungsaufbau? Sind viele junge Menschen ein wirtschaftlicher Segen? Welche Herausforderungen bringt eine schrumpfende Bevölkerung mit sich? Wann stößt Bevölkerungswachstum an seine Grenzen?
Diese Fragen stellen sich immer häufiger, denn heutzutage erleben wir die historisch größten demografischen Ungleichgewichte auf der Welt. Während die Bevölkerung in Westasien und Afrika stark wächst, stehen die weiter entwickelten Länder, insbesondere in Osteuropa und Ostasien, vor einer demografischen Zeitenwende: Nach ein paar Jahrhunderten des Wachstums kündigt sich hier vielerorts eine Stagnation oder gar ein Rückgang der Bevölkerung an. Über 90 Länder verzeichnen inzwischen Geburtenziffern, die mittelfristig auf ein Schrumpfen hinauslaufen. 18 Länder weltweit verlieren schon Einwohner – Tendenz zunehmend.
Sicher ist, dass sowohl ein starkes Wachstum wie auch ein Schrumpfen Probleme mit sich bringen: Von der ersten Variante sind arme Länder betroffen, in denen es schon heute nicht gelingt die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Insbesondere fehlt es an Jobs für die großen Zahlen an nachwachsenden jungen Arbeitsuchenden. Bei anhaltendem Wachstum wird es für die dortigen Regierungen immer schwieriger soziale Unruhen, politische Konflikte und das Vordringen radikaler Gruppen zu vermeiden. Es ist sicher kein Zufall, dass in den Ländern mit dem weltweit höchsten Bevölkerungszuwachs entweder Bürgerkrieg herrscht oder zumindest bewaffnete Auseinandersetzungen und Terror an der Tagesordnung sind: In Asien wachsen Afghanistan, die palästinensischen Autonomiegebiete, Jemen und Irak besonders stark, in Afrika Niger, Somalia, Tschad, Mali und die Demokratische Republik Kongo. All diese Länder erreichen auf dem Index der gescheiterten Staaten die Alarmstufe.
Die demografische Krise jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs
Ganz andere Herausforderungen bringt ein Bevölkerungsrückgang mit sich. Er entsteht, wenn mehr Menschen sterben als geboren werden und/oder wenn mehr Menschen ab- als zuwandern. Ersteres beruht in der Regel auf gesunkenen Kinderzahlen je Frau. Das führt zu einer Alterung der Gesellschaft und verursacht steigende soziale Kosten, weil weniger Nachwuchskräfte in den Arbeitsmarkt hineinwachsen, als ältere in den Ruhestand wechseln. Zweiteres bedeutet einen Verlust an Produktivkräften, weil meistens Menschen im jungen Erwerbsalter und mit überdurchschnittlicher Ausbildung abwandern.
In den meisten mittel-, ost- und südosteuropäischen Ländern sowie im Baltikum, also im ehemaligen Ostblock, wirken beide Kräfte auf die Bevölkerungsentwicklung ein. Die Kinderzahl je Frau, auch Fertilitätsrate genannt, die vor 1990 deutlich über jener in Westeuropa lag, ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs massiv abgesackt. In der Ukraine, der Republik Moldau oder Bosnien-Herzegowina bekommen Frauen im Schnitt nur noch 1,1 bis 1,2 Kinder. Nirgendwo in der Region erreicht die Fertilitätsrate auch nur annähernd dem Wert von 2,1, der für eine stabile Bevölkerung nötig wäre.
Gleichzeitig lässt die wirtschaftliche und politische Lage in diesen Ländern viele Menschen ins nahe Westeuropa abwandern. Die Folge ist eine rasche Alterung der verbliebenen Bevölkerung, ein Schwund, der über die kommenden Jahrzehnte anhalten wird, und eine Verödung vieler ländlichen Gebiete. Die genannten Länder dürften bis 2050 rund ein Fünftel bis ein Viertel ihrer heutigen Einwohner verlieren. Nicht viel besser sieht es in den meisten anderen Ländern der Region aus. Die Frage ist, wie die Regierungen dann die steigenden Renten- und Gesundheitskosten bei sinkenden Steuereinnahmen finanzieren wollen.
Ostasiatische Implosionen
Im Vergleich dazu ist Ostasien eher für seine wirtschaftlichen Erfolge bekannt. Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur und China haben in der Vergangenheit einen historisch einmaligen Aufstieg von wenig entwickelten Ländern zu führenden High-Tech-Nationen erlebt. Sie haben eine „demografische Dividende“ eingefahren, also einen maximalen Nutzen aus ihren letzten geburtenstarken Jahrgängen gezogen. Diese waren es, die gut ausgebildet und mit ausreichend Jobs versorgt das ostasiatische Wirtschaftswunder angekurbelt haben. Weil gleichzeitig die Geburtenziffern rapide sanken, dadurch weniger Kinder und Jugendliche versorgt werden mussten und zunächst nur eine geringe Zahl an alten Menschen auf Unterstützung angewiesen war, konnten die Regierungen hohe Einnahmen bei geringen Sozialkosten erzielen. Sie hatten die Möglichkeit Riesensummen in Bildung und Forschung zu investieren und die Wirtschaft weiter zu fördern.
Doch die geburtenstarken Jahrgänge, die einstigen Motoren des Aufschwungs, sind mittlerweile in die Jahre gekommen und wachsen langsam, aber sicher aus der Erwerbsbevölkerung heraus. Ihnen folgen wegen des wirtschaftswunderbedingten Geburteneinbruchs Kohorten, die deutlich dünner besetzt sind.
Wie schnell aus einer jungen, innovativen Gesellschaft mit hohem Wirtschaftswachstum eine sehr alte, ökonomisch stagnierende werden kann, zeigt zunächst einmal Japan. Bis Anfang der 1990er Jahre galt das Land als Maß aller Dinge in Sachen Fortschritt. Heute ist ein Viertel der Bevölkerung 65 Jahre und älter, das ist Weltrekord. Seit zwei Jahrzehnten wächst die Wirtschaft kaum noch, dafür umso mehr die Verschuldung des Landes. 2011 begann die Bevölkerung zu schrumpfen, zunächst in kleinen Schritten, die jetzt immer größer werden. Heute leben im Reich der aufgehenden Sonne 125 Millionen Menschen, das bedeutet immerhin noch Platz 11 unter den Bevölkerungsriesen der Welt. 2060 werden es nach Schätzungen des nationalen statistischen Büros noch 93 Millionen sein. Das würde nicht einmal mehr für die Top 20 unter den bevölkerungsreichsten Ländern reichen. Dann dürften fast 40 Prozent der Japanerinnen und Japaner der Generation 65+ angehören.
Japan ist aber nur der Vorreiter der demografischen Implosion in Ostasien. In Südkorea, wo der Geburtenrückgang später, aber umso heftiger einsetzte, bekommen die Frauen im Schnitt nur noch 0,9 Kinder, das ist Negativweltrekord. Um 2050 dürfte Südkorea Japan als ältestes Land der Welt abgelöst haben. In Taiwan liegt die Fertilitätsrate bei 1,0, in Singapur bei 1,1, in China bei 1,3, weshalb das Zentralkomitee seine rigorose Ein-Kind-Politik jüngst panisch in eine Drei-Kind-Politik umgewandelt hat, allerdinge ohne merklichen Erfolg. Diese Länder stecken allesamt in einer „Niedrig-Fertilitäts-Falle“, aus der es vermutlich kaum ein Entkommen gibt: Gestiegene Bildungswerte, insbesondere bei Frauen, und eine hohe Frauenerwerbsbeteiligung kollidieren mit anhaltend patriarchalen Denkmustern, die Frauen eher in einer traditionellen Rolle in Sachen Familie sehen. Das führt dazu, dass Frauen sich immer häufiger gar nicht erst auf eine Heirat einlassen. Und weil Kinder ohne Trauschein noch immer ein Tabu sind, kommt immer weniger Nachwuchs zur Welt.
Die Folgen des demografischen Wandels in Ostasien liegen auf der Hand: Die Bevölkerung im Erwerbsalter schrumpft, die Innovationskraft sinkt, weil es erfahrungsgemäß die 20- bis 40-Jährigen sind, die für bahnbrechende Erfindungen sorgen, die Kosten der Altersversorgung steigen und letztlich schrumpft die Gesamtbevölkerung. 2020 kamen in Japan auf 100 Erwerbspersonen (20 bis 64 Jahre) 52 Ruheständler (über 64 Jahre), 2050 werden es Prognosen zufolge 79 sein. In Südkorea steigt der Ruheständleranteil je 100 Personen im Erwerbsalter von 24 auf 79; in China von 19 auf 47.
Der sich abzeichnende Arbeitskräftemangel ließe sich zwar durch Zuwanderung abfedern, aber bisher sind in diesen Staaten die Vorbehalte groß, ausländische Fachkräfte anzuwerben (oder Geflüchtete aufzunehmen), geschweige denn, sie als ganz normale Mitbürger zu akzeptieren und zu integrieren.
Eine Rückkehr zu einem natürlichen Bevölkerungszuwachs, also ein Wachstum allein aufgrund eines Geburtenüberschusses, gilt als ausgeschlossen. Denn historisch ist kein Land bekannt, in dem die Fertilitätsrate nach dem Absinken wieder über den „bestandserhaltenden“ Wert von 2,1 Kindern je Frau gestiegen wäre. Ostasien muss sich also auf einen Rückgang der Bevölkerung einstellen, wie er in Japan längst begonnen hat. Bis Mitte des Jahrhunderts dürfte China rund 150 Millionen Einwohner verlieren, das sind so viele, wie heute insgesamt in Deutschland und Frankreich leben.
Aus ökologischer Sicht wäre das sogar sinnvoll, denn die Menschheit hat längst eine Größe erreicht, die eine Gefahr für ihr eigenes Überleben bedeutet. Genau wie die weit entwickelten Länder in Europa und Amerika tragen die asiatischen Industrieländer überproportional zum Ressourcenverbrauch und zu Schadstoffemissionen aller Art bei. Weniger Hochverbraucher und Hochverschmutzer wären ein Segen für die Umwelt. Aus rein wirtschaftlichen Gründen allerdings wäre ein leichtes Bevölkerungswachstum vorteilhaft, denn es bedeutet eine steigende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. Wie immer ist es schwer, ökonomische und umweltpolitische Erfordernisse unter einen Hut zu bringen.
Was tun?
Eine „ideale“ Bevölkerungsgröße und -zusammensetzung lässt sich somit kaum definieren. Natürlich wäre es für ein Land praktisch, wenn Bevölkerungszahl und Altersstruktur einigermaßen konstant blieben, denn dann lassen sich Infrastrukturen am effizientesten nutzen, was kosten- und rohstoffsparend ist. Steigende Kinderzahlen etwa bedeuten, dass viele Schulen gebaut werden müssen, bei weniger Nachwuchs werden diese obsolet. Bleibt alles, wie es ist, sind kaum Anpassungen nötig.
Aber das passiert so gut wie nie, denn es ist unvermeidlich, dass sich eine Bevölkerungszusammensetzung im Rahmen der sozioökonomischen Entwicklung verändert: Weltweit sind über die vergangenen Jahrzehnte die Geburtenziffern gesunken, was vor allem mit wachsendem Wohlstand und steigenden Bildungswerten zu tun hat. Aus den gleichen Gründen ist allerorts die Lebenserwartung gestiegen. Alternde und schrumpfende Gesellschaften sind demnach die logische Folge einer grundsätzlich erfreulichen Entwicklung.
Rechtzeitig anpassen: Deutschland in der Pionierrolle
Es kommt in Zukunft also darauf an sich möglichst gut an diese zwangsläufigen Veränderungen anzupassen. Länder, die den demografischen Wandel früh erleben, haben hier eine besondere Aufgabe: Sie können (und sollten) als Pioniere jene gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Modelle entwickeln, mit dem Wandel klarzukommen. Diese Modelle werden über kurz oder lang überall gebraucht und wer rechtzeitig über sie verfügt, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Deutschland wäre prädestiniert für diese Vorreiterrolle, denn dort ist die Fertilitätsrate früher als anderswo, genau gesagt seit 1972, unter den bestandserhaltenden Wert von 2,1 Kindern je Frau gefallen. Die DDR und die alte BRD zusammengerechnet verzeichnen seit einem halben Jahrhundert in jedem einzelnen Jahr mehr Sterbefälle als Geburten, also eine negative natürliche Bevölkerungsentwicklung. Dass die Einwohnerzahl zwischen Rügen und dem Bodensee seither dennoch um 4,5 Millionen gestiegen ist, liegt einzig an der Zuwanderung.
Damit hat Deutschland zumindest in dieser Hinsicht besser vorgesorgt als Japan, als Land mit der weltweit ältesten Bevölkerung ein weiterer Pionier, das allerdings nicht als zuwanderungsfreundlich gilt, sondern eher als xenophob. Aber ansonsten wird Deutschland seiner demografischen Vorreiterrolle kaum gerecht. Die Tatsache, dass die kopfstärkste Zehnjahreskohorte in der Bevölkerungspyramide zwischen 50 und 60 Jahre alt ist und geradewegs auf den Ruhestand zusteuert, dass der 1964 geborene Spitzenjahrgang der Babyboomer 2031 in Rente geht und dass bald schon weniger Einzahler in die Sozialsysteme einer wachsenden Zahl von Empfängern gegenüberstehen, wie die Rentenkommission der Bundesregierung akribisch vorrechnet, wird in der Politik weitgehend ignoriert.
Zwar hat sich die Bundesregierung schon 2012 eine Demografie-Strategie mit dem Namen „Jedes Alter zählt“ verpasst, aber seither keine wirklichen Antworten auf den Wandel gegeben. Denn dazu wäre es notwendig gewesen, frühzeitig Renten- und Gesundheitssysteme an die rasant steigenden Kosten einer alternden Gesellschaft anzupassen. Auch die neue, ampelfarbige Bundesregierung schenkt dem demografischen Wandel in ihrem Regierungsprogramm wenig Aufmerksamkeit. Sie verweigert sich einer eigentlich notwendigen weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters, was angesichts einer steigenden Lebenserwartung zu einer zusätzlichen Belastung für die jüngeren Generationen führen muss. Immerhin beziehen die Deutschen mittlerweile im Schnitt 20 Jahre Rente, über 5 Jahre mehr als noch 1995. Stattdessen diskutiert die Politik eher eine Senkung des Rentenalters für bestimmte Gruppen und verspricht „sichere“ oder „gerechtere“, auf jeden Fall steigende Renten, was nur bedeuten kann, die wichtige Wählergruppe der Älteren zu schonen und die Jungen zu schröpfen. Auch der geplante noch tiefere Griff in die Steuerkasse, um die Altersbezüge finanzieren zu können, belastet in erster Line jene, die im Berufsleben stehen.
Eine weitere Anpassungsstrategie wäre, massiv in Bildung zu investieren, damit die kleiner werdenden Nachwuchsjahrgänge helfen können die Volkswirtschaft fitter zu machen. Gute Bildung übersetzt sich automatisch in höhere Produktivität und höhere Einkommen, wovon der Staat über höhere Steuereinnahmen profitiert. Die wichtigste Ressource eines rohstoffarmen Landes wie Deutschland ist der Bildungsstand der jungen Menschen. Nur sie können helfen, die Folgen des demografischen Wandels abzufedern, aber dafür braucht es mehr Frühförderung für alle Kinder, eine bessere Einbeziehung der Eltern in die Bildungskarriere des Nachwuchses, bessere Schulen, ein fordernderes und fördernderes Lehrpersonal, besser ausgestattete Hochschulen und so weiter. Bildungspolitik in Deutschland ist eine Dauerbaustelle.
Immerhin hat die vergangene große Koalition mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz einen Schritt getan, um reguläre Einwanderungswege zu erleichtern. Die neue Regel vereinfacht und erweitert die zuvor schon existierenden Möglichkeiten der Erwerbszuwanderung. Es ermöglicht Menschen aus Drittstaaten, in Deutschland zu arbeiten, so sie einen Arbeitsvertrag vorweisen können und ihre Qualifikation anerkannt ist. Akademiker und Personen mit anerkannter Berufsausbildung sowie Schulabsolventen können sechs Monate ins Land kommen, um sich einen Arbeits- respektive Ausbildungsplatz zu suchen. Trotzdem muss sich Deutschland aktiver als bisher um die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften kümmern, vor allem aus Drittstaaten. Das Potenzial für Zuwanderung aus EU-Ländern ist begrenzt und auf mittlere Sicht fehlt es dort ebenfalls an Erwerbsfähigen. Zusätzlich gilt es die Bildungs- und Arbeitsintegration von Geflüchteten zu verbessern und diese im Erfolgsfall möglichst schnell mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung zu belohnen.
Deutschland sollte seine Rolle als Pionier im demografischen Wandel deutlich ernster nehmen und eine Blaupause für ein Wohlergehen alternder und irgendwann schrumpfender Gesellschaften erarbeiten. Sonst machen es andere. Altern und Schrumpfen ist auf mittlere Sicht das Modell für die ganze Welt. Ob es uns gefällt oder nicht.
29.11.2021
Ist das nur neu oder schon normal?
Warum sich die reichen Demokratien auf ein Ende des Wachstums vorbereiten müssen
Seit Generationen ist Wirtschaftswachstum etwas Normales, vor allem für die Menschen in den weit entwickelten Ländern. Beginnend mit der industriellen Revolution, beschleunigt durch epochale Erfindungen wie die Elektrizität, den Verbrennungsmotor oder den Transistor und unterstützt durch neue politische und wirtschaftliche Freiheiten von Demokratien hat sich das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in den letzten 200 Jahren weltweit etwa verdreißigfacht. Die Menschen sind im Schnitt also ungefähr 30-mal reicher geworden.
Daran kann man sich gewöhnen. Kein Wunder, dass sich die meisten Menschen weiteres Wirtschaftswachstum wünschen. Für Ökonomen ist es quasi eine Naturkonstante. Und die Politik ist auf Wachstum angewiesen. Sie braucht es derzeit ganz besonders, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen, um die Alterung der Gesellschaften zu finanzieren, um die Energiewende zu stemmen und um die Staatsschulden nicht ins Astronomische wachsen zu lassen. Unternehmen benötigen Wachstum für Investitionen und um Arbeitsplätze zu sichern. Die Volkswirtschaften der Welt stecken in einer massiven Abhängigkeit vom Wachstum.
Wachstum über alles
Wirtschaftswachstum bedeutet nichts anderes, als eine steigende Zahl von Gütern und Dienstleistungen in Umlauf zu bringen. Damit wird aber auch der ökologische Fußabdruck des um sich greifenden Wohlstands immer größer, denn Kühlschränke und Elektroautos, Arbeiten wie Amazon-Pakete ausfahren und Coronapatienten betreuen lassen sich nicht ohne Energieaufwand und Rohstoffeinsatz darstellen. Zusätzlich fallen am Ende von Produktion und Leistung immer Abfallstoffe an. Genau deshalb erleben wir den Klimawandel, das Artensterben, die Vermüllung der Ozeane und so weiter.
Das Wachstum zu reduzieren wäre somit aus ökologischen Gründen eine naheliegende Idee. Aber die oben beschriebene Abhängigkeit verbietet es diesen Weg politisch zu gehen. Keine Partei würde sich hinstellen und sagen: „Leute, jetzt aber bitte mal halblang mit dem Konsum, damit wir den Klimawandel bremsen können.“ Keine Regierung wird sich eine De-Growth-Strategie ins Programm schreiben. Im Gegenteil tut die Politik alles, um das Wachstum anzukurbeln. Sie erfindet Wachstumsbeschleunigungsgesetze, legt Konjunkturprogramme auf, senkt Steuern, um den Konsum anzukurbeln oder hält die Zinsen niedrig, in der Hoffnung, dass die Unternehmen mehr investieren.
Gehen die goldenen Zeiten des „immer mehr“ zu Ende?
Gut möglich, dass sich die Politik dabei auf einen Kampf gegen Windmühlenflügel eingelassen hat. Denn Wirtschaftswachstum ist keineswegs eine Konstante in der menschlichen Geschichte. Die 200-jährige Erfolgsstory seit der industriellen Revolution scheint vielmehr ein historischer Ausreißer zu sein. Und gerade in den erfolgreichen, demokratisch geführten Nationen, die am meisten von dem steigenden Wohlstand profitiert haben, klingt das Wachstum unabhängig von kurzfristigen Konjunkturzyklen langsam aus. In Deutschland etwa erreichte es in den 1950ern noch acht Prozent, heute liegt es im Mittel der letzten zehn Jahre noch bei gut einem Prozent. Ähnliche Rückgänge verzeichnen alle weit entwickelten Länder und die Schwellenländer folgen zeitversetzt dem gleichen Trend.
Für die Abwärtsentwicklung gibt es verschiedene strukturelle Gründe, gegen die sich mit den gängigen, Konjunktur fördernden Konzepten wie staatlichen Investitionsprogrammen oder Zinssenkungen gar nichts ausrichten lässt. Erstens klingt das Bevölkerungswachstum, das lange ein Haupttreiber für das Wirtschaftswachstum war, in den reichen Ländern aus und die Gesellschaften altern. Zweitens erhöhen sich, trotz Digitalisierung und Robotisierung, die Innovationskraft und die Produktivität immer langsamer, weil heutigen Erfindungen weniger Durchschlagskraft innewohnt als einst der Dampfmaschine oder dem Automobil. Man sehe das Computerzeitalter überall, nur nicht in der Produktivitätsstatistik, hat der Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Solow einmal angemerkt. Drittens nimmt in vielen Gesellschaften die Ungleichheit zu und begrenzt die Konsummöglichkeiten der unteren Einkommensschichten. Und viertens wirken sich ökologische Schäden zunehmend bremsend auf die wirtschaftliche Entwicklung aus, wobei man die Corona-Pandemie gut und gerne als Folge von Umweltfrevel hinzurechnen kann.
Der US-Ökonom Lawrence Summers, ehemaliger Chefökonom der Weltbank, bezeichnet die Schwächephase als „säkulare Stagnation“, als eine Wachstumsanämie, die über sehr lange Zeit andauert. Andere Wissenschaftler sprechen von dem „New Normal“, von einer neuen Normalität für die weit entwickelten Volkswirtschaften, von einem Ende des Wachstums nicht etwa aus ökologischen Überlegungen, sondern durch die Hintertür eines strukturellen Wandels.
Schon 2017 hat das Berlin-Institut für Bevölkerung eine längere Studie („Was tun, wenn das Wachstum schwindet?“) veröffentlicht, die sich mit den Hintergründen der Wachstumsverlangsamung beschäftigt hat, mit den Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft und mit dem Unwillen der Politik, sich auch nur theoretisch mit diesen Fragen zu beschäftigen. Damals waren die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 gerade überstanden und die Welt befand sich in einem wirtschaftlichen Zwischenhoch. Entsprechend gering war das öffentliche Interesse sich mit den Ursachen für stagnierende Volkswirtschaften auseinanderzusetzen. Die Studie hatte nicht die erhoffte Resonanz.
Mittlerweile hat die Weltgemeinschaft pandemiebedingt die nächste große Krise erlebt, mit einem Wachstumseinbruch, der den von 2008 noch übersteigt. Beide Ereignisse zeigen, dass es bei der Beurteilung von langfristigen Wachstumstrends nicht auf die Ausreißer nach unten oder oben ankommt, sondern immer auf die langjährigen Durchschnittswerte. Und die weisen kontinuierlich nach unten.
Interessanterweise ist gerade jetzt im englischen Fachblatt Nature Human Behaviour ein Beitrag eines interdisziplinären Forscherteams um den Umweltökonomen Matthew G. Burgess von der Universität von Colorado in Boulder erschienen („Prepare developed democracies for long-run economic slowdowns“), die sich exakt mit den gleichen Fragen beschäftigt wie die Studie des Berlin-Instituts viereinhalb Jahre zuvor und auch zu den gleichen Ergebnissen kommt. Beide Publikationen mahnen an, dass die Wissenschaft dringend der Frage nachgehen sollte, ob und wie entwickelte Gesellschaften für ein Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger sorgen können, wenn das Wachstum weiter zurückgeht oder ganz versiegt.
Bisher ist dieses Wohlergehen keinesfalls gesichert, denn unter heutigen Rahmenbedingungen würde ein Ende des Wachstums sinkende Gewinnaussichten für die Unternehmen bedeuten, geringere Investitionen, erlahmenden technischen Fortschritt und wachsende Arbeitslosenzahlen, vor allem unter jungen Menschen. Das Vertrauen der Menschen in das gebetsmühlenhafte Versprechen von stetig wachsendem Wohlstand würde kollabieren, die Politikverdrossenheit zunehmen. Denn eine stagnierende Wirtschaft, heißt es in dem Papier von Burgess und Co., erzeuge mehr ökonomische Verlierer, erhöhe Konkurrenz und Ungleichheit in der Gesellschaft und gefährde den Zusammenhalt. Gleichzeitig beschneide es die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates, der weniger in den sozialen Ausgleich und die Bildung investieren könne. Politische Krisen dieser Art würden den Aufstieg populistischer Kräfte wahrscheinlicher machen.
Wirtschaftswachstum sei „ein unabdingbarer Wegbereiter für Toleranz und Offenheit in der Gesellschaft“, hatte schon 2005 der Harvard-Ökonom Benjamin M. Friedman geschrieben. Bei dem Verlust eines „robusten Wachstums“ sah Friedman die soziale Sicherheit gefährdet und den Zerfall hochentwickelter Gesellschaften wie den USA, Deutschland oder Frankreich voraus. Die Tatsache, dass in diesen Ländern gerade die vom Strukturwandel und Arbeitslosigkeit gebeutelten Regionen zu Hochburgen populistisch-radikaler Parteien geworden sind, scheint Friedmans These zu stützen.
Eine zentrale Frage angesichts einer möglichen säkularen Stagnation ist deshalb, ob Demokratien, die einst ein Garant für Wachstum waren, die Kraft haben weiter zu existieren, wenn es endet. „Generell haben Demokratien Zugewinne in politischer, ökonomischer und intellektueller Freiheit gebracht“, schreibt das amerikanische Forscherteam. „Diese Freiheiten, gekoppelt mit einer Rechtsstaatlichkeit waren die wesentlichen Treiber des Wachstums“. Wirtschaftswachstum war demokratiefördernd, weil es unter diesen Bedingungen leichter war, den Wohlstand in der Breite der Gesellschaft zu verteilen. Diese ökonomische Teilhabe wiederum war wachstumsfördernd, weil sie den Massenkonsum von immer mehr Menschen möglich machte. Letztlich war es ein gegenseitiges Hochschaukeln von bürgerlichen Freiheiten und Wachstum, das zum Erfolg von Demokratien beigetragen hat. Unter anderem deshalb gab es in der Zeit vor der industriellen Revolution kaum Demokratien, nach zwei Jahrhunderten Wachstum und Wohlstandmehrung aber leben 55 Prozent aller Menschen in dieser Staatsform.
Was aber können Demokratien tun, wenn ihnen eine wesentliche Grundlage ihrer Entstehung abhandenkommt? Dazu gebe es schlicht und einfach keine empirische Erkenntnis, erklärt Burgess, der einräumt, dass er mit seiner Publikation auch kein Patentrezept für ein Wohlergehen der Gesellschaften ohne Wachstum parat hat: „Das Hauptziel unseres Papiers ist es, wenigstens mal eine Diskussion zu dem Thema zu starten.“
22.11.2021
Dem Osten gehen die Menschen aus
Was bringt Wirtschaftsförderung, wenn die Arbeitskräfte fehlen?
Die Bertelsmann-Stiftung, das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) schlagen Alarm: Es mangelt allerorts und in einer wachsenden Zahl von Branchen an Arbeitskräften, vor allem an Personen mit spezieller Ausbildung, von Pflegekräften über Handwerker bis hin zu IT-Experten und LKW-Fahrern. Händeringend suchen Betriebe nach Auszubildenden. Das bedeute das „Konjunkturrisiko Nummer eins“, schreibt das IW. Denn wo Arbeit vorhanden ist, aber niemand, der sie erledigen kann, geht potenzielle Wirtschaftskraft verloren.
Hinter der Krise steckt weniger eine boomende Ökonomie als vielmehr der demografische Wandel. Insofern kommt der Fachkräftemangel nicht überraschend, denn dass die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer, die lange Zeit für eine gute Wirtschaftsleistung und hohe Einnahmen der Steuer- und Sozialkassen standen, sich jetzt Zug um Zug in den Ruhestand verabschieden, ist alles andere als neu. Im Grunde ist seit dem Geburteneinbruch in den 1970er Jahren, dem sogenannten Pillenknick, klar, dass Deutschland auf eine massive Alterung der Belegschaften wie auch der gesamten Bevölkerung zusteuert. Den Babyboomern folgen deutlich dünner besetzte Nachwuchsjahrgänge, weshalb es mittlerweile weniger potenzielle Arbeitskräfte gibt, als die Unternehmen oder die Verwaltung nachfragen. Dieser Mangel wird sich weiter verschärfen, denn die 55- bis 65-Jährigen, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf dem Weg in die Rente oder Pension sind, stellen derzeit die kopfstärkste Gruppe im Bevölkerungsaufbau Deutschlands.
Ganz schön alte „neue“ Bundesländer
Das gilt nicht nur für die „alten“, westlichen Bundesländer, wo 82 Prozent aller bundesweit Beschäftigten arbeiten, sondern noch viel stärker für die „neuen“, demografisch aber deutlich älteren östlichen. Denn letztere hatten wendebedingt einen demografischen Doppelschock zu verdauen: Aus der ehemaligen DDR waren, beginnend direkt nach dem Mauerfall, rund 1,8 Millionen überwiegend junge, gut qualifizierte Menschen gen Westen abgewandert, darunter deutlich mehr Frauen als Männer. Die Arbeitslosigkeit im Osten und bessere Einkommens- oder Ausbildungsmöglichkeiten im Westen waren die Triebkräfte dieser Völkerwanderung. Darüber hinaus waren die Geburtenziffern zwischen Rügen und dem Erzgebirge in den 1990er Jahren drastisch eingebrochen, so dass für eine Weile gegenüber der Vorwendezeit nur noch halbierte Jahrgänge zur Welt kamen. Zeitversetzt zu dem Geburtenrückgang kam es entsprechend zu einem Rückgang der Schulabsolventen, später zu einer Halbierung bei den Auszubildenden und Studierenden. Und heute mangelt es an jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen und ihrerseits Kinder bekommen. Demografische Ausschläge haben stets ihre Echoeffekte.
Erst 2013 kam die Abwanderung Ost zu Erliegen. Seither ist der Wanderungssaldo einigermaßen ausgeglichen, das heißt, es ziehen im Schnitt etwa genauso viele Menschen von Ost nach West wie umgekehrt. Auch die Geburtenziffern haben sich von ihrem Nachwende-Tief wieder erholt und liegen heute sogar leicht über dem Westniveau. Doch diese „Normalisierung“ bedeutet nicht, dass der demografische Wandel im Osten bewältigt wäre, wie manche Politiker oder Unternehmer suggerieren. Denn die einst gerissenen Lücken in der demografischen Zusammensetzung sorgen mittlerweile für einen demografischen Wandel 2.0.
Obwohl die Bevölkerung der DDR zum Zeitpunkt der Wende jünger war als jene im Westen, ist sie aufgrund der demografischen Verwerfungen in den Nachwendejahren inzwischen deutlich älter. Entsprechend stärker ausgeprägt ist die laufende Verrentungswelle. Die Folge: Immer mehr Arbeitgeber finden für ihre verrenteten Mitarbeiter keinen Ersatz mehr. Der Anteil an offenen Stellen ist im Osten höher als im Westen. Die Arbeitslosigkeit allerdings auch, was daran liegt, dass die Qualifikation der Arbeitsuchenden nicht immer zu den Ansprüchen der Arbeitgeber passt.
Die Alterung führt auch dazu, dass die Einwohnerzahlen vor allem in den ostdeutschen Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt weiter sinken werden, denn bis 2035 werden dort deutlich mehr Menschen auf ihre letzte Reise gehen, als Neugeborene hinzukommen. Das gilt besonders für Sachsen-Anhalt, das bis 2035 gegenüber 1990 mit rund 40 Prozent weniger Einwohnern zu rechnen hat. In manchen Landkreisen, wie dem brandenburgischen Spree-Neiße-Kreis, dürften im Jahr 2035 auf eine Geburt vier Beerdigungen kommen. Von den Ost-Bundesländern kann nur Berlin nebst seinem angrenzenden Brandenburger Speckgürtel mit steigenden Einwohnerzahlen rechnen.
Die schrumpfende Mitte
Den relativ größten Einbruch wird die demografische Mitte der Gesellschaft erleben, also die Altersgruppe der Menschen im typischen Erwerbsalter zwischen 20 und 64 Jahren. Schlicht und einfach, weil aus dieser Kohorte oben deutlich mehr Personen herauswachsen, als unten hinzukommen. Das gilt für ganz Deutschland – und wiederum besonders für den Osten. Bundesweit können nur wenige attraktive urbane Standorte mit guten Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten damit rechnen durch Zuwanderung aus dem In- und Ausland Mitglieder dieser Altersgruppe hinzuzugewinnen. In entlegenen östlichen Regionen hingegen, die schon heute stark gealtert und geschrumpft sind, wie dem Süden Brandenburgs, dem thüringischen Landkreis Greiz oder dem Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, dürfte die Zahl der Erwerbsfähigen bis 2035 gegenüber heute um rund 30 Prozent sinken. Die Hoffnung, dass diese Gebiete wirtschaftlich aufholen, dürfte reine Fiktion bleiben.
Zwar gibt es überall in diesen Gebieten kleinere und größere Unternehmen, welche die wirtschaftlich schweren Nachwendejahre in Ostdeutschland überlebt haben oder neu entstanden sind und für Beschäftigung sorgen. Doch sie sind jetzt gefährdet, weil sie oft nicht mehr wissen, wo sie überhaupt noch Mitarbeiter herbekommen sollen. Das gilt besonders für jene Regionen, die durch das geplante Ende der Braunkohleförderung vor einem heftigen Strukturwandel stehen, in der Lausitz im Süden Brandenburgs und im Osten des Freistaates Sachsen, aber auch in Sachsen-Anhalt. Rund 180.000 Arbeitsplätze sind seit der Wende in der Kohle- und Kraftwerkswirtschaft und anderen Betrieben allein in der Lausitz verloren gegangen und haben zu einem Teil-Exodus geführt. In dem Lausitz-Städtchen Weißwasser beispielsweise leben heute keine 16.000 Menschen mehr, bis zum Mauerfall waren es noch 40.000.
Die Bundesregierung, die den Kohleausstieg aus Klimaschutzgründen womöglich noch beschleunigen wird, will den wirtschaftlichen Umbruch bis 2038 über das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ mit insgesamt 40 Milliarden Euro an Strukturhilfen abfedern, die Lausitz hofft auf einen Anteil von 17 Milliarden. Die betroffenen Gebiete sollen „eine echte Chance erhalten, nach dem Kohleausstieg besser dazustehen als zuvor“, heißt es vom Bundeswirtschaftsministerium. Mit dem Geld sollen unter anderem Forschungsinstitute an- und Bundeseinrichtungen umgesiedelt oder die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden, in der Hoffnung, dass sich Menschen und Firmen neu in den Braunkohleregionen ansiedeln. Manches tut sich bereits: So baut der Chemiekonzern BASF mit 175 Millionen Euro Fördermitteln in Schwarzheide eine Fabrik für Kathoden, wichtige Bauteile für die Fertigung von Batterien für die Elektromobilität. Die deutsch-kanadische Firma Rock Tech errichtet für eine knappe Milliarde Euro eine Anlage für die Produktion von Lithiumhydroxid, die einmal das Material für rund 500.000 Elektroautobatterien liefern soll.
Dennoch ist die Gefahr ist groß, dass ein erheblicher Teil der Fördermittel ins Leere läuft, denn in der Region fehlt es schon heute an qualifizierten Arbeitskräften. Zudem lässt sich nicht jeder Kohlekumpel aus dem Tagebau und jede Maschinistin aus den Kraftwerken zu Experten für „hybride Leichtbaustrukturen“ oder die „Dekarbonisierung von Industrieprozessen“ umschulen, um nur zwei Anforderungsprofile für die erhofften Ansiedelungen zu nennen. Ob allzu viele Menschen bereit sind für die zu schaffenden Jobs von anderswoher in die peripher gelegenen Kohlereviere zu ziehen, die auch wegen ihrer Wahlergebnisse (knapp 30 Prozent für die AfD) nicht den besten Ruf haben, ist eine weitere Frage. Ebenso, ob ausgerechnet eine Region, in der lange Zeit eine planwirtschaftliche Monostruktur für Arbeit und Auskommen gesorgt hat, das Potenzial für eine kreative Gründerszene hat. Hinzu kommt, dass sich auch im hochattraktiven Großraum Berlin Tech-Unternehmen ansiedeln, die ebenfalls auf Fachkräfte angewiesen sind. Allein die sogenannte Gigafactory von Tesla im brandenburgischen Grünheide dürfte mittelfristig mindestens 12.000 Arbeitskräfte vom Markt saugen.
Jede neu geschaffene Stelle, so sinnvoll sie auf den ersten Blick sein mag, verschärft die Konkurrenz um Bewerber zwischen Unternehmen, Branchen und Regionen. Ein Teil der Jobs ließe sich also nur besetzen, wenn die Arbeitnehmer aus anderen Bereichen abgezogen würden. Mit guter Bezahlung wäre das sicherlich möglich, aber das wiederum würde alteingesessene Betriebe und Unternehmen gefährden. Darunter würden auch die Kommunen in den betroffenen Gebieten leiden, die ihre Fachkräfte tendenziell schlechter bezahlen als die Privatwirtschaft und längst verzweifelt nach gut ausgebildeten Mitarbeitern suchen, vor allem um die dringend notwendige Digitalisierung der Verwaltungen voranzutreiben.
Wie ist den Revieren zu helfen?
Was also wäre zu tun, um die Regionen nicht noch stärker schrumpfen zu lassen, um die 40 Milliarden Strukturhilfen halbwegs effizient auszugeben und um die neuen Arbeitsplätze, die sich alle wünschen, auch besetzen zu können? Zwei Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund:
Erstens bräuchten die bald schon stillgelegten Kohlereviere, die als Innovationszentren auferstehen sollen, Zuwanderung an Fachkräften und Gründern sowie private Investoren. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland erfordert seit vielen Jahren Unterstützung aus dem Ausland, im Westen wie im Osten. Detlef Scheele, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, vermeldet, Deutschland benötige rund 400.000 zugewanderte Arbeitskräfte pro Jahr, um das Erwerbspersonenangebot stabil zu halten. Ostdeutschland liefert aber bis dato kein Modell für die notwendige Aufnahmebereitschaft von Zugewanderten. Zwar hat sich der Anteil von Ausländern unter den Beschäftigten auf mittlerweile über 8 Prozent erhöht, sie arbeiten vorwiegend in den größeren Städten. Im Westen, der auf eine weitaus längere Zuwanderungsgeschichte zurückblicken kann, liegt er aber bei 15 Prozent.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus dem Jahr 2020 macht es mittlerweile einfacher als je zuvor qualifizierte Mitarbeiter aus Drittstaaten zu rekrutieren. Dafür müssten sich Unternehmen und Regionalpolitik aktiv um eine Anwerbung kümmern. Sie müssten sich zudem um eine gesellschaftliche Integration von Zugewanderten bemühen, was in Regionen mit hohem rechtsradikalen Wähleranteil kein Selbstgänger ist. Die Bundesregierung sollte zudem einen „Spurwechsel“ von Geflüchteten ermöglichen, die in Deutschland in Ausbildung oder bereits in Beschäftigung sind, aber keinen anerkannten Schutzstatus haben. Diesen Personen droht ständig eine Abschiebung, obwohl sie bereits wesentliche Schritte einer Integration hinter sich haben. Sie nicht für den Arbeitsmarkt zu nutzen, ist eine Verschwendung von Humanpotenzial.
Zweitens müssen die Regierungsverantwortlichen einer weiteren Verschwendung von Humanpotenzial vorbeugen und die Bildungserfolge der jungen Generation in den vom Strukturwandel gebeutelten Gebieten verbessern. Denn ausgerechnet dort erreichen viele Jugendliche (überwiegend Jungen) nicht mal einen Hauptschulabschluss. Diese Schulabbrecher haben in ihrem späteren Leben wenig Chancen auf einen ertragreichen Job und sie stellen kaum das Arbeitskräftepotenzial, das sich die Bundesregierung mit ihrem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen vorstellt. Im brandenburgischen Braunkohle-Landkreis Oberspreewald-Lausitz blieben 2019 rund 10 Prozent der Schulabgänger ohne Abschluss, im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, einer klassischen Bergbauregion mit weitgehend stillgelegten Betrieben, sogar 13 Prozent.
Wenn es gelänge, zumindest einem Teil dieser jungen Menschen bessere Abschlüsse zu ermöglichen, stellt sich die nächste Frage: Wie lassen sie sich vor Ort halten, damit sie sich dort wirtschaftlich verdient können? Bildung, so notwendig sie für die Jugendlichen wie auch für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Heimatregionen ist, hat nämlich einen Nebeneffekt: Sie erleichtert es aus strukturschwachen Gebieten abzuwandern und anderenorts einen Job zu finden. Genau aus diesem Grund haben periphere Regionen überall in Deutschland in der Vergangenheit junge, qualifizierte Kräfte verloren – im Osten mehr als im Westen.
02.11.2021
China auf dem Zenit
Neue Weltmacht mit fragiler Zukunft
China gibt den Ton an. Zumindest für den Moment. China baut zehnstöckige Hochhäuser in 29 Stunden, produziert weltweit die meisten Elektroautos, betreibt die leistungsfähigsten Supercomputer, ist führend in der Drohnentechnologie und meldet mit Abstand die meisten Patente an, doppelt so viele wie die USA. Nirgendwo wird die Bevölkerung akribischer überwacht und auf staatstragendes Verhalten getrimmt als in dem 1,4-Milliarden-Staat. Keine Volkswirtschaft jagt mehr klimaschädliche Treibhausgase in die Atmosphäre. China ist der Dominator. Kein Wunder, dass der britische Economist schon 2018 das „chinesische Jahrhundert“ ausrief.
Tatsächlich hat das Land, das nach Maos Kulturrevolution einem selbstgezimmerten Armenhaus glich, seit Mitte der 1980er Jahre eine einzigartige Aufholjagd hingelegt und sich binnen weniger Jahrzehnte zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt emporgearbeitet. Es hat 800 Millionen Menschen aus der Armut geholt, bildet die besten Schüler aus und dürfte bis 2023 die USA bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung überholen. Chinesische Studenten sind weltführend in den Disziplinen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen.
Wird China ein zweites Japan?
Doch Vorsicht vor zu viel China-Euphorie: Der derzeitige Entwicklungshype erinnert stark an ein anderes asiatisches Land der späten 1980er Jahre. Japan galt damals als Morgenland, als High-Tech-Schmiede der Zukunft. Die Regierung hatte massiv in das „Technopoliskonzept“ investiert und Technologieparks, Universitäten und Unternehmen zu einer Innovationsmaschine gebündelt. Firmen wie Hitachi, Nikon, Sony oder Panasonic dominierten den Weltmarkt und trieben nicht mehr konkurrenzfähige Unternehmen aus dem Westen reihenweise in den Ruin. Der Rest der Welt war abgehängt.
Dann aber kam die große Ernüchterung. Der japanische Aktienindex Nikkei erreichte 1989 seinen historischen Höchststand, halbierte sich innerhalb kurzer Zeit und konnte nie mehr an die alten Erfolge anknüpfen. An der Börse und auf dem Immobilienmarkt platzten damals die Blasen, die Innovationskraft sank und die Arbeitslosigkeit, lange Zeit ein Fremdwort in Japan, stieg. Seither pumpt die Regierung Abermilliarden in Wachstumsprogramme (ohne großen Erfolg) und treibt den Staatshaushalt im immer rotere Zahlen. Heute ist das einstige Wunderland mit 266 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes verschuldet, das ist Rekord unter den Industrienationen.
Die Gründe für den Absturz Japans waren vielfältig, aber ein gewichtiger war die Demografie. Das Land hatte Anfang der 1970er Jahre seinen Babyboom erlebt, als Japanerinnen im Schnitt über zwei Kinder bekamen. Dann gingen die Kinderzahlen kontinuierlich zurück, so dass zeitversetzt Anfang der 1990er Jahre immer weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt eintraten. Ein solcher Rückgang an Nachwuchskräften ging in vielen Ländern der Welt mit einem Wirtschaftseinbruch einher. Seit 1995 schrumpft in Japan die Gruppe der sogenannten Erwerbsfähigen zwischen 16 und 65 Jahren. Gleichzeitig wächst die Zahl der Rentner und Hochaltrigen, die es sozial und medizinisch zu unterstützen gilt. Bereits heute sind rund 30 Prozent der Japanerinnen oder Japaner über 64 Jahre alt; 87.000 von ihnen sind 100 Jahre und älter. Das sind keine guten Nachrichten für Produktivität und Innovationskraft.
Demografisch hat China eine ähnliche Entwicklung vor sich, nur wird sie deutlich heftiger ausfallen als in Japan. Chinas Babyboom rührt noch aus Maos Zeiten: Mitte der 1960er Jahre bekamen die Frauen im Schnitt 6,3 Kinder. Die damals geborene kopfstarke Generation war der Motor für die von Deng Xiaoping 1978 angezettelte Wirtschaftsliberalisierung. Zu versorgende Kinder und Ältere gab es zu diesem Zeitpunkt wenige und die Regierung konnte sich ganz auf den ökonomischen Aufschwung konzentrieren. Junge Menschen waren im Überfluss vorhanden, Millionen von ihnen fanden Jobs in der Baubranche und der Turbo-Industrialisierung. Ihre Einkommen flossen in den Konsum und zogen weiteres Wirtschaftswachstum nach sich. China konnte eine „demografische Dividende“ einfahren wie kaum ein zweites Land. Die Planwirtschaft feierte ihre historisch größten Erfolge.
Der lange Schatten der Ein-Kind-Politik
Doch wie überall altern die Babyboomer irgendwann, wobei es in China überproportional viele sind. Denn die rigorose Ein-Kind-Politik des Landes sorgte dafür, dass der Boomer-Generation nur noch deutlich dünner besetzte Jahrgänge folgten. Heute sind 1,3 Kinder je Frau die Norm, einer der niedrigsten Werte weltweit, auch wenn die Propaganda längst wieder mehr Nachwuchs einfordert. Und das bedeutet mittlerweile einen Mangel an Arbeitskräften bei steigenden Löhnen. Bis 2040 dürfte den UN-Bevölkerungsprognosen zufolge die Erwerbsbevölkerung um zehn Prozent schrumpfen. Im gleichen Zeitraum wird der Anteil der Ruheständler um 50 Prozent wachsen, mit der Folge explodierender Kosten in den Sozial- und Gesundheitssystemen. Die aber sind bis dato schlecht aufgestellt, so dass all jene, die ihre Alters- und die medizinische Versorgung nicht privat stemmen können, damit rechnen müssen, ihren Lebensabend in beschränkten Verhältnissen zu verbringen. Nach 2040 steht China dann vor einer „Superalterung“, die jene in Japan in den Schatten stellt. Wobei Japan immerhin schon ein reiches Land war, als die Alterung der Gesellschaft einsetzte, während China noch ein deutlich ärmeres Land sein wird, wenn die Alterung zu einer finanziellen und sozialen Belastung wird.
China hat nach 40 Jahren Aufschwung wenig Erfahrung mit Krisen, die grundlegend neue Konzepte und tiefe Einschnitte in liebgewonnene Privilegien und den neuen Wohlstand erfordern. Und die Herausforderungen gehen weit über die Demografie hinaus. Auch in China kostet die Bewältigung der Coronakrise einen Haufen Geld, das anderswo für Zukunftsinvestitionen fehlt. Wie in anderen gereiften Volkswirtschaften sinken auch im Reich der Mitte längst die Produktivitätszuwächse, was künftiges Wirtschaftswachstum erschwert. Wie einst in Japan hat sich eine gewaltige Blase am Immobilienmarkt gebildet, weil die Menschen in China zum Sparen neigen und Wohnungen und Häuser zu Phantasiepreisen kaufen, um ihr Geld zu parken. Davon hat zwar bislang die Bauwirtschaft profitiert, die für 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich ist. Doch eine Krise am Bau, etwa ausgelöst durch die dräuende Insolvenz des mit umgerechnet 300 Milliarden US-Dollar verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande, könnte wie einst die Lehmann-Pleite ein wirtschaftliches Beben auslösen, das weit über China hinausgeht. Ohnehin ist im letzten Jahrzehnt die Verschuldung Chinas massiv gestiegen, vor allem der Unternehmen und privaten Haushalte. Sie liegt bei über 210 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und damit deutlich höher als in den USA oder der Euro-Region.
Die Ausbeutung der Natur und ihre Folgen
Auch die Umweltschäden machen China mehr und mehr zu schaffen und bremsen das Wachstum. So ist die Wirtschaft nach wie vor auf eine Energieversorgung angewiesen, die im krassen Gegensatz zu den offiziellen Klimazielen des Landes stehen. Zwei Drittel der Elektrizität stammen aus Kohlekraftwerken, die für den berüchtigten Smog über weiten Teilen des Landes verantwortlich sind. Nach einer Publikation des britischen Fachblatts The Lancet lässt die dreckige Luft jährlich über eine Million Menschen vor ihrer Zeit versterben. Das Kohlendioxid aus den Kraftwerksschloten macht China zum mit Abstand größten Treibhausgasemittenten der Welt. Und trotzdem reicht der Strom nicht aus. Netzunterbrechungen häufen sich, was wiederum die Wirtschaft lähmt.
Kein Wunder, dass auch China den Klimawandel längst zu spüren bekommt: Das Land erlebt vermehrt Hitzewellen, ebenso schwerste Regenfälle, Starkregen und Schlammlawinen, die allein in der zentralchinesischen Provinz Henan im Sommer 2021 über 300 Tote gefordert haben. Dürren und Überschwemmungen beeinträchtigen die Stromerzeugung der Wasserkraftwerke, wie dem gigantischen Dreischluchten-Damm. Der Anstieg der Meeresspiegel gefährdet besonders die boomenden Städte an der Küste und damit das Herz der Wirtschaft. Das Perlflussdelta mit der Metropole Shanghai, wo fast so viele Menschen zuhause sind wie in ganz Frankreich, gilt als die am stärksten durch Fluten bedrohte urbane Großregion der Welt.
China bekennt sich zwar auch dazu, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen und plant seine Emissionen bis 2060 auf Netto-Null herunterzuschrauben. Doch wie die Ziele anderer Länder auch sind dies nur erklärte Absichten. Nach Analysen der Organisation Climate Action Tracker (CAT) sind Chinas bisherige Klimaschutzbemühungen gerade mal in der Lage, mitzuhelfen, den globalen Temperaturanstieg auf drei Grad zu begrenzen, mit katastrophalen Folgen für das eigene Land. Anders als in den meisten anderen Ländern sind die Emissionen selbst im Coronajahr 2020 weiter gestiegen. Entsprechend erhält die Klimapolitik des Landes von CAT den Stempel „unzureichend“.
Weil die Regierung Chinas den Klimawandel als globales Problem hinstellt, die Auswirkungen im eigenen Land aber herunterspielt, die kommunistische Partei ihre Bevölkerung also bewusst ahnungslos hält, wissen die wenigsten Chinesen weder, welche Folgen ihnen bei der anstehenden Erwärmung drohen, noch, was es für ihren Alltag bedeutet, wenn das Land tatsächliche Klimaschutzmaßnahmen einleiten würde. Bei einer Umfrage aus dem Jahr 2021 des China Youth Climate Action Network jedenfalls gaben fast 60 Prozent der Befragten völliges Unwissen um Klimawandel-Zusammenhänge zu Protokoll.
Wie reformfähig ist die Kommunistische Partei?
Bislang erweckt die chinesische Staatsführung nicht den Eindruck, als sei sie in der Lage, die wahren Probleme zu erkennen, geschweige denn deren Lösungen auf den Weg zu bringen. Die einst so erfolgreiche Planwirtschaft ist mit Phänomenen wie dem Klima- oder dem demografischen Wandel konfrontiert, die sich nichtlinear entwickeln, flexible Antworten erfordern und mit planwirtschaftlichen Methoden nicht zu beherrschen sind. Verkrustete politische Strukturen erschweren zudem den Ausweg aus der multidimensionalen Krise. So mahnt die Weltbank klare staatliche Wirtschaftsregeln an, um die Sicherheit von Investitionen zu garantieren. Die enorm gestiegene Einkommensungleichheit müsse über eine progressive Besteuerung eingedämmt werden, funktionierende Sozialsysteme aufgebaut und die Mittelklasse gestärkt werden, damit der Binnenkonsum als Wachstumstreiber anspringt. Ein weiteres Hindernis ist die grassierende Finanzkriminalität und Korruption. Vor allem in der lokalen Verwaltung halten die Beamten gerne ihre Taschen auf. Auch im Bildungs-, Gesundheits- oder Rechtssystem geht wenig ohne Bestechung. Auf dem Index für wahrgenommene Korruption von Transparency International rangiert China auf Platz 78 von 180 Ländern, nach Ländern wie Südafrika, Rumänien oder Belarus.
Chinas Führung reagiert zunehmend autoritär auf die neuen Herausforderungen. Xi Jinping hat mehr Macht an sich gerissen als alle seine Vorgänger, mit Ausnahme von Mao Zedong. Er fordert mehr Patriotismus und weniger Einfluss der Milliardäre. Politische Rivalen verschwinden aus der Öffentlichkeit, Minderheiten wie Tibeter oder Uiguren werden unterdrückt. Die Bevölkerung Chinas hat sich politische Mitspracherechte lange Zeit vorenthalten lassen, zumindest solange sich die Wirtschaft gut entwickelte und alle vom wachsenden Wohlstand profitierten. Bei den rückläufigen Wachstumsaussichten dürfte sie ihre Unzufriedenheit künftig stärker zum Ausdruck bringen. Noch mehr Druck von oben dürfte die Folge sein. Bis der Dampf im Kessel der kommunistischen Partei so weit gestiegen ist, dass die Führung sich ein außenpolitisches Ablenkungsthema sucht, um die Bevölkerung wieder hinter sich zu vereinen.
Dass die Annexion des unabhängigen Taiwan direkt vor Haustür des „Mutterlandes“ eine realistische Variante einer solchen Politik ist, daraus hat Chinas Führung nie einen Hehl gemacht. Sie betrachtet Taiwan seit eh und je als Teil der großen Nation.
30.08.2021
Afghanistans Bevölkerungsproblem
Unter Taliban und Co. droht ein anhaltender Kreislauf aus Armut und hohen Geburtenziffern
Es gibt viele Gründe für die aktuell desolate Situation der Menschen in Afghanistan: Fremde Mächte, die in der Vergangenheit bar jeder Ortskenntnis versucht haben, das Land nach ihren Vorstellungen zu formen; ein korruptes, vom Westen alimentiertes politisches System, das bis vor wenigen Wochen erfolgreich in die eigene Tasche gewirtschaftet hat; ein Stammesdenken bärtiger Männer, das auf mittelalterlichen Vorstellungen beruht; und nicht zuletzt religiöse Eiferer verschiedenster islamistischer Gruppierungen, die traditionell die Hälfte der Bewohner Afghanistans entrechten wollen und deren wirtschaftliche Expertise im Wesentlichen auf Drogenhandel und Entführungen fußt. Ein weiterer, zentraler Grund für das Entwicklungsdesaster wird allerdings kaum diskutiert: das hohe Bevölkerungswachstum. Es würde es dem Land schon unter geordneten Verhältnissen schwermachen, die sozioökonomischen Verhältnisse zu verbessern.
Afghanistan weist die mit Abstand höchsten Geburtenziffern unter allen asiatischen Staaten auf. 4,3 Kinder bekommt eine Frau im Schnitt, weltweit liegen nur afrikanische Länder über diesem Wert. Das Land am Hindukusch verzeichnet derzeit ein natürliches Bevölkerungswachstum (ohne Migrationseinflüsse) von 2,7 Prozent im Jahr. Unter diesen Bedingungen verdoppelt sich die Bevölkerung binnen 27 Jahren. Afghanistan hat heute 40 Millionen Einwohner, zweimal so viele wie noch 1999. Es wären ein paar Millionen mehr, hätten nicht viele ihr Land aus Not oder aus Furcht um ihr eigenes Leben verlassen. Für 2035 sind 55 Millionen Menschen zu erwarten, 2050 wären es nach Schätzungen des Washingtoner Population Reference Bureau (PRB) über 70 Millionen. Momentan wächst die Bevölkerung jeden Tag um 2.500 Häupter.
Das Land wächst sich um Kopf und Kragen
All diese Menschen brauchen Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsdienste, Schulen und Jobs. Obwohl rund die Hälfte der Menschen in kleinbäuerlichen Betrieben arbeiten, kann sich Afghanistan nicht annähernd mit Nahrungsmitteln versorgen. Rund ein Viertel der Einwohner gilt als unterernährt. Das Land hat seit 2000 zwei Hungersnöte erlebt, die es nur mit massiver Unterstützung des World Food Programme einigermaßen überstehen konnte.
Die afghanische Volkswirtschaft ist seit 2015 im Schnitt nur um 1,6 Prozent gewachsen, also weniger stark als die Zahl der Menschen, mit der Folge, dass die Bevölkerung unterm Strich ärmer geworden ist. Ein Land mit diesem Entwicklungsstand bräuchte mindestens fünf Prozent Wirtschaftswachstum, um auch nur die Arbeitsplätze für die nachwachsenden Generationen zu schaffen. Afghanistan ist gemessen am Pro-Kopf-Einkommen der ärmste aller asiatischen Staaten. Wie schlecht es den Menschen geht, zeigt allein die Lebenserwartung: Sie ist mit durchschnittlich 65 Jahren die niedrigste in Asien.
Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt die landesweite Arbeitslosigkeit auf 30 Prozent, das wäre Weltrekord. Aber diese Zahl sagt wenig aus, weil die meisten Menschen im informellen Sektor beschäftigt sind, also nur Gelegenheitsjobs haben oder im Familienbetrieb aushelfen, mit schlechter Bezahlung und ohne jede soziale Absicherung. Und jedes Jahr drängen 400.000 neue junge Arbeitssuchende auf den Markt. Nötig wären private Unternehmensgründer, die all jene Dinge produzieren, die den Menschen das Leben erleichtern. Die Nachfrage dafür wäre enorm, denn es fehlt fast an allem. Aber die ohnehin kleine Mittelschicht, die so etwas leisten könnte, ist vertrieben oder geflohen.
Warum aber ist das Bevölkerungswachstum so hoch? Es ist die Folge schlechter Entwicklung, von Armut, Bildungsmangel, unzureichender Gesundheitsversorgung und Frauenbenachteiligung. Das sind die Rahmenbedingungen, die überall auf der Welt für hohe Geburtenziffern sorgen. Dass am Hindukusch seit 40 Jahren Krieg herrscht, macht die Sache nicht einfacher.
Die neuen Machthaber haben das Problem nicht erkannt
Im Umkehrschluss lässt sich anhand der Gründe für das hohe Bevölkerungswachstum die mögliche Lösung des Problems beschreiben: Wo immer auf der Welt sich die Gesundheitssysteme verbessert haben, wo Jugendliche (und zwar Mädchen wie Jungen) möglichst lange zur Schule gehen können, wo Frauen mehr Mitsprache in Familie und Gesellschaft erlangen und neue Arbeitsplätze entstehen, sind die Geburtenziffern rasch gesunken und die Pro-Kopf-Einkommen gestiegen.
Wer die neuen Mächte in Afghanistan sind, ist zwar längst nicht klar, aber eines ist sicher: Solange Taliban, IS, al-Qaida oder sonst eine islamistische Gruppe die Politik bestimmen, hat dieses Entwicklungskonzept keine Chance. Es wird sich vielmehr der Kreislauf aus Armut und hohen Kinderzahlen zementieren, denn Frauenrechte und Mädchenbildung stehen nicht gerade oben auf der Agenda der Djihadisten. Auch der Zugang zu sicheren Mitteln der Familienplanung und die Zusammenarbeit mit ausländischen Nicht-Regierungs-Organisationen dürfte den Frauen verwehrt werden.
Deshalb ist die Bevölkerungsprojektion der Vereinten Nationen für Afghanistan mit Vorsicht zu betrachten. Sie nämlich geht davon aus, dass die Geburtenziffern wie in fast allen Entwicklungsländern weiter zurückgehen und zwar bis 2055 auf 2,1 Kinder je Frau. Dies ist der sogenannte Erhaltungswert, ab dem eine Bevölkerung mittelfristig aufhört zu wachsen. Unter diesen Bedingungen würde die Bevölkerung des Landes bis 2050 „nur“ auf 65 Millionen anwachsen und um das Jahr 2085 ihren Maximalwert von 77 Millionen erreichen. Das wären bis Mitte des Jahrhunderts 5 Millionen weniger als in der oben zitierten PRB-Vorausschätzung.
Der vergleichsweise optimistische UN-Ausblick baut auf einer Fortschreibung der jüngeren Vergangenheit. Denn auch in Afghanistan sind die Kinderzahlen je Frau gesunken. Noch bis zur Jahrtausendwende lag die Geburtenziffer stabil bei über 7 Kindern je Frau, der heutige Wert von 4,3 ist also bereits ein Erfolg.
Dazu beigetragen haben mit Sicherheit die 20 Jahre unter der dem Einfluss der Westallianz, als Nicht-Regierungs-Organisationen zahlreiche Entwicklungsprojekte auf die Beine stellen konnten. Diese Phase war für afghanische Verhältnisse politisch vergleichsweise stabil, Schulen und Gesundheitsdienste konnten halbwegs ihren Betrieb aufrechterhalten und die meisten Mädchen sogar in den entlegensten Tälern zur Schule gehen. Und es flossen Abermilliarden Euro an Hilfsgeldern in das Land. Dass es eine „gute“ Zeit für Afghanistan war, belegt die Kindersterblichkeit: War im Jahr 2000 noch für etwa 130 von 1.000 Kindern das Leben vor dem fünften Geburtstag beendet, so liegt dieser Wert mittlerweile bei etwa 60. Das ist eine deutliche Verbesserung, ist aber noch weit entfernt von der Kindersterblichkeit in einem hoch entwickelten Land wie Deutschland, wo nur noch 4 von 1.000 Kindern sterben, bevor sie fünf Jahre alt sind.
Mit dem Abzug der meisten ausländischen Partnerorganisationen und dem weitgehenden Ende der westlichen Entwicklungszusammenarbeit dürften die vorübergehenden Fortschritte zum Erliegen kommen. Die Islamisten an der Macht werden die Programme, etwa zur Familienplanung und zur Mädchenbildung, kaum weiterführen, es fehlen der Wille dazu, das Geld und die entsprechende Expertise. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung weiter stark wachsen wird und die künftigen Entwicklungschancen Afghanistans noch schwieriger werden, als sie es heute schon sind.
24.08.2021
China in Afrika
Entwicklungshelfer oder neue Kolonialmacht?
Die Geschichte der jahrzehntelangen westlichen Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika ist schnell erzählt: Viel Aufwand – wenig Erfolg. Auch der vor wenigen Jahren vom zuständigen deutschen Minister ausgerufene „Marshallplan für Afrika“ oder der „Compact with Africa“ des Finanzministeriums, die Jobs für die zahlreichen jungen Menschen schaffen und deutsche Unternehmen zu Investitionen zwischen Tunesien und Südafrika treiben sollten, haben bestenfalls überschaubare Erfolge zu verzeichnen.
De facto ist Afrika nach wie vor der mit Abstand am wenigsten entwickelte Kontinent der Welt. Die Zahl der krisenhaften und gescheiterten afrikanischen Staaten nimmt zu, die Nahrungsmittelversorgung ist unzureichend und das hohe Bevölkerungswachstum macht die Lösung der vielfältigen Probleme nicht eben leichter. Die Hälfte der Menschen in Afrika muss noch immer ohne Stromanschluss auskommen und gerade mal 31 Prozent der Jugendlichen erreichen einen Sekundarschulabschluss (oft fragwürdiger Qualität), der heutzutage als Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufskarriere in einer globalisierten Welt gilt.
Hat da, angesichts der ernüchternden West-Bilanz, nicht China die besseren Ideen für Entwicklung? Immerhin hat die mittlerweile zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt wie kein zweites Land eigene Erfahrung damit, wie ein rückständiges Land zu einer Aufsteigernation werden kann. Es hat seit 1990 über 700 Millionen Menschen aus der absoluten Armut geholt und liegt in vielen Forschungsbereichen gleichauf mit den USA. Die viel gefeierten Erfolge der Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen gehen vor allem auf die Fortschritte in China zurück. Seit Jahren versucht das Land auch die Entwicklung in Afrika voranzutreiben.
Keiner investiert mehr
China hat dort Investitionen in Höhe von vielen hundert Milliarden US-Dollar geleistet und ist gegenwärtig in zahllosen Infrastrukturprojekten engagiert, vor allem in rohstoffreichen Ländern wie Nigeria, Angola oder Sudan. Die neuen Entwicklungshelfer aus Asien haben Straßen und Häfen geplant, finanziert und gebaut, Stromleitungen, Kraftwerke, Pipelines, Eisenbahnen oder Flughäfen aus dem Boden gestampft, und zwar in einer Geschwindigkeit, die jeden deutsche Planer erblassen ließe. Damit konnten die notorischen Versorgungslücken auf dem afrikanischen Kontinent zumindest teilweise geschlossen werden. Man könne behaupten, dass jedes größere Bauprojekt in Afrika, das höher als drei Stockwerke aufragt, oder jede Straße mit mehr als drei Kilometern Länge von Chinesen gebaut oder geplant ist, meint Daan Roggeveen, der Co-Gründer von More Architecture, einem internationalen Planungsbüro mit Sitz in Amsterdam und Shanghai.
Zu den größten laufenden sino-afrikanischen Projekten zählen der 3.200 Kilometer lange Trans-Maghreb-Highway, der 55 größere nordafrikanische Städte miteinander verbinden soll; das Mambilla-Kraftwerk, das von 2030 an über 3.000 Megawatt Elektrizität aus vier Staudämmen des Dongo-Flusses in Nigeria liefern soll; oder eine Schnellstraße, die das verträumte kenianische Touristenparadies Lamu mit Äthiopien und Südsudan verbinden soll, ergänzt durch einen Tiefseehafen und eine Pipeline, über die einmal südsudanesisches Erdöl in die wartenden Riesentanker fließen wird. Die Beratungsfirma Deloitte schätzt, dass China im Jahr 2020 rund ein Drittel aller afrikanischen Infrastrukturprojekte kontrollierte, in Ostafrika sogar die Hälfte. Afrikanische Regierungen schätzen chinesische Projekte vor allem, weil sie äußerst zügig umgesetzt werden.
Nicht ohne Eigeninteressen unterwegs
Das alles tut China nicht aus reiner Nächstenliebe. Erstens gibt es die Bauprojekte nicht umsonst, sondern in der Regel gegen Kredit. Und zweitens kommen bei den Unternehmungen meist nur chinesische (Staats)-Unternehmen und in der Regel nur chinesische Fachkräfte zum Einsatz. Studien der SOAS Universität in London zufolge sind für die tatsächliche Arbeit auf den Baustellen allerdings überwiegend einheimische Kräfte beschäftigt, vor allem, weil es mittlerweile zu teuer geworden ist, auch gering qualifizierte Mitarbeiter aus China zu rekrutieren.
Daneben verspricht jedes ausländische Engagement in Afrika hohe Gewinne. Denn trotz der weit verbreiteten Armut entsteht in vielen afrikanischen Staaten eine neue konsumfreudige Mittelschicht, die offen für alle Gebrauchs- und auch Luxusgüter ist, von denen ein großer Teil den Aufdruck „Made in China“ trägt. Der Markt ist gewaltig, denn Afrika ist mit so gut wie allen Gütern unterversorgt und Chinas Industrie verzeichnet große Überkapazitäten. Tatsächlich finden sich überall in Afrika Läden, in denen sich die chinesischen Produkte bis zur Decke stapeln, in denen nur chinesisches Personal unterwegs ist und die Kasse manchmal sogar Renminbi-Preise ausspuckt, während die kleinen einheimischen Geschäfte, wo es vielerorts kaum mehr als Kerosin, Dosenkonserven, Zigaretten und Bratfett zu kaufen gibt, nach und nach verschwinden. Kein Wunder, dass China längst der größte Handelspartner des Kontinents ist mit einem jährlichen Exportvolumen von über 200 Milliarden US-Dollar.
Das Vordringen Chinas erinnert viele Beobachter an die Kolonialzeit im 19. und 20. Jahrhundert, als europäische Mächte afrikanische und asiatische Länder ihr Eigen nannten, dort eigene Billigprodukte absetzten und im Gegenzug wertvolle Rohstoffe außer Landes holten. Nur dass China heute nicht einmal militärische Macht ausüben muss, sondern eine Abhängigkeit über Kredite schafft und so massiven Druck auf politische und kulturelle Entwicklungen ausüben kann.
Wie hoch sich die afrikanischen Länder für all die Investitionen gegenüber China verschuldet haben, ist nicht genau bekannt. Der Politikwissenschaftlerin Deborah Bräutigam von der amerikanischen Johns Hopkins Universität zufolge haben sich die Kredite allein zwischen 2000 und 2015 auf knapp 100 Milliarden US-Dollar summiert. Seither sind sie weiter stark gestiegen.
Welche Abhängigkeit sich daraus ergeben kann, hat kürzlich Ching Kwan Lee, Sozialwissenschaftlerin von der Universität von Kalifornien in Los Angelos auf der Konferenz „Asia and Africa in Transition“ in Kopenhagen am Beispiel Sambia berichtet. Seit 2007 hat sie dort den chinesischen Einfluss in der Minen- und Bauwirtschaft erforscht, mit Politikern, Unternehmern, Gewerkschaftlern, einheimischen und chinesischen Bergarbeitern gesprochen und an Verhandlungen von indischen, chinesischen und Schweizer Bergbaumultis mit der sambischen Regierung teilgenommen.
Sambia ist für China interessant, weil dort das größte afrikanische Kupferabbaugebiet liegt und das Land weitere wertvolle Rohstoffe wie Kobalt birgt. Weil das ostafrikanische Land über keinen eigenen Seezugang verfügt, sind gute Verkehrsverbindungen über Schiene und Straße umso wichtiger. Den Bau der Infrastrukturen haben im Wesentlichen chinesische Unternehmen übernommen, mit der Folge, dass sich die Auslandschulden des Landes während Lees Forschungen versiebenfacht haben. Und weil die Firmen schon mal am Werke waren, haben sie gleich noch zwei ultramoderne Fußballgroßstadien dazu gebaut (eines davon im Heimatort des ehemaligen Präsidenten, zum Teil auf Kredit, teilweise auch als milde Gabe aus Fernost). „Stadion-Diplomatie“ nennt sich diese Form der indirekten Einflussnahme Chinas auf afrikanische Länder. In 27 Staaten, von Angola bis Uganda stehen mittlerweile zum Teil mehrere dieser als Sportstätten verkleideten trojanischen Pferde.
Und stetig entstehen in Sambia neue Bauprojekte, wobei der Zuschlag fast immer nach China geht, etwa für das 750-Megawatt Kafue Gorge Lower-Kraftwerk, für den Simon Mwansa Kapwepwe- Flughafen in der Kupfergürtel-Region, der künftig jährlich eine Million Fluggäste abfertigen kann oder für die Erweiterung des Kenneth Kaunda-Flughafens in der Hauptstadt Lusaka. Ob das Land, in dem 58 Prozent aller Menschen unter der Armutsgrenze von umgerechnet 1,9 US-Dollar am Tag leben müssen, und das beim Index für menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen auf Rang 146 von 189 Ländern rangiert, all diese Prestigebetonbauten braucht und ob breite Bevölkerungskreise davon etwa haben, ist eine andere Frage.
Ab in die Schuldenfalle
Sambia-Kennerin Ching Kwan Lee jedenfalls ist der Meinung, dass von den chinesischen Aktivitäten vor allem die sambischen Eliten profitieren, dass chinesische Unternehmer sich sambische Wettbewerber mit unlauteren Methoden vom Halse halten, dass durch die hohen Geldflüsse die Korruption blüht und die Menschenrechtsverletzungen zugenommen haben. Kritiker in der sambischen Regierung, die gegen die massive Verschuldung für fragwürdige Projekte aufbegehren, wie der ehemalige Informations- und Rundfunkminister Chishimba Kambwili, mussten rasch ihren Posten räumen und wurden aus der Regierungspartei ausgeschlossen.
Vor allem können die gewaltigen Kreditsummen in eine fatale Schuldenabhängigkeit führen. China ist bekannt dafür, dass es sich beziehungsweise chinesischen Firmen bei Zahlungsausfall ganze Infrastrukturen übereignet. Zum Beispiel in Sri Lanka, wo China den mit Krediten gebauten Hafen Hambantota kurzerhand einkassierte, beziehungsweise für 99 Jahre unter Zwangspacht stellte. Ähnliche Maßnahmen drohen Pakistan oder Bangladesch, Länder, die ihre eigenen Infrastrukturprojekte kaum selbst stemmen können und sich ebenfalls in die Schuldenabhängigkeit gegenüber China begeben haben. In Afrika haben sich etwa Äthiopien beim Bau der Eisenbahnlinie Addis Abeba-Djibouti oder Kenia bei der Strecke Nairobi-Mombasa verhoben. Beide Projekte wurden deutlich teurer als erwartet, sind überwiegend von China finanziert und trieben die Länder in die Schuldenfalle
Das Gleiche kann Sambia passieren, das 2020 erstmals seine Rückzahlungen an internationale Gläubiger nicht mehr aufbringen konnte. Die Wirtschaft des rohstoffreichen Landes wächst kaum, die Einkommen sinken und die Arbeitslosigkeit steigt. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist so groß, dass bei der Präsidentenwahl im August 2021 überraschenderweise der Oppositionskandidat Hakainde Hichilema gegen den Regierungschef und Chinavertrauten Edgar Lungu einen haushohen Sieg einfuhr. Lungu wird unter anderem für die Misswirtschaft und weit verbreitete Korruption verantwortlich gemacht wird. Wie gut sich der neue Präsident gegen den chinesischen Einfluss durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.
Ist das der neue Kolonialismus?
Ob das übermächtige China sich in Sambia, anderenorts in Afrika oder sonst wo auf der Welt tatsächlich als Neokolonialmacht aufführt, ist unter Wissenschaftlern umstritten, vor allem, weil es, anders als die klassischen Kolonialmächte, ohne militärische Präsenz auskommt. Auch Ching Kwan Lee ist in ihrer Einschätzung gespalten. Einerseits entstehen mit Hilfe Chinas Vorhaben, von denen andere Förderer in der Vergangenheit nur träumen konnten. Andererseits geht China bei seiner Entwicklungs-„hilfe“ ziemlich ruppig vor. Aber unterm Strich passiert wenigstens etwas, sagt die Wissenschaftlerin: „Die Europäer, die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds brauchen Jahre, bis sie die notwendigen Statistikunterlagen für eine Kreditvergabe zusammenhaben, sie wollen bis hin zu Genderfragen im Land alles wissen und bekommen dann am Ende eben einen Haufen gefälschte Daten. China interessiert sich dafür nicht. Alles geht viel schneller. Und China kann erfahrungsgemäß gut mit korrupten afrikanischen Regierungen zusammenarbeiten.“
13.07.2021
Kollision globaler Großprobleme
Wo Bevölkerungswachstum, Wassermangel und Klimawandel aufeinandertreffen, drohen neue Konflikte
Eigentlich ist das eine gute Nachricht: Äthiopien hat mit der einsetzenden Regenzeit im Juli die vor einem Jahr begonnene Flutung des „Grand Ethiopian Renaissance Dam“ fortgesetzt. Die gewaltige Talsperre im Nordwesten des Landes soll das Wasser des Blauen Nils aufstauen und dem immer noch sehr armen Land am Horn von Afrika einmal 6.000 Megawatt regenerativ erzeugte Elektrizität liefern. Das ist vermutlich mehr als Äthiopien selbst verbraucht, so dass auch die Nachbarländer Sudan und Ägypten etwas von dem Strom abbekommen können und dem Lieferanten wichtige Devisen zufließen. Äthiopien hätte mit der Talsperre das größte Kraftwerk Afrikas und wäre mit dieser Art der Stromerzeugung eines der klimafreundlichsten Länder der Erde.
Doch ganz so rosig sind die Zukunftsaussichten der Region nicht. Denn hier kollidieren drei globale Megatrends, die einen Streit um das Wasser geradezu provozieren: Bevölkerungwachstum, Wassermangel und Klimawandel. Nach Nigeria gehören Äthiopien und Ägypten zu den drei menschenreichsten Ländern Afrikas, mit derzeit 117 respektive 102 Millionen Einwohnern, aus denen bis zum Jahr 2050 209 respektive 158 Millionen werden dürften. Zusammen mit dem Sudan kommen Äthiopien und Ägypten bereits heute auf 264 Millionen. Vermutlich werden es Mitte des laufenden Jahrhunderts 448 Millionen sein. Das wären etwa so viele, wie dann in den heutigen 27 Ländern der EU leben werden.
All diese Menschen brauchen Wasser. Für die Stromerzeugung und vor allem für die Landwirtschaft, die erhebliche Produktionssteigerungen liefern muss, um die Ernährung der Menschen zu sichern. Ohne künstliche Bewässerung ist das nicht möglich. Bisher versorgen die Bauern in Ägypten und Sudan ihre Felder fast ausschließlich mit Wasser aus dem Blauen Nil, der im äthiopischen Hochland entspringt – und jetzt aufgestaut wird. Der Weiße Nil, der sich in der sudanesischen Hauptstadt mit seinem blauen Nebenfluss vereint und seine Fracht aus den zentralafrikanischen Bergen Ruandas, Burundis, Kongos und Ugandas bezieht, bringt vergleichsweise wenig Wasser mit.
Ägypten und Sudan sind damit auf das Nass eines Flusses angewiesen, der aus einem Nachbarland stammt, denn auf ihren eigenen Territorien fällt so gut wie kein Niederschlag, der es bis in den Nil, den größten Fluss Afrikas schafft. Beide Länder bestehen größtenteils aus Wüste. Die Landwirtschaft findet praktisch nur auf einem wenige Kilometer breiten Streifen entlang der Flüsse statt. Dort leben auch 95 Prozent der Einwohner, was den bewohnten Gebieten eine Menschendichte beschert, die dreimal so hoch ist wie in den Niederlanden.
Schon 1997 war die Wasserverfügbarkeit in Ägypten unter den Wert von 1.000 Kubikmeter je Person und Jahr gefallen, was international als Grenzwert für Wassermangel gilt. Bis 2030 ist aufgrund des Bevölkerungswachstums zu befürchten, dass für jeden Menschen in Ägypten nur noch 500 Kubikmeter zur Verfügung stehen, das entspräche der Definition eines Wassernotstands. Kein einwohnerstarkes Land der Welt ist so abhängig von Wasser, das aus dem Ausland zuströmt. Und jetzt beginnt mit der Befüllung des fünf Milliarden Dollar teuren Grand Ethiopian Renaissance Dam eine neue Knappheit. Denn es vergehen 5 bis 15 Jahre, bis der Stausee vollständig gefüllt ist und in dieser Zeit dürfte der Blaue Nil bis zu einem Viertel seines Fließvolumens verlieren. Zudem werden auch äthiopische Bauern dem Stausee Wasser entnehmen, um ihre Felder zu bewässern, denn die dortige Bevölkerung erwartet ebenfalls eine deutliche Produktionssteigerung.
Der Klimawandel dürfte den Wassermangel in den drei Ländern weiter verschärfen. Klimasimulationen für die Region lassen vermuten, dass sich die Unterschiede zwischen trockenen und feuchten Jahren erhöhen werden. Die jährliche Durchflussmenge des Nils könnte deshalb im 21. Jahrhundert um 50 Prozent stärker variieren als im Jahrhundert zuvor. Generell dürften sich die Niederschlagsmengen in den drei Ländern eher verringern als erhöhen. Steigende Temperaturen bedeuten zudem höhere Verdunstungsraten auf bewässerten Feldern und die Gefahr einer Bodenversalzung. Ein steigender Meeresspiegel bedroht darüber hinaus das dicht besiedelte und landwirtschaftlich intensiv genutzte Nildelta, das schon heute unter Erosion und Unterspülung sowie einer Versalzung des Grundwassers durch eindringendes Meerwasser leidet.
Sudan und Ägypten haben seit dem Baubeginn des Stausees im Jahr 2011 gegen das Projekt protestiert und nun verärgert auf die wieder gestartete Befüllung des äthiopischen Wasserspeichers reagiert. Alle Versuche, den Konflikt über internationale Verhandlungen zu lösen, sind bislang gescheitert. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat in der Vergangenheit das Nilwasser zu einer Frage von Leben und Tod erklärt und dem Nachbarn im Südwesten wiederholt mit Krieg gedroht. Das allerdings wäre das Letzte, was die krisengeschüttelte und von ethnischen Konflikten geplagte Region noch brauchen könnte. Mehr Wasser jedenfalls kann kein Krieg liefern.
09.07.2021
Schlechte Nachrichten zum Weltbevölkerungstag
Die Zahl der Menschen auf einem begrenzten Planeten wächst und wächst in konstantem Tempo obwohl sich das Wachstum stark verlangsamt hat. Wie kann das sein?
Vor 33 Jahren, am 11. Juli 1987, haben die Vereinten Nationen den Weltbevölkerungstag ausgerufen. An diesem Tag, so die UN-Statistiker, hatte die Menschheit die Fünf-Milliarden-Hürde genommen. Rund 80 Millionen kamen in jenem Jahr hinzu und es grassierte die Sorge, dass anhaltendes Bevölkerungswachstum auf einem begrenzten Planeten irgendwann zu Problemen führen würde.
Die Furcht vor zu vielen Menschen hat sich seither eher verflüchtigt. Denn über viele Jahre haben sich die Lebensbedingungen in den allermeisten Ländern verbessert. Alle Probleme schienen lösbar. Weltweit ist die Kindersterblichkeit zurückgegangen. Die Einschulungsraten für Kinder sind gestiegen. Die globale Nahrungsmittelproduktion hat sich seit 1970 etwa verdreifacht, während sich die Weltbevölkerung seither „nur“ verdoppelt hat. Infektionskrankheiten wie Malaria oder HIV/Aids werden zurückgedrängt. Die Lebenserwartung, der vermutlich beste Querschnittsindikator für das Wohlergehen der Menschen, steigt fast überall. Die Vereinten Nationen vermelden, dass ein Durchschnittsleben inzwischen fast 73 Jahre währt. Im Jahr 1900 war im Mittel noch mit 30 Jahren Schluss mit dem Dasein.
Vor allem hat sich die Zahl der Kinder, die eine Durchschnittserdenbürgerin im Laufe ihres Lebens bekommt, in den vergangenen 50 Jahren halbiert, von knapp fünf auf mittlerweile 2,4. Das liegt bereits nahe an jenem „bestandserhaltenden“ Wert von 2,1 Kindern je Frau, bei dem eine Bevölkerung mittelfristig aufhört zu wachsen. Auch das relative Wachstum der Weltbevölkerung ist mit etwas über einem Prozent nur noch halb so hoch wie 50 Jahre zuvor. Tendenz: weiter sinkend. Auf den ersten Blick deutet somit alles auf ein baldiges Ende des Bevölkerungswachstums hin.
Doch auf den zweiten Blick offenbart sich hier ein arithmetischer Denkfehler. Denn das gegenüber den 1960er Jahren halbierte Wachstum findet mittlerweile auf der Basis der doppelten Anzahl von Menschen statt. Und das bedeutet: Das relative Wachstum nimmt zwar ab, aber das absolute hält sich weiterhin auf dem gleichen, hohen Niveau. Tatsächlich wächst die Zahl der Menschen seit den 1960er Jahren, als die Furcht vor einer Bevölkerungsexplosion grassierte, kontinuierlich um 70 bis 90 Millionen pro Jahr, im Schnitt um über 80 Millionen. 2019 hat sich die Menschheit um 81,3 Millionen Häupter vermehrt, was etwa der Einwohnerzahl Deutschlands entspricht. Oder um 15 Menschen in jenen sechs Sekunden, die nötig sind, um diesen kurzen Satz zu lesen. Im kommenden Jahr überschreitet die Menschheit aller Voraussicht nach die Acht-Milliarden-Schwelle. Bis Mitte des Jahrhunderts rechnen die Vereinten Nationen mit einer Zahl von 9,5 bis 10 Milliarden. Von Entwarnung an der Wachstumsfront kann somit nicht die Rede sein.
Das anhaltende Wachstum bedeutet, dass es mit jedem neuen Jahr über 80 Millionen Menschen zusätzlich zu versorgen gilt – mit Gesundheitsdiensten, Schulen, Nahrungsmitteln, mit einem Dach über dem Kopf und vor allem mit Arbeitsplätzen und einem Einkommen, das es erlaubt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Aber das fällt gerade in jenen Ländern, in denen sich das globale Bevölkerungswachstum konzentriert, in Westasien, den Nahen Osten und vor allem in Afrika südlich der Sahara, immer schwerer. Dort nimmt, entgegen dem langjährigen weltweiten Trend, die Zahl der Hungernden zu, ebenso die Zahl der Kinder, die keine Schule besuchen können. Für das Jahr 2019 schätzte die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) die Zahl der Hungernden auf 690 Millionen, das waren immerhin 8,9 Prozent der Weltbevölkerung. Die Covid-19-Pandemie dürfte diese Zahl noch einmal verdoppelt haben. Weil die vielen jungen Menschen oft keine Zukunftschancen für sich sehen, wächst die Frustration, die sich in sozialen und politischen Unruhen entlädt, bis hin zu Bürgerkriegen, Terror und Vertreibung. Nachhaltig ist dieses Bevölkerungswachstum in den armen Ländern nicht.
Der Klimawandel, die Folge des ebenso wenig nachhaltigen Lebensstils in den reichen Ländern, wird diese Probleme weiter deutlich verschärfen. Die Bauern in den wenig entwickelten Ländern können sich immer weniger darauf verlassen, dass der Regen zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge fällt. Und mit der prognostizierten Erwärmung werden unberechenbare Stürme, Schädlingsinvasionen und andere Naturkatastrophen wahrscheinlicher. All das ist kein Grund zum Feiern am Weltbevölkerungstag.
–
Mehr zum Thema hier: Zu viel für diese Welt – Wege aus der doppelten Überbevölkerung. Edition Körber, 2021.
06.07.2021
Nahrung für eine volle Erde
Die Weltbevölkerung wächst nach wie vor um etwa 80 Millionen pro Jahr. Rund um den Globus erodieren Ackerflächen. Der Klimawandel macht es vielen Landwirten immer schwerer. Wir lassen sich bald schon zehn Milliarden Menschen mit Nahrung versorgen?
Natürlich wäre es möglich, die gesamte Menschheit von nahezu acht Milliarden Menschen angemessen zu ernähren. Dafür müsste man lediglich verhindern, dass ein Viertel der Feldfrüchte auf dem Weg vom Acker zum Teller vergammelt und weggeworfen wird, dass Rinder, Schweine und Hühner nicht ein gutes Drittel der weltweiten Getreideernte und fast die komplette Sojaproduktion fressen, von denen eigentlich auch Menschen leben könnten, dass Nahrungspflanzen in der Biogas- und Biotreibstofferzeugung landen und dass Terror und Konflikte die Arbeit der Bauern behindern. Theoretisch wäre all das möglich. Genauso wie es theoretisch möglich wäre, den Klimawandel bei 1,5 Grad Erwärmung zu stoppen oder die Vermüllung der Ozeane zu begrenzen.
Dummerweise sieht die Praxis anders aus: Noch immer nimmt der Dreck in den Weltmeeren zu, während die Fischbestände schwinden. Die erdnahen Luftschichten dürften sich, allen Lippenbekenntnissen der Klimapolitik zum Trotz, nach Stand der tatsächlichen Maßnahmen im Mittel auf zwei bis drei Grad erhitzen. Und weltweit mussten sich im Jahr 2019 jeden Abend rund 700 Millionen Menschen hungrig zum Schlafen legen. Sie hatten pro Tag weniger als 1.800 Kilokalorien zur Verfügung und galten damit als unterernährt. Covid-19 hat die Krise noch verstärkt. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass heute über 270 Millionen vom Hungertod bedroht sind, doppelt so viele wie vor der Pandemie. Zum Vergleich: Ein Durchschnittsbewohner Deutschlands verzehrt rund 3.500 Kilokalorien am Tag. Dafür gilt über die Hälfte der Bevölkerung als übergewichtig.
Die Reichen der Welt laden sich ihre Teller also deutlich voller als die Armen, mit Nahrung, die irgendwo erzeugt werden muss. Rund die Hälfte der bewohnbaren Erdoberfläche wird dafür landwirtschaftlich genutzt, ein Drittel der Böden ist bereits degradiert, was die Nahrungsproduktion einschränkt.
Hinzu kommt, dass die Zahl der Menschen seit rund 50 Jahren mehr oder weniger konstant um 80 Millionen pro Jahr wächst, was ungefähr der Einwohnerschaft Deutschlands entspricht. 2050 dürfte es annähernd zehn Milliarden Erdenbewohner geben. Der Zuwachs findet fast ausschließlich in den wenig entwickelten Ländern statt, in Westasien und vor allem in Afrika südlich der Sahara, also dort, wo schon heute die meisten Unterernährten leben.
Die doppelte Überbevölkerung
In den betroffenen Ländern, in denen es nicht gelingt, die Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen, nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit Gesundheitsdiensten, Schulen und Jobs, kann man getrost von einer Überbevölkerung sprechen, denn diese Situation ist mittelfristig nicht tragbar. Aber es gibt noch eine andere Form der Überbevölkerung und die ist noch weniger nachhaltig. Sie zeigt sich dort, wo die Zahl der Menschen kaum noch oder gar nicht mehr wächst – in den wohlhabenden, weit entwickelten Ländern wie Deutschland. Dort verbrauchen die Menschen deutlich mehr Rohstoffe, als die Umwelt im gleichen Zeitraum nachliefern kann und sie hinterlassen mehr Müll in jeder Form, als die natürlichen Kreisläufe schadlos aufnehmen können. Das Kohlendioxid aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe ist das prominenteste, aber längst nicht einzige Beispiel dafür. Kohle, Öl und Erdgas sind das Fundament unseres heutigen Wohlstands. Sie befeuern aber den Klimawandel. Der wiederum wirkt sich dort am schlimmsten aus, wo die Bevölkerungen stark wachsen und die Menschen zu wenig zu essen haben.
Wie sollen unter diesen Bedingungen in gerade mal 29 Jahren zehn Milliarden Menschen ernährt werden? Zunächst gilt es zu verhindern, dass es tatsächlich zehn und längerfristig noch mehr Milliarden werden. Wie sich das Bevölkerungswachstum auf menschenfreundliche Weise eindämmen lässt, ist hinlänglich bekannt: Überall, wo sich die Gesundheitsversorgung verbessert hat und die Kindersterblichkeit gesunken ist, realisieren die Menschen, dass es besser ist die Familiengröße zu begrenzen. Wo sich Bildung ausbreitet, insbesondere unter Mädchen, und wo Frauen mehr Rechte erlangen, sinken die Kinderzahlen rapide. Und wo auskömmliche Arbeitsplätze entstehen, wo die Menschen ihre Zukunft planen können, gewinnt die Familienplanung an Bedeutung.
Damit wäre, zumindest mittelfristig, die eine Form der Überbevölkerung unter Kontrolle – aber das nächste Problem auf dem Tisch. Denn sobald sich der Wohlstand in den armen Ländern ausbreitet, was das erklärte Ziel von Entwicklung ist, wächst der Hunger nach höherwertigen tierischen Lebensmitteln wie Milch und Fleisch. Unter diesen Bedingungen müssten bis 2050 nach Berechnungen des amerikanischen World Resources Institute im Vergleich zu 2010 rund 56 Prozent mehr Agrarkalorien produziert werden und nicht 40 Prozent, was dem reinen Anstieg der Weltbevölkerung entspräche. Ohne weitere Umweltschäden ist das nicht zu machen.
Um das zu vermeiden und trotzdem mehr Nahrungsmittel zu produzieren, muss sich in den wenig entwickelten Ländern eine neue Form der Landwirtschaft etablieren. Sie muss höhere Erträge liefern, aber ohne dabei Schaden anzurichten. Bislang fahren die Bauern vor allem in Afrika Ernten ein, die weit unter dem liegen, was möglich wäre. Afrikas Landwirtschaft liegt überwiegend in den Händen kleiner Betriebe, die in mühseliger Handarbeit im Wesentlichen für die eigene Familie und nicht für den Markt produzieren. Sie bleiben arm, haben keinen Zugang zu Kapital, zu zertifiziertem Saatgut, zu Dünger, Maschinen und anderen produktionssteigernden Mitteln. Und ihnen fehlt das Fachwissen für eine moderne und umweltschonende Landwirtschaft.
„Nachhaltige Intensivierung“ heißt das Zauberwort, mit dem sich dies ändern ließe. Dabei dürfen sich afrikanische Bäuerinnen und Bauern nicht an der industriellen Produktionsweise europäischer oder amerikanischer Agrarbetriebe orientieren. Diese erreichen zwar erhebliche Erträge, aber auf Kosten der Umwelt und des Weltklimas. Sie verbrauchen extrem viel Wasser, stoßen enorme Mengen an Treibhausgasen aus, belasten mit ihrer Düngung Grundwasser, Seen, Flüsse und dezimieren mit chemisch-synthetischen Schädlings- und Unkrautvernichtungsmitteln die Artenvielfalt. Ähnliche Fehlentwicklungen gab es auch in den einstigen asiatischen Entwicklungsländern im Rahmen der Grünen Revolution.
Afrika braucht deshalb eine „grünere“ Grüne Revolution. Die Landwirte sollten dafür mehr in Misch-, als in Monokulturen arbeiten, also etwa Getreide mit Hülsenfrüchten kombinieren, die eigenständig Stickstoffdünger liefern können. Sie sollten das kostbare Wasser effizienter nutzen und klimaangepasstes, qualitätsgeprüftes Saatgut verwenden, konventionell gezüchtetes wie auch solches, dessen Erbgut mithilfe von „Genscheren“ punktgenau verändert ist. Die Pflanzen, die daraus wachsen, können beispielsweise Parasiten und Fraßinsekten aus eigener Kraft abwehren und benötigen weniger oder gar keine Pestizide. Notwendig ist verbessertes Saatgut auch bei bisher von der Züchtungsforschung vernachlässigten Feldfrüchten wie Hirse, Yams oder Maniok. Diese werden zwar nicht weltweit gehandelt, gehören aber in vielen Ländern zur Basisernährung.
Und die Bauern können von der Digitalisierung profitieren. Schon das allgegenwärtige Handy hat der Landwirtschaft einen enormen Entwicklungsschub gegeben. Afrikanische Landwirte lassen sich mobil beraten und schließen Ernteausfallversicherungen ab. Sie können mit einfachen Sensoren Feuchtigkeit, Säuregrad und Nährstoffgehalt der Böden messen und so Präzisionsfeldbau betreiben. Sie profitieren von Unternehmen wie dem kenianischen „Hello Tractor“, einer Art Uber für Landmaschinen, das Traktoren und andere Gerätschaften samt Fahrer auf mobile Anfrage bereitstellt und den Gebrauch per GPS-Ortung minutengenau abrechnet.
Bleibt in dem großen Klima- und Bevölkerungspuzzle die Frage, wie sich die zweite, die konsumbedingte Überbevölkerung der reichen Länder bewältigen lässt. Sicher ist, dass weder die Agrarproduktion noch die Ernährungsgewohnheiten der dortigen Bevölkerungen ein Beispiel für den ganzen Planeten sein können. Würden alle Menschen nach diesem Muster leben, würde der Klimawandel entgleisen, die letzten Naturräume stünden vor dem Ende.
Natürlich könnten sich die Menschen in den wohlhabenden Ländern im Sinne des Klimaschutzes und der globalen Gerechtigkeit mäßigen. Sie wissen um die Probleme ihrer Lebensweise. Sie könnten ihr Verhalten entsprechend verändern – zumindest theoretisch.
Mehr zum Thema in dem Buch: „Zu viel für diese Welt – Wege aus der doppelten Überbevölkerung“, Edition Körber, Hamburg 2021.
© Copyright Alle Fotos: Reiner Klingholz